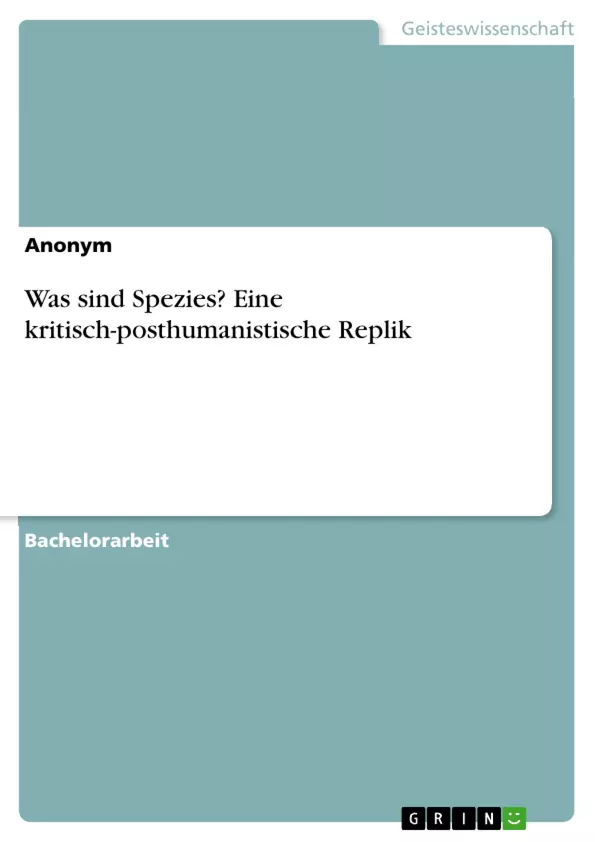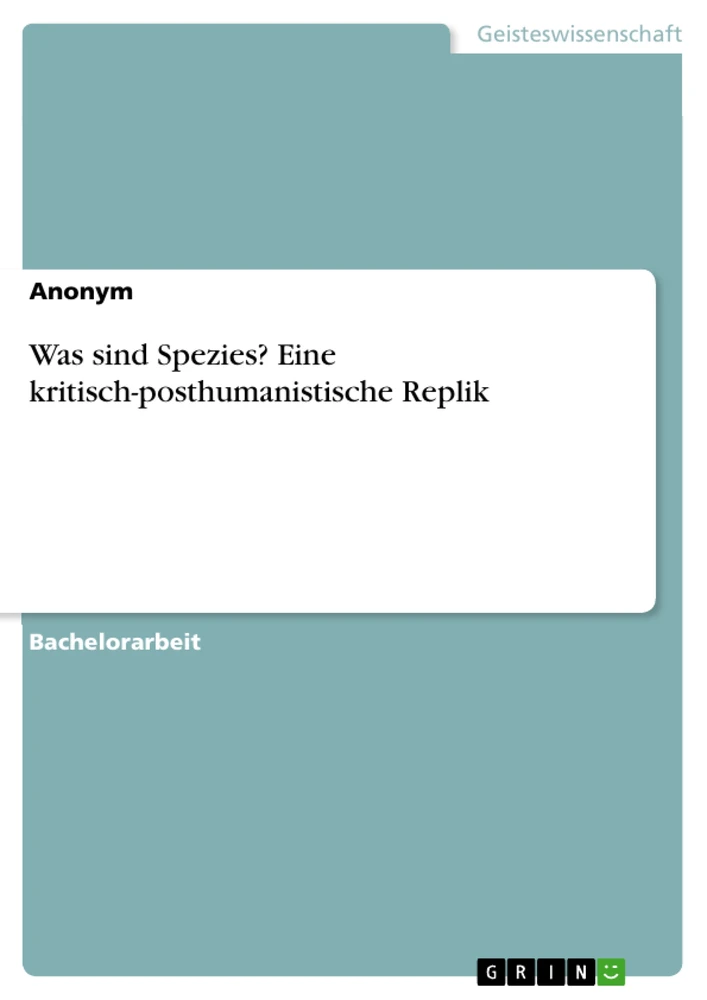
Was sind Spezies? Eine kritisch-posthumanistische Replik
Bachelorarbeit, 2020
32 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Über Spezies – Kriterien zur Unterteilung
Über Spezies – Ontologischer Status
Über Spezies - Der Baum des Lebens
Kapitel 2: Karen Barads Agentischer Realismus
Agentischer Realismus - Hinführung
Agentischer Realismus - Neuer Rahmen
Agentischer Realismus - Queere Natur
Kapitel 3: Donna Haraways Situiertes Wissen
Situiertes Wissen - Vision
Situiertes Wissen - Selbst
Situiertes Wissen – materiell-semiotischer Akteur
Kapitel 4: Schluss
Bibliographie:
Einleitung
Auf den ersten Blick ist die Frage danach, was Spezies oder biologische Arten sind, keine besonders Eindrückliche. So sind wir doch mit ihnen und ihren übergeordneten Familien sowohl aus dem täglichen Leben in Form von Hunden, Katzen, Pferden, Kühen, Delphinen und anderen Menschen, die uns als Säugetiere in unterschiedlichsten Rollen, als Gefährt*innen, Unterhaltung, Lebensunterhalt und wechselseitiger Ignoranz begegnen, wissen aber auch um Eidechsen, Blaumeisen, Bienen, Hechte, Fichten und Gräsern, Bakterien und Viren. Wir sind so eng mit ihnen vertraut, dass die Bandbreite an Praktiken, die wir mit ihnen verbinden, und Bedeutungen, mit denen wir sie ausstatten, hier nicht einmal im Ansatz aufgezählt werden kann. Eine Bewandtnis erhalten Spezies als die zentrale Einheit innerhalb der Biologie, neben den höheren Ordnungen von Gattungen, Familien, Klassen und Reichen des Lebens, dabei besonders in Verbindung mit Evolution als Theorie darwinistischer Vererbung und Selektion. Sie erscheinen darin als abgetrennte, unterscheidbare Entitäten, die sich miteinander, untereinander beeinflussend in der Welt entwickeln und sich ökologischen Veränderungen anpassen. Doch wie unterscheiden sich Spezies voneinander? Sie können etwa als Gruppen, die sich miteinander vermehren und selbst fruchtbaren Nachwuchs zeugen können, gesehen werden, was so, auf den ersten Blick, Pferde von Eseln und allen anderen Arten der Biologie unterscheidet. In Anbetracht von, nicht allein, Bakterien, die sich nicht an diese Unterteilung halten, stellt sich diese Antwort jedoch als unbefriedigend heraus und wirft zudem weitere auf. Wie unabhängig sind etwa Spezies innerhalb der Zeit und untereinander. Was sagt dies über ihr Sein aus? Was sind Arten? Sind sie lediglich wissenschaftliche Konstrukte oder doch real? Wenn ja, auf welche Weise? Wie hängen diese Fragen mit dem Umgang mit und unter ihnen, und damit verbunden einer Ethik der Arten, zusammen?
Diese und ähnliche Fragen werde ich in dieser Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln untersuchen. Dazu werde ich zuerst die Sicht der Philosophie der Biologie, vorgestellt von Peter Godfrey-Smith, sowie die dort aufgeworfenen Fragen und Antworten über Spezies behandeln. In diesem ersten Kapitel werden verschiedene Unterscheidungsmerkmale zwischen Spezies vorgestellt, wobei jede von ihnen Probleme mit der Einordnung mancher Spezies haben wird. Dies wird sowohl die Frage nach der Brauchbarkeit der Kategorie Spezies in den Vordergrund stellen als auch dazu überleiten, die Frage zu behandeln, was Spezies sind. Zum Ende des ersten Kapitels schließlich werden diese Fragen noch einmal aus der Sicht der Darstellung und des Verhältnisses von einzelnen Organismen und Spezies mittels eines Stammbaumes des Lebens gestellt und beantwortet.
In den darauffolgenden Kapiteln werde ich die so gefundenen Antworten und Argumente aus den Blickwinkeln von Karen Barad und Donna Haraway problematisieren. Kapitel 2 wird sich dazu dem agentischen Realismus widmen, der durch die Auflösung des Welle-Teilchen-Paradoxes von Bohr zuerst angestoßen und darauf aufbauend von Barad ausgearbeitet wurde. Innerhalb dieses Rahmens werden die Fragen sowohl umorientiert, neu verbunden als auch dazu verleiten, Fragen über die Ethik der Einteilung der Spezies und der damit verbundenen Verantwortung zugleich mit ihnen zu stellen. Dabei stehen Forschende SPezies nicht einfach gegenüber, sondern beide konstituieren sich in materiellen-kulturellen Relationen wechselseitig. Die Spezies Pfiesteria piscicida wird dabei zum Abschluss die Eigenschaften von Licht in der Sphäre der Biologie emulieren, und dabei die Antworten auf die gestellten Fragen über Spezies verkörpern. Im dritten Kapitel schließlich werden begrenzte Vision und situiertes Wissen als Alternative Haraways herangezogen, um die Fragen über Spezies neu zu stellen und anders zu beantworten. Dies setzt einen auf diesen Begriffen aufbauenden Objektivitätsbegriff voraus, der untersucht werden wird. Die Position, die vorgibt, selbst nicht körperlich markiert über die Natur und Unterscheidbarkeit der Spezies endgültige Antworten zu suchen und finden, stellt sich dabei als göttlicher Trick heraus und steht in Spannung zu situiertem Wissen und partieller Vision.
Kapitel 1: Was sind Spezies?
In diesem Abschnitt beziehe ich mich auf das, in die Philosophie der Biologie einführende, Buch Philosophy of Biology von Peter Godfrey-Smith, das unter anderen die Evolution, Mechanismen, die Frage nach Individuen, Konstruktivismus und DNA, dahingehend einführt, diese für eine (wissenschafts-)philosophische Untersuchung gangbar zu machen. Das Kapitel „Species and the Tree of Life“ bietet so einen Einstieg in die Frage, was biologische Arten, von nun an als Spezies bezeichnet, sind (Godfrey-Smith 2014: S. 100-119). Dabei können grundsätzlich 2 Fragen unterschieden werden: (a) Was sind die Kriterien (orig: grouping criteria), die eine Einteilung von Arten erlauben, und (b) von welchem (ontologischen) Status, welche Sorte von Dingen, sind Arten (Godfrey-Smith 2014: S. 100)? Diese Fragen werde ich zuerst ausgehend von der Argumentation im besagten Buch untersuchen.
Über Spezies – Kriterien zur Unterteilung
Auf die Frage, wie Arten als solche eingeteilt werden können, ist die älteste Antwort ein morphologisches (engl: typololigcal) Konzept (Godfrey-Smith 2004: S.100). Diese zumindest bis auf Aristoteles zurückgehenden Versuche Arten aufzuteilen, sehen Organismen als Teil einer Gruppe, ihrer Spezies, mit der sie gewissen Eigenschaften teilen. Spezies wiederum teilen sich Eigenschaften mit anderen und bilden höhere Einheiten, wie Familien, Ordnungen oder Reiche. Dieses wahrscheinlich auf den ersten Blick bekannte, essentialistische Modell führt spätestens angesichts Darwinistischer Evolutionsbiologie zu Problemen (Godfrey-Smith 2014: S.101). Denn darin sind Arten in stetiger Veränderung begriffen, die es ihnen erlaubt natürlicher Selektion zu trotzen und genug Nachwuchs zu zeugen. Damit gehen Evolution und Essenzen angesichts der Veränderungen, die alle Spezies unentwegt durchlaufen, nur schwer Hand in Hand, obwohl dies nicht zu einem Ausschluss des morphologischen Modells führt. Eine Anpassung an diese veränderte Ausgangslage kann es so sein, nicht mehr eine Liste an unveränderlichen Merkmalen zu erstellen, sondern im Gegenteil Arten nach genereller Übereinkunft (orig: overall similarity) einzuordnen (Godfrey-Smith 2014: S.101). Dies findet anhand einer Gruppe an Eigenschaften statt und bündelt Organismen damit zu Arten zusammen. Dies wird als phenetic view bezeichnet. Doch ergeben sich ebenso für dieses Modell Probleme (Godfrey-Smith 2014: S. 101f). So gibt es viele unterschiedliche Arten von Fruchtfliegen, die dieselben Bündel an Eigenschaften vorweisen. Obwohl diese Kritik ein anderes Konzept von Arten voraussetzt (die verschiedenen Fruchtfliegenarten sind nur eine Art), gibt es in Bezug auf viele Fischarten Unterschiede zwischen als männlich und weiblich markierten Fischen, darunter etwa Anglerfischen (Godfrey-Smith 2014: S. 102).
Eine andere Möglichkeit der Unterteilung schlägt Godfrey-Smith darin vor, Arten in reproduktive Gemeinschaften einzuteilen (Godfrey-Smith 2014: S.102). Höhere Einheiten wären, dieser Analyse nach, allein fiktive Ansammlungen von real existierenden Arten. Ernst Mayr, der als einer der bekanntesten Befürworter dieses Systems vorgestellt wird, gibt dafür die folgende Einteilung: „groups of actually or potentially interbreeding natural populations which are reproductively isolated from other such groups.” (Mayr in Godfrey-Smith 2014: S. 102). Diese Definition geht durch die Betonung der Möglichkeit im Gegensatz zum tatsächlich stattfindenden reproduktiven Erfolg dem Einwand voraus, dass es innerhalb von Populationen immer Individuen gibt, die sich selbst nicht reproduktiv miteinander verbinden können, und doch gemeinsame Nachkommen haben können, wie viele als gleichgeschlechtlich markierte Individuen innerhalb von Spezies. Doch auch das Bild von Populationen ergibt ein Problem, gibt es doch (wiederum) Fischarten, darunter verschiedene Arten von Hamletbarschen, Hypoplectrus, die Gruppen bilden, die sich zwar miteinander fortpflanzen könnten, jedoch bevorzugen, es nicht zu tun (Godfrey-Smith 2014: S. 103). Verschärft stellt sich diese Lage im Falle von Buntbarschen oder Cichliden dar, die das gleiche Verhalten an den Tag legen, dieses jedoch „aufgeben“, wenn das Wasser, in dem sie leben, schlammiger wird, und sie nicht mehr ihre Gruppen von anderen unterscheiden können. Ein weiteres Problem ergibt sich für solche Populationen, die reproduktive Ketten bilden[1], wozu bestimmte Salamander Arten im Central Valley in Kalifornien zählen (Godfrey-Smith 2014: S. 103). Zuletzt stellen asexuelle Organismen, wie etwa Bakterien, dieses Modell durch asexuelle Fortpflanzung und damit der Abwesenheit von reproduktiven Gruppen grundsätzlich in Frage (Godfrey-Smith 2014: S. 103). Als Alternative zu diesem Zu-Kurz-Kommen kann ein cohesion view dienen, in dem verschiedene Eigenschaften wie Sex, eine ökologische Nische oder andere Faktoren als gruppenbildende Maßnahmen gesetzt werden (Godfrey-Smith 2014: S. 104).
Die vorher genannten Einteilungen haben jedoch, so führt Godfrey-Smith aus, ein grundsätzliches Problem damit, Arten in einer temporären Abfolge einzufangen (2014: S.104). Sie vermögen es zwar einigermaßen, in einem evolutionsgeschichtlichen Schnappschuss verschiedene Arten zu finden, können jedoch schlecht mit deren zeitlicher Überlagerung umgehen. In der Evolution geht es jedoch genau um die Entwicklung der Arten. Eine phylogenetische Ordnung nimmt diese Lage der Dinge ernst, indem sie die Abfolge und Abstammung in einem Baum darstellt, in dem wiederum eine Spezies ein Ast wäre (Godfrey-Smith 2014: S. 104). Dabei wird es wichtig eine Art darüber zu bestimmen, von wem diese abstammt, und welche anderen Arten von dieser abstammen und diese ablösen. Somit wird Zeit wesentlich in die Kategorisierung der Spezies einbezogen, diese werden mehr zu raumzeitlichen Individuen. Außerdem wird nicht danach gefragt, mit wem ein Individuum sich fortpflanzen kann, sondern von wem es abstammt.
Ein Standardproblem für dieses Modell liegt wiederum in Bakterien, die sich nicht in einen einfachen Baum eintragen lassen, sondern netzartige Abzweigungen miteinander machen (Godfrey-Smith 2014: S. 105). Zur Behebung dessen schlägt Godfrey-Smith eine genetische oder morphologische Analyse als Zusatz zu dieser phylogenetischen Unterscheidung vor, mit der Arten über ihre gemeinschaftliche Abstammung hinaus ein gewisses, sie in jedem Fall auszeichnendes Bündel an Charakteristika zu ihrer, weiteren Einteilung verfügen. Dabei steht jedoch in beiden Fällen noch zur Frage, ob ein solches Bündel genetischer oder morphologischer Unterscheidungsmerkmale existiert (Godfrey-Smith 2014: S. 105f.). Selbst wenn es ein solches geben würde, wie ist dieses mit einer Veränderung in der Zeit vereinbar? Wie kann dieses nicht mit einem Austausch durch andere Gene, die eine ähnliche Funktion übernehmen, kompensiert und dabei obsolet werden? Godfrey-Smith veranschaulicht dies anhand eines postulierten Bündels menschlicher Charakteristika. Dabei stellt er sich die Frage, ob dieses nicht austauschbar wäre, wie oben beschrieben, und stellt fest, dass es weder überraschend wäre, wenn dies der Fall ist, sowie wenn dies nicht der Fall ist (Godfrey-Smith 2014: S. 106). Dies reflektierend, fährt er fort:
“And once we leave very distinctive species, like ours, and consider cases where there are large numbers of different species (of fish, of fruit flies) that are very similar in how they live, it becomes clear that the lifestyle of one species can be lived with the genome of another. Humans, who have no close living relatives and who live such unusual lives, are not a good model for species in general.” (Godfrey-Smith 2014: S. 106).
Die so postulierte Einzigartigkeit der Menschen, in dem Sinne, dass Menschen aufgrund eines besonders breiten Spektrums an möglichen Lebensformen zwar theoretisch das phylogenetische Modell unterlaufen, jedoch dennoch kein gutes Beispiel für eine Spezies ist, werde ich im Rahmen der weiteren Argumentation dieser Arbeit wieder aufgreifen. Sie bilden damit jedenfalls die Ausnahme zu anderen Spezies, die ebenso keine distinkten genetischen Informationen zeigen.
Im Abschluss dieses Abschnitts, schlägt Godfrey-Smith aus Basis der Beschreibung der Kriterien, die unzufriedenstellend bleiben muss, zwei Auswege vor: entweder werden in einem pluralistischen Vorhaben verschiedene Ansätze vermischt, je nach Problem angewandt, je nach Spezies unterschiedlich zu findende Kriterien verwendet, oder aber der ganze Ansatz verworfen, da das Spezieskonzept ohne eine gute Entscheidungshilfe nicht mehr tragbar ist (Godfrey-Smith 2014: S. 107). Mit dem zweiten Ansatz verwandt ist ein Instrumentalismus, der Spezies zwar nicht als reale Einheiten der Natur anerkennt, diese aber durch ihre Nützlichkeit beibehalten will. Als Hauptproblem oder Anreiz dafür sieht Godfrey-Smith unter all den gesehen Problemen der Kategorisierung wiederum die Zeitlichkeit der Spezies. Wenn in einer Ausflucht, die er anhand von Ernst Mayr präsentiert, behauptet wird, Spezies allein dimensionslos zu sehen und keinen zeitlichen Vergleich zwischen Spezies zu ermöglichen, besteht in dieser Zusage, um von Spezies reden zu können, viel eher eine Absage. So könnten damit etwa Aussagen von Haien als mehrere tausend Jahre alte Spezies nicht mehr getroffen werden, denn es gäbe keine Kriterien diese zu vergleichen. Dieser eigentlichen Absage an das Konzept der Spezies steht Godfrey-Smith am wohlwollendsten entgegen (Godfrey-Smith 2014: S. 107).
Über Spezies – Ontologischer Status
Die zweite Art, nach der Spezies befragt werden können, handelt für Godfrey-Smith von ihrem metaphysischen Status (Godfrey-Smith 2014: S. 108). Aus der Sicht der Wissenschaftsphilosophie, vorgestellt durch Godfrey-Smith, ergibt sich zuerst die Frage danach, ob Spezies als Individuum oder als Gruppe angesehen werden sollten. Spezies sind so etwa selbst Individuen im Gegensatz zu Gemeinschaften und Gruppen, indem sie die Akteure der Evolution sind. Sie entstehen, verändern sich und sterben eventuell aus. Dabei sind sie partikuläre Entitäten, Individuen in Raum und Zeit, denn nur als solche können sie evolutionär tätig werden. Ein Organismus ist dabei ein Teil der Spezies, so wie die rechte Hand Teil eines Körpers ist.
Zu dieser Unterscheidung ergeben sich für Godfrey-Smith drei Weisen diese Gruppen oder Individuen zu unterscheiden: Mengen, Summen und Eigenschaften (Godfrey-Smith 2014: S. 108f.). Mengen sind abstrakte Sammlungen von Objekten, wobei die einzelnen Bestandteile Mitglieder sind. Summen setzen sich nicht aus Mitgliedern von Mengen, sondern aus Bestandteilen zusammen, wie Körperteile und Körper. Summen können so im Unterschied zu Mengen kollektiv aktiv werden. Gruppierungen können zuletzt ebenso als Instanziierungen von Eigenschaften gesehen werden, in denen die Bestandteile eine bestimmte Eigenschaft verbindet, und diese durch sie ausgedrückt wird.
Godfrey-Smith argumentiert dafür, dass Spezies sowohl als Mengen, Summen und Eigenschaften gesehen werden können. Dies gilt unabhängig von den verwendeten Gruppierungsmerkmalen. “Species are not really sums (big scattered particulars), or really sets, or kinds defined by shared properties. Species are aspects of the world’s organization that can be thought about in three different ways.” (Godfrey-Smith 2014: S. 109) So beiziehen sich Spezies auf real existierende Entitäten in der Welt, die je nach der Art, wie über die auf verschiedene Weisen, anhand von Gruppen, Mengen oder Eigenschaften nachgedacht werden kann.
Zur Verdeutlichung wählt der Godfrey-Smith das Beispiel von Churchills und Kohlenstoffdioxid (Godfrey-Smith 2014: S. 109f.). Während Churchills eher eine phylogenetische Bestimmung naheliegen, von eine*r Churchill abzustammen, oder mit eine*r Churchill verheiratet zu sein, und CO2 eine typologische Bestimmung ist, also über gewisse Atome in einer bestimmten Anordnung zu verfügen, können beide als alle drei Arten von Gruppierungen beschrieben werden: „Er bekam den Job weil er Churchill war“, „Der Anteil an CO2 in der Atmosphäre korreliert mit einer Zunahme ihrer Temperatur“, wenn von ihnen als Eigenschaft gesprochen wird; „Churchills lieben Zigarren“, „CO2 Moleküle haben 22 Protonen“, wenn sie als Mengen gesehen werden; „Die Churchills fahren auf Urlaub“, „CO2 nimmt in der Atmosphäre zu“ wenn sie als Summen gelten (Godfrey-Smith 2014: S. 110). CO2 und Churchills sind so, obwohl sie verschiedene Kriterien ihre Existenz als solche verdanken, als Gruppierungen auf die jeweils selben Weisen zu sehen.
Dasselbe gilt für Spezies, die durch verschiedene Kriterien als solche bestimmt werden können, dennoch jeweils entweder als eine Menge, Summe oder Verkörperung einer Eigenschaft gedacht werden können (Godfrey-Smith 2014: S. 110). Dies heißt jedoch nicht, dass es in all den Fällen nicht eine bevorzugte Art gibt die Dinge einzuordnen (Godfrey-Smith 2014: S. 111). So ist die Gruppierung als Eigenschaft für Godfrey-Smith zumeist verbunden mit intrinsischen Eigenschaften, Gruppierung als Summen eher im Hinblick auf extrinsische Eigenschaften angebracht. Extrinsische Eigenschaften betonen Relationen, die geeigneter sind, um über Churchills nachzudenken, während intrinsische in sich stimmig sind, wie im Beispiel des CO2 (Godfrey-Smith 2014: S. 111). Spezies beziehen sich so für Godfrey-Smith auf eine Struktur der Welt, die je nachdem, ob extrinsische oder intrinsische Eigenschaften betrachtet werden, bevorzugt als eine der drei Möglichkeiten gedacht werden kann (Godfrey-Smith 2014: S. 113). Spezies als Individuen zu denken stellt sich so zugleich als hilfreich, um bestimmte Eigenschaften zu betrachten, und als falsch heraus, weil sie dabei Mengen sind (Godfrey-Smith 2014: S. 113)
Über Spezies - Der Baum des Lebens
Ich will zuletzt noch auf den Stammbaum des Lebens (orig: tree of life) erwähnen, als Resultat, zentrales Denkmotiv, Ergänzung zur Evolution als natürliche Selektion, mit dem ebenso Godfrey-Smith sein Kapitel über Spezies beschließt (2014: S.113f.). Der Stammbaum des Lebens kann als eine Darstellung der Beziehungen zwischen Organismus gesehen werden, der ihre Herkunft aufzeigt und selbst nicht notwendig mit Spezies zu tun hat. Wie es zu diesem kommt beschreibt Godfrey-Smith folgendermaßen (Godfrey-Smith 2014: S. 114): Als Ausgangspunkt dient ein durchsichtiger Block aus durchsichtigem Gummi, in dem jeder je lebende Organismus eingeritzt und somit markiert wird. Dies beginnt mit dem ersten Organismus am Boden des Blockes, und setzt sich vertikal für die jeweilige Zeit der entstehenden Organismen fort. Nachwuchs wird dabei immer etwas oberhalb der Eltern eingezeichnet, und diese gegenseitig durch Striche verbunden. Im fertigen Block entsteht so, aus der Nähe betrachtet, ein Netzwerk an Verbindungen, die in manchen Regionen des Blocks erratisch bleiben, sich in anderen zu Klumpen verbinden. Manche Blöcke können isoliert werden, indem an ihnen gezogen wird und sie nichts mitreißen, für andere scheint dies unmöglich. An der Spitze des Blockes, bei dem Organismen die am heutigen Tage leben, können so etwa alle Menschen isoliert werden, und von ihnen jeweils auf ihre Vorfahren geschlossen werden, und beim Rückgang in der Zeit, beim Hinunterlaufen der Verbindungen innerhalb des Blockes, sollte somit irgendwann die letzten gemeinsamen Vorfahren gefunden werden, von denen sich unterschiedliche Wege unterschiedliche Gruppen repräsentierend fortbilden.
Das Bild stellt den Anspruch auf diese Weise, analog zu einer Karte städtisch-öffentlicher Verkehrsmittel, einen real existierenden Bereich der Welt zu repräsentieren, obwohl es selbst ein Resultat einiger Abstraktionen, Metaphern u.ä. ist (Godfrey-Smith 2014: S. 115). Interessanterweise führt Godfrey-Smith hier ein Zitat von Julian Huxley[2] an, das ich hier ebenso wiedergeben will:
“As individual emerges from individual along the line of species, so does species emerge from species along the line of life, and every animal and plant, in spite of its separateness and individuality, is only a part of the single, continuous, advancing flow of protoplasm that is invading and subduing the passive but stubborn stuff of the inorganic.” (Huxley (1912) in Godfrey-Smith 2014, S.115)
Auf die imperialistische Sprache, wenn von Invasion des Anorganischen durch das Leben die Rede ist, aufmerksam machend, erhellt dies für Godfrey-Smith, dass das Leben auf der Erde so eine gewisse Form einnimmt, sowohl physikalisch in Form aller Organismen individuell zusammen den physikalischen Körper ergeben, als auch eine totale Form, die beschreibt, wie sich alle Tiere und Lebewesen allgemeiner verhalten (Godfrey-Smith 2014: S. 116). Dazu muss etwas das oben vorgestellte Blockmodell verändert werden, was wiederum dessen darwinistische Prägung der Darstellung des Lebens auf der Erde aufzeigt. Eine Lamark‘sche Evolution, die die Entstehung von Leben als spontan ansieht und von den Vorfahren unabhängig erworbene Eigenschaften annimmt, würde so Leben insgesamt anders einteilen. Der Stammbaum des Lebens hat so als Aufgabe die Form des Lebens auf der Erde als Gesamtheit korrekt darzustellen, nicht nur gewisse Ähnlichkeiten von Lebewesen aufzuzeigen (Godfrey-Smith 2014: S. 116).
Dabei bieten sich Ansichten auf den Baum entweder nah oder weiter weg an. Weiter entfernt werden Spezies in einigen Bereichen des Blocks sichtbar, und näher daran einzelne Individuen, die über die Zeit hinweg leben und sterben. In der Mikro-Ansicht tauchen so sehr unterschiedliche Organismen innerhalb des Blocks auf (Godfrey-Smith 2014: S. 116f.). Sich sexuell fortpflanzende Individuen sind eher selten, also werden Markierungen, die zwei Linien nach unten haben, eher selten sein. Farne etwa können sich sexuell und asexuell fortpflanzen. Bakterien können ihr Erbmaterial mit weit entfernten Arten austauschen in einem Prozess der „Lateral Gene Transfer“ genannt wird. Dazu haben sie eigene Strukturen, die wie Fühler Brücken zu anderen Bakterienarten ausbilden, um über sie DNA auszutauschen. Eukaryotische Zellen sind wiederum Vereinigungen unterschiedlicher Bakterien, die sich in neuen Strukturen zu einem gewissen Zeitpunkt, markiert ab einer gewissen Höhe im Block des Lebens, zusammentun. Eukaryoten wiederum organisierten sich im Laufe des Blocks zusammen zu größeren Einheiten, darunter Pferde, Mäuse und Pflanzen. Der Baum des Lebens selbst kann so ein Baum der Zellen, der DNA oder einzelner Lebewesen gesehen und gezeichnet werden, Strukturen die ineinander verschachtelt über dieselbe Zeit bestehen (Godfrey-Smith 2014: S. 118).
Der Baum wird so zumindest an manchen Stellen kaum mehr ein Baum sein, sondern mehr einem Netz, ob der vielen Querverbindungen interagierender, weit entfernter Organismen, gleichen. Abgesehen davon, wie die Struktur benannt wird und wie diese aussieht, wird, so argumentiert Godfrey-Smith die erhaltenen Strukturen dennoch eine Repräsentation des Lebens auf der Erde sein (2014: S. 118). Diese Darstellung erlaubt Godfrey-Smith eine abschließende Antwort auf die Frage der Spezies zu geben. In unterschiedlichen Regionen des Baums befinden sich andere Arten von Arten, manche die sich sexuell fortpflanzen, manche Gruppen, die eher genetische Verwandtschaften sind, bzw. andere, die in einem Kohäsionsmodell untergebracht werden können. Spezies sind so je etwas anderes wo sie sich aufhalten im Block, und bedeuten etwas anderes je nachdem, worauf sie verweisen, wodurch zwar einerseits über Spezies gesprochen werden kann, diese aber keine realen Unterteilungen aufzeigen. Sie zeichnen sich so wiederum darum aus, weil sie erlauben unterschiedliche Strukturen in der Welt zu benennen.
Mit dieser vorläufigen Antwort auf die Frage nach den Kriterien zwischen und der Natur von Spezies liegt genug Material für die agentische Analyse im nächsten Kapitel vor, was ich als einen Grund für die ausführliche Beschäftigung mit Godfrey-Smiths Kapitel über Spezies sehe. Obwohl diese Analyse die Ansicht von und das Denken über Spezies in eine sehr andere Richtung lenken wird, sind so dennoch reichlich Anhaltspunkte da, an die ich anknüpfen werde.
Details
- Titel
- Was sind Spezies? Eine kritisch-posthumanistische Replik
- Hochschule
- Universität Wien (Philosophie)
- Veranstaltung
- 180076 KU Kritischer Posthumanismus - Einführung (2019W)
- Note
- 1
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V1589408
- ISBN (eBook)
- 9783389132159
- ISBN (Buch)
- 9783389132166
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Posthumanismus Wissenschaftsphilosophie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 18,99
- Preis (Book)
- US$ 22,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Was sind Spezies? Eine kritisch-posthumanistische Replik, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1589408
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-