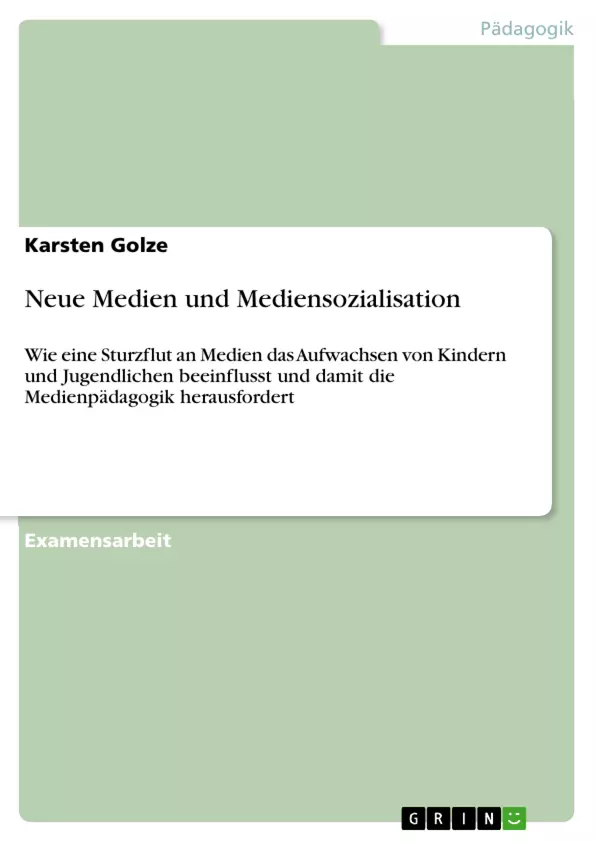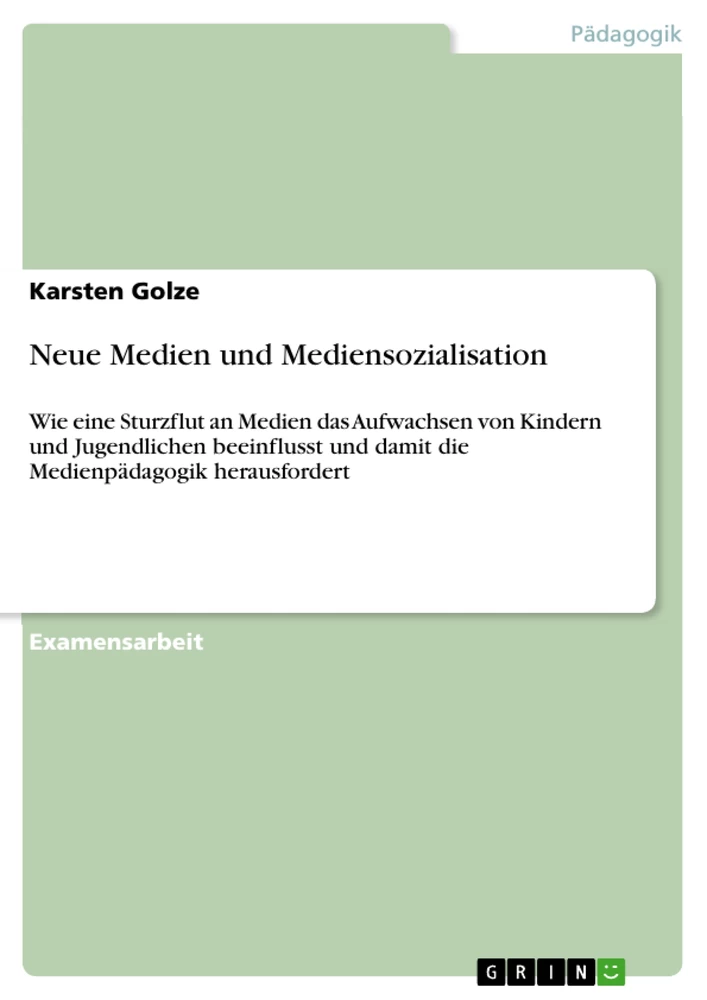
Neue Medien und Mediensozialisation
Examensarbeit, 2010
157 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- A. Medientheorie und Medienentwicklung - »Der Pegel steigt«
- 1. Zur Theorie der Medien
- 1.1 Grundlegendes zur Medien- und Kommunikationstheorie
- 1.2 Spezielle Medientheorien
- 2. Zur Entwicklung der Medien
- B. Mediensozialisation - Vom »Sturz ins,mediale' Nass« bis zum »Treiben in der Flut«
- 1. Mediensozialisationsforschung
- 1.1 Theoretische Grundlagen der Mediensozialisation
- 1.2 Mediennutzung und empirische Befunde
- 2. Neue Medien in Familie und Peergroup
- 2.1 Neue Medien und Familie
- 2.2 Neue Medien und Peergroup
- 3. Neue Medien in der Freizeit
- 4. Neue Medien und Sprache
- C. Medienpädagogik - »Das rettende Ufer«
- 1. Medienpädagogische Ansätze, Aufgaben und Ziele
- 2. Die Integration der Medienpädagogik in den Unterricht
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die zunehmende Bedeutung von Medien im Alltag von Kindern und Jugendlichen und untersucht die Herausforderungen, die diese Entwicklung für die Medienpädagogik mit sich bringt. Die Arbeit beleuchtet sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Befunde zu Medienentwicklung, Medientheorie und Mediensozialisation. Sie betrachtet die Rolle der Medien in verschiedenen Lebensbereichen, wie Familie, Peergroup und Freizeit, und untersucht den Einfluss der Medien auf Sprache und Kommunikation.
- Entwicklung und Bedeutung der Medien
- Mediensozialisation und ihre Auswirkungen auf das Aufwachsen
- Die Rolle der Medien in der Familie und Peergroup
- Der Einfluss der Medien auf Sprache und Kommunikation
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Medienpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung
Die Einleitung stellt die These auf, dass die Medienentwicklung zu einer „Sturzflut“ an Informationen geführt hat, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Gesellschaft mit sich bringt.
A. Medientheorie und Medienentwicklung - »Der Pegel steigt«
Dieses Kapitel behandelt theoretische Ansätze zur Medien- und Kommunikationstheorie und beleuchtet die historische Entwicklung der Medien von der Mündlichkeit über die Schriftlichkeit bis zur Digitalisierung.
B. Mediensozialisation - Vom »Sturz ins,mediale' Nass« bis zum »Treiben in der Flut«
Das Kapitel untersucht die Mediensozialisation, ihre theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde. Es analysiert die Rolle der Medien in verschiedenen Sozialisationsinstanzen wie Familie und Peergroup und betrachtet den Einfluss der Medien auf das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen.
C. Medienpädagogik - »Das rettende Ufer«
Der letzte Abschnitt beleuchtet verschiedene medienpädagogische Ansätze, Aufgaben und Ziele. Es werden Konzepte zur Integration der Medienpädagogik in den Unterricht und die Bedeutung von Mediendidaktik für Lehren und Lernen mit neuen Medien diskutiert.
Schlüsselwörter
Medienentwicklung, Medientheorie, Mediensozialisation, Mediennutzung, Neue Medien, Familie, Peergroup, Freizeit, Sprache, Kommunikation, Medienpädagogik, Mediendidaktik.
Details
- Titel
- Neue Medien und Mediensozialisation
- Untertitel
- Wie eine Sturzflut an Medien das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen beeinflusst und damit die Medienpädagogik herausfordert
- Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Philosophische Fakultät)
- Autor
- Karsten Golze (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 157
- Katalognummer
- V159156
- ISBN (eBook)
- 9783640722624
- Dateigröße
- 2936 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Neue Medien Mediensozialisation Sturzflut Aufwachsen Kindern Jugendlichen Medienpädagogik Neue Medien Mediengesellschaft Kommunikation Mediendidaktik Kommunikationsmodelle Mediengeschichte Sozialisation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Arbeit zitieren
- Karsten Golze (Autor:in), 2010, Neue Medien und Mediensozialisation, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/159156
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-