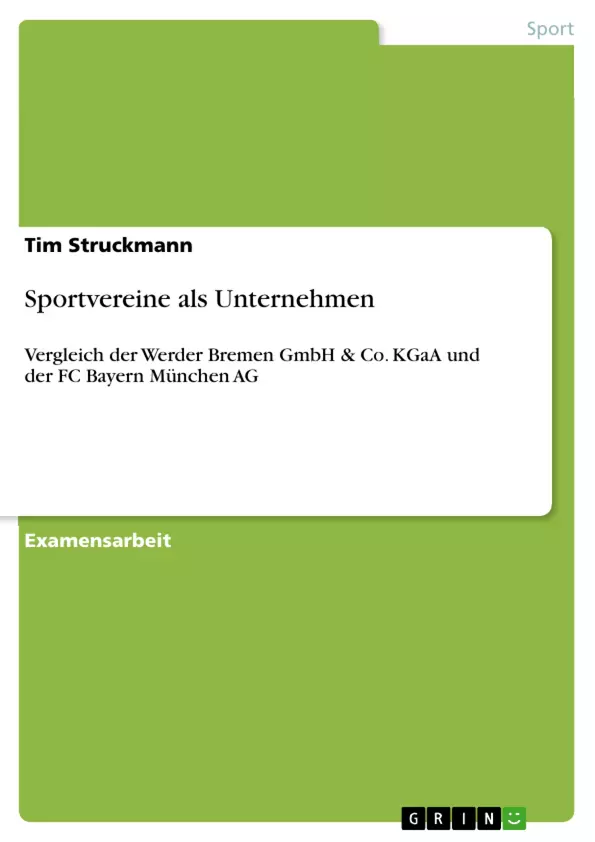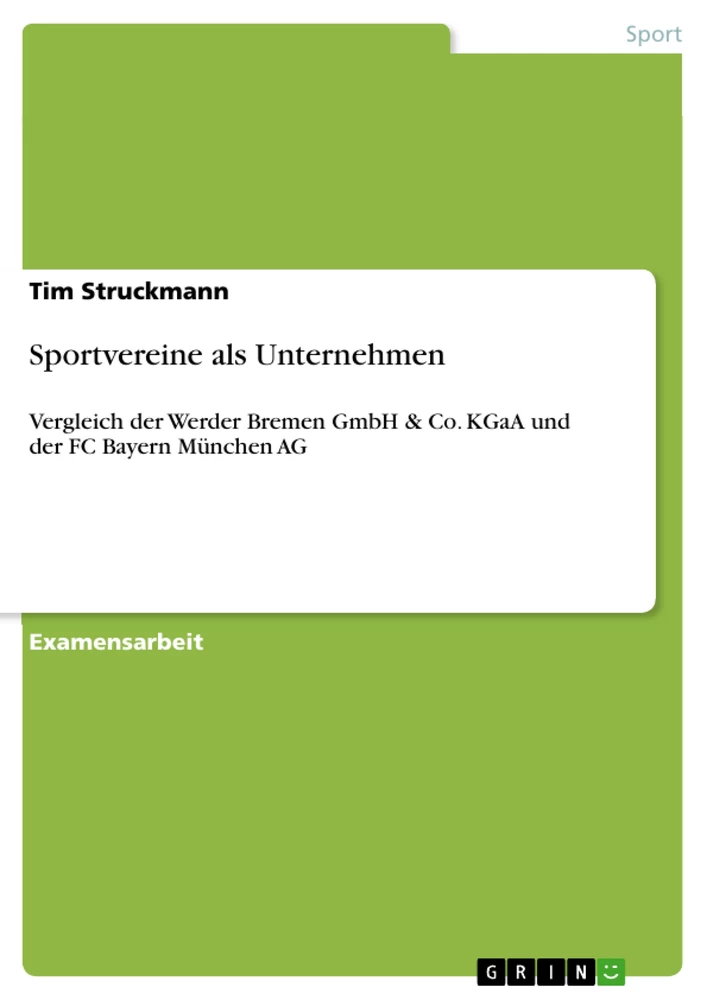
Sportvereine als Unternehmen
Examensarbeit, 2010
23 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die Kommerzialisierung des Profi-Fußballs in Deutschland
- Rechtliche Rahmenausgestaltung des DFB
- Satzungsänderung des DFB – Eine Reformierung des Profifußballs
- Die „,50+1 Regel\" des DFB
- Eingetragener Verein oder wirtschaftliche Unternehmung
- Der eingetragene Verein (e.V.)
- Der Begriff,Unternehmung‘
- Zwei Clubs - Unterschiedliche Gesellschaftsformen
- Werder Bremen GmbH & Co. KGaA
- Vereinsprofil & sportliche Erfolge
- Die GmbH & Co. KGaA - Theorie & Praxis
- FC Bayern München AG
- Vereinsprofil & sportliche Erfolge
- Die Aktiengesellschaft – Theorie & Praxis
- Werder Bremen GmbH & Co. KGaA
- Der Vergleich der KGaA und der AG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Kommerzialisierung des Profi-Fußballs in Deutschland am Beispiel der Vereine Werder Bremen und FC Bayern München. Im Fokus steht der Wandel von Sportvereinen zu Unternehmen und die damit einhergehende Ausgliederung der Lizenzspielerabteilungen in rechtlich selbstständige Kapitalgesellschaften. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen, die durch den DFB geschaffen wurden, und beleuchtet die unterschiedlichen Gesellschaftsformen der beiden Vereine: die GmbH & Co. KGaA (Werder Bremen) und die Aktiengesellschaft (FC Bayern München).
- Entwicklung der Kommerzialisierung im Profi-Fußball
- Rechtliche Rahmenbedingungen des DFB
- Vergleich der Gesellschaftsformen GmbH & Co. KGaA und Aktiengesellschaft
- Analyse der Vereinsstrukturen von Werder Bremen und FC Bayern München
- Vorteile und Nachteile der jeweiligen Gesellschaftsformen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Kommerzialisierung im deutschen Profi-Fußball. Das zweite Kapitel widmet sich den rechtlichen Rahmenbedingungen des DFB, insbesondere der Satzungsänderung und der „,50+1 Regel\". Das dritte Kapitel definiert den Begriff „Unternehmung“ und unterscheidet ihn vom eingetragenen Verein. Im vierten Kapitel werden die beiden Vereine Werder Bremen und FC Bayern München vorgestellt, wobei die jeweiligen Gesellschaftsformen und deren theoretische und praktische Umsetzung im Detail erläutert werden. Das fünfte Kapitel schließlich vergleicht die gewählten Gesellschaftsformen KGaA und AG und beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Modelle.
Schlüsselwörter
Kommerzialisierung, Profi-Fußball, Sportvereine, Unternehmen, DFB, Satzungsänderung, 50+1 Regel, eingetragener Verein, Unternehmung, GmbH & Co. KGaA, Aktiengesellschaft, Werder Bremen, FC Bayern München, Vergleich, Gesellschaftsformen.
Details
- Titel
- Sportvereine als Unternehmen
- Untertitel
- Vergleich der Werder Bremen GmbH & Co. KGaA und der FC Bayern München AG
- Hochschule
- BVL Campus gGmbH
- Veranstaltung
- Betriebswirtschaftslehre - Unternehmensführung
- Note
- 1,3
- Autor
- Tim Struckmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 23
- Katalognummer
- V159562
- ISBN (eBook)
- 9783640728602
- ISBN (Buch)
- 9783640729043
- Dateigröße
- 1234 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Werder Bremen FC Bayern FC Bayern München Bayern München FC Bayern München AG Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Unternehmensführung DFB DFL 50+1 Regel Kommerzialisierung Profifußball Ausgliederung Lizenzspielerabteilung Leistungssport Deutscher Fußball Bund Deutsche Fußball Liga Sportvereine Profisport Unternehmen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Tim Struckmann (Autor:in), 2010, Sportvereine als Unternehmen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/159562
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-