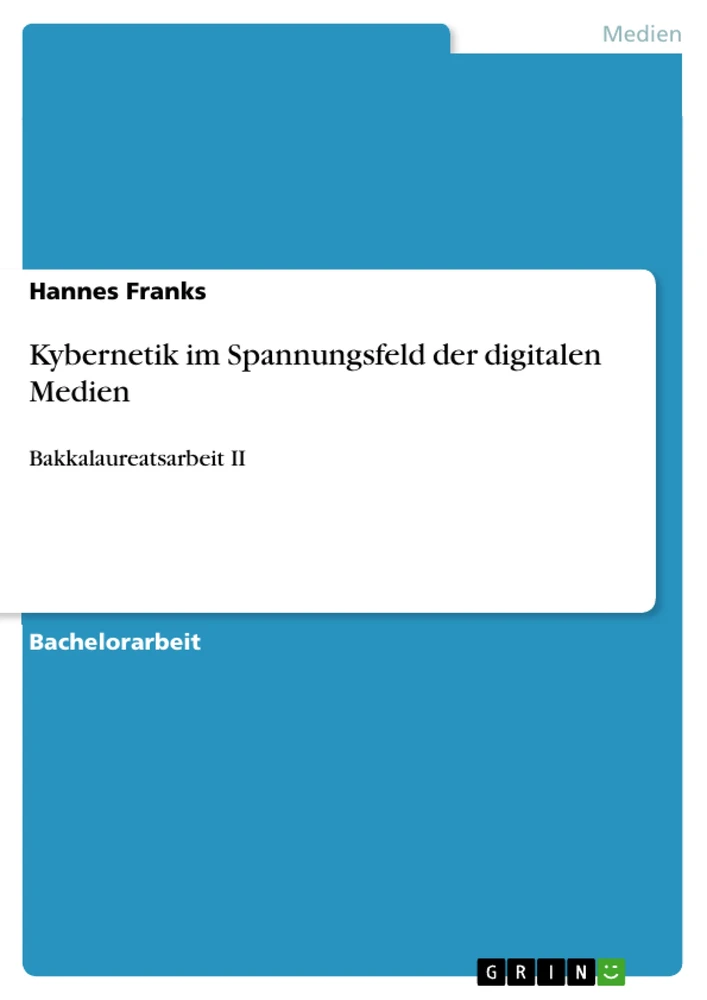
Kybernetik im Spannungsfeld der digitalen Medien
Bachelorarbeit, 2010
40 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Formale Kybernetik
- Grundlagen und Entstehung
- Die Macy Konferenzen
- Einfluss auf die wissenschaftliche Gemeinde
- Kybernetik und Soziologie
- Kybernetik zweiter Ordnung
- Beobachtung zweiter Ordnung
- Konstruktivistische Sichtweisen
- Kybernetik und digitale Medien
- Anwendung auf digitale Medien
- Massenmedien und Kybernetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bakkalaureatsarbeit II befasst sich mit der Wissenschaft der Kybernetik, analysiert deren Prinzipien und untersucht ihre Anwendung im Kontext digitaler Medien. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Kybernetik und ihre relevanten Konzepte verständlich darzulegen und deren Bedeutung im digitalen Zeitalter aufzuzeigen.
- Die Entwicklung und Prinzipien der formalen Kybernetik
- Die Anwendung der Kybernetik auf soziologische Problemfelder
- Die Bedeutung der Kybernetik zweiter Ordnung und des Konstruktivismus
- Die Einordnung digitaler Medien und Massenmedien in das kybernetische Denkmodell
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der formalen Kybernetik, deren Ursprünge und Einfluss auf die wissenschaftliche Gemeinde. Es beleuchtet die Arbeiten von Norbert Wiener und die Bedeutung der Macy Konferenzen für die Entwicklung des kybernetischen Denkens.
Das zweite Kapitel widmet sich der Anwendung der Kybernetik auf soziologische Problemfelder. Hier wird die Kybernetik zweiter Ordnung vorgestellt und der Zusammenhang zwischen Beobachtung zweiter Ordnung und konstruktivistischen Sichtweisen aufgezeigt.
Das dritte Kapitel untersucht die Relevanz der Kybernetik im Kontext digitaler Medien und Massenmedien. Es beleuchtet die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich aus der Anwendung kybernetischer Prinzipien auf diese Bereiche ergeben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder dieser Arbeit sind Kybernetik, Konstruktivismus, Beobachtung zweiter Ordnung, digitale Medien, Massenmedien und die Anwendung kybernetischer Prinzipien in der digitalen Welt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist formale Kybernetik?
Die formale Kybernetik, geprägt von Norbert Wiener, befasst sich mit der Steuerung und Regelung von Systemen durch Informationsübertragung.
Was waren die Macy-Konferenzen?
Dies waren interdisziplinäre wissenschaftliche Treffen nach dem Zweiten Weltkrieg, die als Geburtsstunde der Kybernetik gelten.
Was unterscheidet die Kybernetik zweiter Ordnung?
Während die erste Ordnung Systeme beobachtet, befasst sich die zweite Ordnung mit dem Beobachter selbst und wie dieser das System durch seine Beobachtung beeinflusst.
Wie hängen Kybernetik und digitale Medien zusammen?
Digitale Medien fungieren als kybernetische Systeme, in denen Feedbackschleifen und Informationsverarbeitung die Interaktion zwischen Mensch und Maschine steuern.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus in der Kybernetik?
Der Konstruktivismus betont, dass Realität durch den Beobachter erschaffen wird, was in der Kybernetik zweiter Ordnung zentral für das Verständnis von Kommunikation ist.
Details
- Titel
- Kybernetik im Spannungsfeld der digitalen Medien
- Untertitel
- Bakkalaureatsarbeit II
- Hochschule
- Fachhochschule Salzburg (Mediacube)
- Note
- 1
- Autor
- Hannes Franks (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 40
- Katalognummer
- V160777
- ISBN (eBook)
- 9783640745906
- ISBN (Buch)
- 9783640746538
- Dateigröße
- 593 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kybernetik Norbert Wiener Heinz von Foerster Beobachter Luhmann Medien Medienwissenschaft Medienkultur Ross Ashby Macy Konferenz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Hannes Franks (Autor:in), 2010, Kybernetik im Spannungsfeld der digitalen Medien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/160777
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









