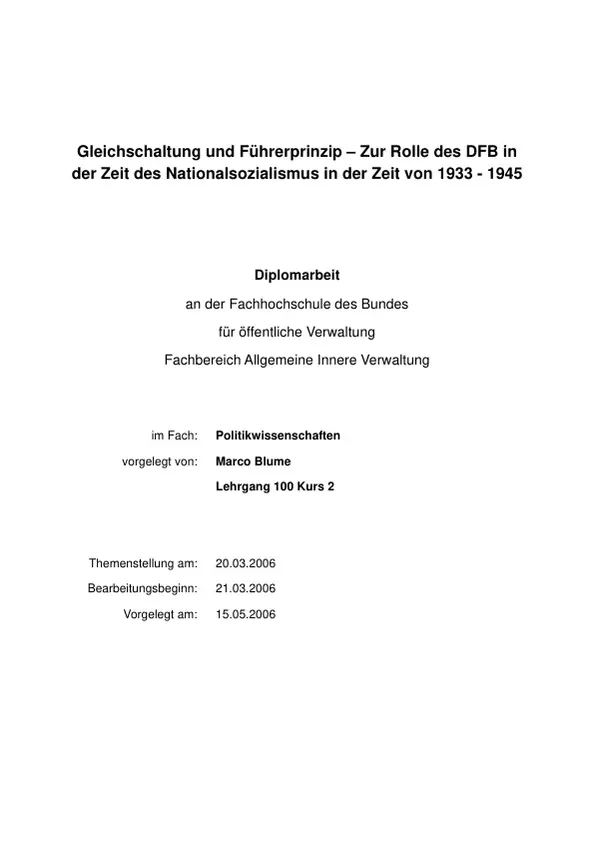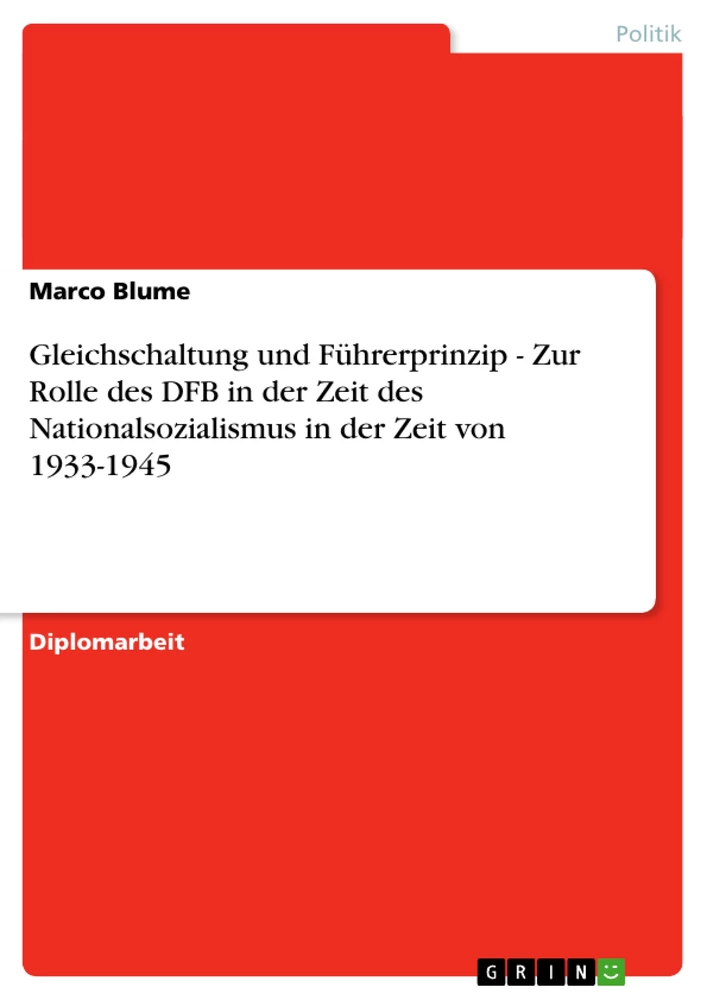
Gleichschaltung und Führerprinzip - Zur Rolle des DFB in der Zeit des Nationalsozialismus in der Zeit von 1933-1945
Diplomarbeit, 2006
146 Seiten, Note: Sehr gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fußball - Mehr als nur eine Sportart
- Von den Anfängen in Deutschland zum Massenphänomen
- Nationalsozialismus in Deutschland und seine gesellschaftlichen Folgen
- Gesellschaftliche Entwicklung vom Ersten Weltkrieg bis 1933
- Gesellschaftsprogrammatik des Nationalsozialismus
- Die Gleichschaltung
- Das Führerprinzip
- Der DFB im NS-Regime - Zwischen Gefolgschaft, Angepasstheit und Insubordination
- Geburtsstunde und Aufstieg des Verbandes
- Die Anfänge des Deutschen Fußballbundes (1900-1912)
- Im Zeichen von Militarismus und Nationalismus (1912-1918)
- Die Weimarer Republik (1918-1933)
- Aufstieg des Nationalsozialismus und Restrukturierung des Fußballsports
- Die Unterordnung und Auflösung des DRA im Rahmen der ersten Gleichschaltung des deutschen Sports
- Die Folgen der ersten Gleichschaltung und die Legitimation des DFB durch den Nationalsozialismus
- Die „Vereinnahmung“ des DFB im Zeichen der Olympischen Spiele 1936
- Der internationale Aufstieg des deutschen Fußballs – Länderspiele und die deutsche Nationalmannschaft
- Die Person Otto Nerz
- Die Olympiade von 1936 – Der Wendepunkt
- Verlust der Privilegien – der DFB als Opfer der zweiten Gleichschaltung des deutschen Sports
- Der Streit um den Nachwuchs – Fußballverein oder Hitlerjugend
- Die Person Sepp Herberger
- Der DFB verliert sein Gesicht – von der personellen Ausblutung zur Auflösung des Verbandes
- Exkurs: Fußball und Krieg – Zwischen Wahn und Tragödie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Rolle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) während der NS-Zeit (1933-1945). Die Arbeit analysiert, wie der DFB sich dem nationalsozialistischen Regime anpassten, welche Strategien der Anpassung und des Widerstands verfolgt wurden und welche Folgen diese Entwicklungen für den deutschen Fußball hatten. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Sport, Politik und Ideologie im nationalsozialistischen Deutschland.
- Die Gleichschaltung des deutschen Fußballs unter dem Nationalsozialismus
- Die Auswirkungen des Führerprinzips auf die Strukturen und die Entscheidungsfindung im DFB
- Die Rolle des DFB bei der Propagierung nationalsozialistischer Ideologie
- Der Einfluss des Sports auf die gesellschaftliche Entwicklung im Dritten Reich
- Der Konflikt zwischen Sport und Politik im Kontext der NS-Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Bedeutung des Fußballs als gesellschaftliches Phänomen dar. Sie betont die scheinbare Unpolitisch des Fußballs und führt gleichzeitig aus, wie er durch äußere Einflüsse politisch instrumentalisiert werden kann. Es wird ein Spannungsfeld zwischen dem Fußball als eigenständigem Sport und seiner Beeinflussung durch politische Machtstrukturen aufgezeigt, das den roten Faden der gesamten Arbeit bildet.
Fußball - Mehr als nur eine Sportart: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Fußballs von seinen Anfängen in Deutschland bis zu seinem Aufstieg zum Massenphänomen. Es skizziert die sozialen und kulturellen Faktoren, die zu diesem Wachstum beitrugen, und legt den Grundstein für die spätere Analyse der Rolle des Fußballs unter nationalsozialistischer Herrschaft. Die Entwicklung des Fußballs wird als ein wichtiger Kontextualisierungsschritt für das Verständnis seiner späteren Politisierung dargestellt.
Nationalsozialismus in Deutschland und seine gesellschaftlichen Folgen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Nationalsozialismus und dessen weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen. Es beleuchtet die gesellschaftliche Entwicklung von Ende des Ersten Weltkriegs bis 1933 und erklärt die Gesellschaftsprogrammatik des Nationalsozialismus, inklusive der zentralen Konzepte der Gleichschaltung und des Führerprinzips. Diese Darstellung dient als Grundlage für das Verständnis der Eingriffe des NS-Regimes in den Fußball.
Der DFB im NS-Regime - Zwischen Gefolgschaft, Angepasstheit und Insubordination: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Anpassungsstrategien des DFB an das NS-Regime. Es untersucht die einzelnen Phasen der Gleichschaltung des deutschen Fußballs, die Rolle von Schlüsselfiguren wie Otto Nerz und Sepp Herberger, und die Auswirkungen der Olympischen Spiele 1936 auf den DFB. Der Fokus liegt auf dem komplexen Wechselspiel zwischen Opportunismus, Widerstand und der schrittweisen Unterwerfung des DFB unter die NS-Ideologie. Der Exkurs "Fußball und Krieg" zeigt die Auswirkungen des Krieges auf den Fußball und die moralische Ambivalenz dieser Zeit.
Schlüsselwörter
Gleichschaltung, Führerprinzip, Deutscher Fußball-Bund (DFB), Nationalsozialismus, Sportpolitik, Propaganda, Olympische Spiele 1936, Otto Nerz, Sepp Herberger, Widerstand, Anpassung, Fußball im Dritten Reich, Militarismus, Nationalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Der DFB im NS-Regime"
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Rolle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) während der NS-Zeit (1933-1945). Sie analysiert die Anpassungsstrategien des DFB an das nationalsozialistische Regime, Strategien des Widerstands, und die Folgen dieser Entwicklungen für den deutschen Fußball. Die Arbeit beleuchtet das komplexe Verhältnis zwischen Sport, Politik und Ideologie im nationalsozialistischen Deutschland.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gleichschaltung des deutschen Fußballs, die Auswirkungen des Führerprinzips auf den DFB, die Rolle des DFB bei der nationalsozialistischen Propaganda, den Einfluss des Sports auf die gesellschaftliche Entwicklung im Dritten Reich und den Konflikt zwischen Sport und Politik unter der NS-Herrschaft. Sie betrachtet auch die Entwicklung des Fußballs von seinen Anfängen bis zum Massenphänomen und den Einfluss des Krieges auf den Fußball.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Fußball - Mehr als nur eine Sportart, Nationalsozialismus in Deutschland und seine gesellschaftlichen Folgen, Der DFB im NS-Regime - Zwischen Gefolgschaft, Angepasstheit und Insubordination (inkl. Exkurs: Fußball und Krieg), und Zusammenfassung. Jedes Kapitel analysiert einen spezifischen Aspekt der Beziehung zwischen dem DFB und dem NS-Regime.
Welche Schlüsselfiguren werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Rolle wichtiger Persönlichkeiten wie Otto Nerz und Sepp Herberger und deren Einfluss auf den DFB während der NS-Zeit. Ihre Entscheidungen und Handlungen im Kontext der Gleichschaltung und der politischen Entwicklung werden detailliert untersucht.
Welche zentralen Konzepte werden in der Arbeit diskutiert?
Zentrale Konzepte sind die Gleichschaltung, das Führerprinzip, die Propaganda, die Anpassungsstrategien des DFB, der Widerstand (wenn vorhanden), und die Instrumentalisierung des Sports durch das NS-Regime. Diese Konzepte werden im Kontext der Entwicklung des deutschen Fußballs und der gesellschaftlichen Verhältnisse des Dritten Reichs analysiert.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
(Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da die verwendeten Quellen im gegebenen HTML-Code nicht aufgeführt sind.)
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da die Schlussfolgerungen der Arbeit im gegebenen HTML-Code nicht explizit genannt sind. Die Zusammenfassung der Kapitel liefert jedoch Hinweise auf die Argumentationslinie.)
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Historiker, Sportwissenschaftler und alle, die sich für die Geschichte des Fußballs, die Geschichte des Nationalsozialismus und die Interaktion von Sport und Politik interessieren. Sie bietet einen tiefgehenden Einblick in die komplexe Geschichte des DFB während einer dunklen Epoche der deutschen Geschichte.
Wie kann ich die vollständige Arbeit einsehen?
(Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da der Zugriff auf die vollständige Arbeit nicht im gegebenen HTML-Code angegeben ist.)
Details
- Titel
- Gleichschaltung und Führerprinzip - Zur Rolle des DFB in der Zeit des Nationalsozialismus in der Zeit von 1933-1945
- Hochschule
- Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Brühl - Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung
- Note
- Sehr gut
- Autor
- Marco Blume (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 146
- Katalognummer
- V161020
- ISBN (eBook)
- 9783640750269
- ISBN (Buch)
- 9783640750320
- Dateigröße
- 879 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Gleichschaltung Führerprinzip Rolle Zeit Nationalsozialismus Zeit Sehr
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Marco Blume (Autor:in), 2006, Gleichschaltung und Führerprinzip - Zur Rolle des DFB in der Zeit des Nationalsozialismus in der Zeit von 1933-1945, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/161020
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-