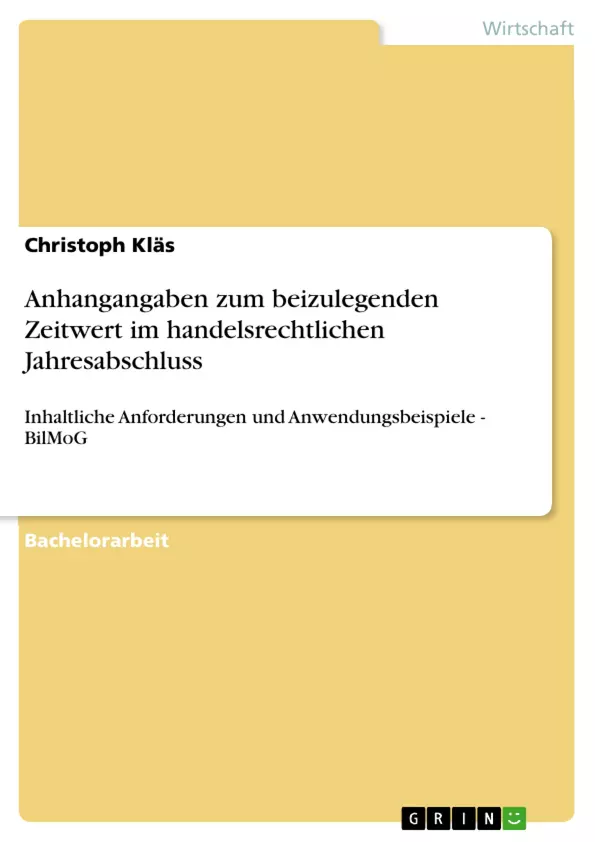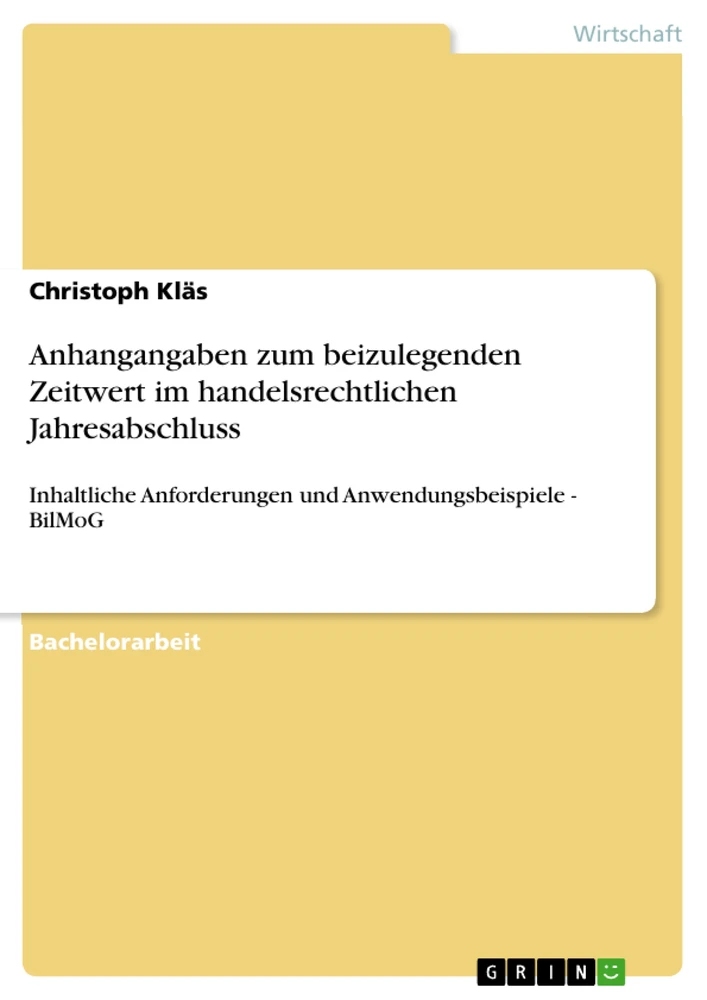
Anhangangaben zum beizulegenden Zeitwert im handelsrechtlichen Jahresabschluss
Bachelorarbeit, 2010
40 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung des Themas
- Begriffsbestimmungen
- Beizulegender Zeitwert
- Erste Stufe
- Zweite Stufe
- Dritte Stufe
- Angaben im Anhang
- Beizulegender Zeitwert
- Pflichtangaben im Anhang
- Finanzanlagen
- Definition der Finanzinstrumente
- Unterbleiben einer außerplanmäßigen Abschreibung
- Derivative Finanzinstrumente
- Definition der Derivate
- Kategorien
- Art und Umfang
- Angabe des beizulegenden Zeitwerts
- Buchwert und Bilanzposten
- Finanzinstrumente des Handelsbestands
- Definition des Handelsbestands
- Verwendung einer allgemein anerkannten Bewertungsmethode
- Risikoangaben
- weitere Angaben nach RechKredV
- Risikoabschlag
- Umgliederung von Finanzinstrumenten
- institutsinterne Kriterienänderung
- Verrechnung von Vermögensgegenständen
- Anteile oder Anlageaktien an Investmentvermögen
- Sanktionen
- Finanzanlagen
- Anwendungsbeispiele
- Finanzanlagen
- Derivative Finanzinstrumente
- Finanzinstrumente des Handelsbestands
- Verrechnung von Vermögensgegenständen
- Definition und Abgrenzung verschiedener Finanzinstrumente
- Bewertung und Darstellung von Finanzinstrumenten im Anhang
- Anforderungen der RechKredV an die Angabe von Risiken
- Sanktionen bei Nichteinhaltung der Rechnungslegungsvorschriften
- Praktische Anwendungsbeispiele zur Veranschaulichung der Vorschriften
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Gegenstand des Textes vor und definiert wichtige Begriffe im Kontext der Finanzinstrumente. Dabei wird besonders auf den beizulegenden Zeitwert und die Anforderungen der RechKredV eingegangen.
- Pflichtangaben im Anhang: Dieses Kapitel befasst sich mit den Pflichtangaben im Anhang für verschiedene Arten von Finanzinstrumenten, darunter Finanzanlagen, derivative Finanzinstrumente und Finanzinstrumente des Handelsbestands. Es werden die Definitionen, Bewertungsmethoden und Risikodarstellungen erläutert.
- Anwendungsbeispiele: Dieses Kapitel bietet konkrete Beispiele zur Veranschaulichung der im vorherigen Kapitel dargestellten Vorschriften. Es zeigt, wie die Anforderungen der RechKredV in der Praxis angewendet werden können.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit den Pflichtangaben im Anhang gemäß der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV). Ziel ist es, die Vorschriften zur Rechnungslegung für Finanzinstrumente und verwandte Themen verständlich zu erklären und anhand von Anwendungsbeispielen zu verdeutlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Finanzinstrumente, Rechnungslegung, Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV), Anhang, beizulegender Zeitwert, Bewertung, Risiken, Derivate, Handelsbestand, Sanktionen. Der Text beleuchtet die Vorschriften zur Rechnungslegung für Finanzinstrumente und zeigt anhand von Anwendungsbeispielen, wie diese in der Praxis anzuwenden sind.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der beizulegende Zeitwert (Fair Value)?
Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswert zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte.
Welche Rolle spielt das BilMoG für die Zeitwertbewertung?
Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurde die Zeitwertbewertung im deutschen Handelsrecht (HGB) eingeführt, primär für Handelsbestände von Kreditinstituten und zur Verrechnung von Altersvorsorgevermögen.
Welche Angaben müssen im Anhang zu Finanzanlagen gemacht werden?
Es müssen Angaben gemacht werden, wenn Finanzanlagen über ihrem beizulegenden Zeitwert bilanziert werden, insbesondere warum eine außerplanmäßige Abschreibung unterblieben ist.
Was sind derivative Finanzinstrumente im Kontext des Anhangs?
Für Derivate müssen im Anhang Angaben zu Art, Umfang, Buchwert und dem beizulegenden Zeitwert gemacht werden, sofern sie nicht zum Fair Value in der Bilanz stehen.
Warum ist die Zeitwertbewertung kritisch zu sehen?
Kritiker sehen in ihr einen Mitverursacher von Wirtschaftskrisen, da sie prozyklisch wirken kann und bei illiquiden Märkten die Ermittlung eines objektiven Wertes schwierig ist.
Welche Stufen der Wertermittlung gibt es?
Die Wertermittlung erfolgt in drei Stufen: 1. Marktpreis auf aktiven Märkten, 2. Bewertung anhand vergleichbarer Markttransaktionen, 3. Anwendung anerkannter Bewertungsmethoden (z. B. DCF-Modell).
Details
- Titel
- Anhangangaben zum beizulegenden Zeitwert im handelsrechtlichen Jahresabschluss
- Untertitel
- Inhaltliche Anforderungen und Anwendungsbeispiele - BilMoG
- Hochschule
- Hochschule Koblenz (ehem. FH Koblenz)
- Note
- 1,3
- Autor
- Christoph Kläs (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 40
- Katalognummer
- V161695
- ISBN (eBook)
- 9783640758500
- ISBN (Buch)
- 9783640758623
- Dateigröße
- 534 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- BilMoG BilReG handelsrechtlicher Jahresabschluss IFRS Finanzinstrumente beizulegender Zeitwert Zeitwert Bilanzierung Rechnungslegung Bilanzmodernisierungsgesetz Anhangangaben Handelsbestand Fair Value Bewertung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Christoph Kläs (Autor:in), 2010, Anhangangaben zum beizulegenden Zeitwert im handelsrechtlichen Jahresabschluss, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/161695
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-