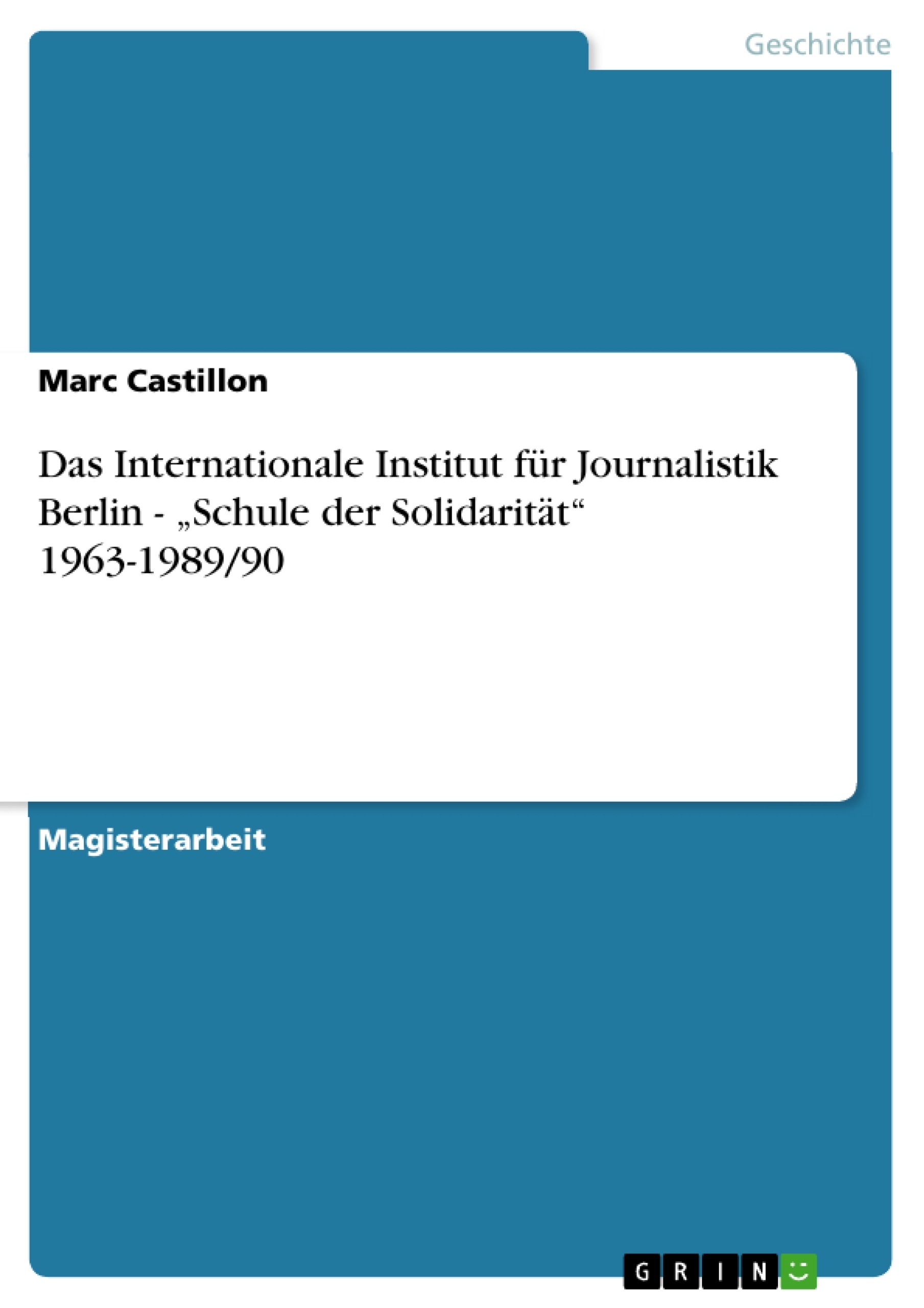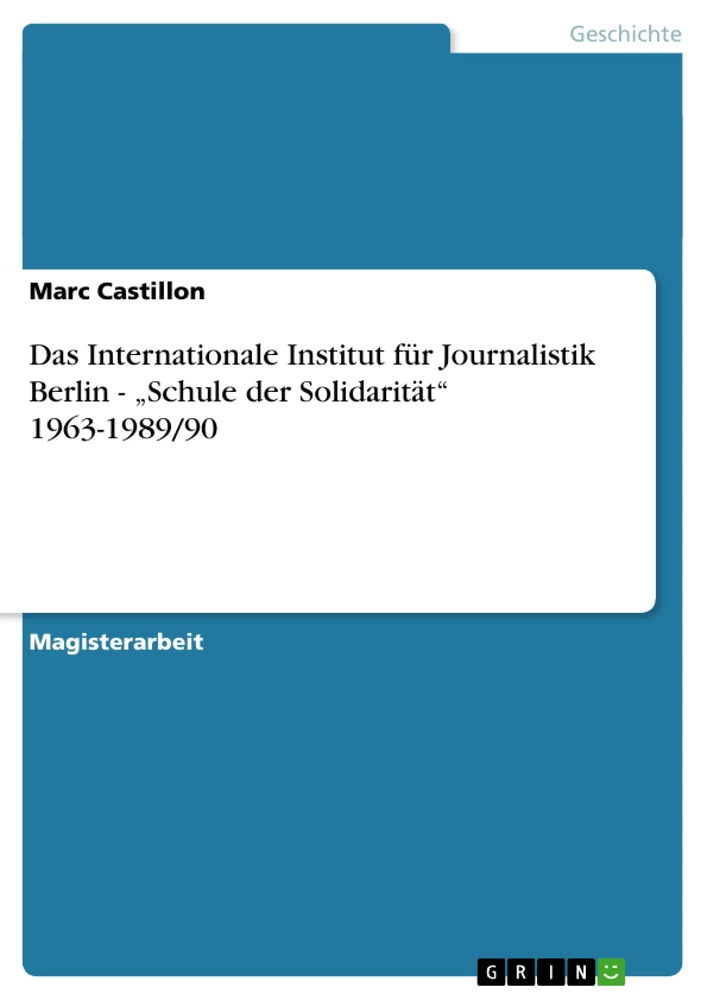
Das Internationale Institut für Journalistik Berlin - „Schule der Solidarität“ 1963-1989/90
Magisterarbeit, 2010
99 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung.
- B. Der Verband der Journalisten der DDR
- C. Das Internationale Institut für Journalistik Berlin 1963 bis 1989
- I. Ausbildungshilfe im Vorfeld der Gründung der „Schule der Solidarität“
- II. Die Institutionalisierung der Ausbildungshilfe durch die Gründung der ,,Schule der Solidarität“ im Oktober 1963..
- a) Gründung der „Schule der Solidarität“.
- b) Der erste Lehrgang an der „Schule der Solidarität“
- c) Inhaltliche Zielstellung, Satzung und Arbeitsweise der „Schule der Solidarität“.
- III. Die formelle Umwandlung der „Schule der Solidarität“ in das Internationale Institut für Journalistik Berlin.
- a) Umwandlung in das Internationale Institut für Journalistik Berlin ……………………….
- b) Erweiterung und Umstrukturierung des Internationalen Instituts für Journalistik Berlin
- 1. Abteilung Ausbildung im Inland: „Schule der Solidarität“.
- 2. Abteilung Ausbildung im Ausland ........
- 3. Die Abteilungen Dokumentation und Information sowie Verwaltung und Finanzen.…………………
- 4. Die Struktur des IIJB innerhalb des VDJ .
- c) Der Ausbau der „Schule der Solidarität“.
- IV. Das IIJB in der Wendezeit..
- V. Ausbildungsformen und -inhalte am IIJB
- VI. Lehrgangsteilnehmer
- a) Bildungsvoraussetzungen der Lehrgangsteilnehmer .
- b) Einladungspolitik und Herkunftsländer der Studenten.......
- c) Die Betreuung und Versorgung der Studenten in der DDR
- d) Die Kontaktpflege der „Schule der Solidarität“ mit ihren Absolventen..
- VII. Die Finanzierung des IIJB.
- VIII. Das IIJB und die Zusammenarbeit mit internationalen Vereinigungen
- IX. Das IIJB und die Zusammenarbeit mit nationalen Medieninstitutionen.
- X. Das IIJB und die Beziehungen zu ausländischen Ausbildungseinrichtungen...
- a) Bildungseinrichtungen im sozialistischen Ausland und in den Entwicklungsländern .
- b) Das Internationale Institut für Journalismus in West-Berlin..
- IXI. Die Funktionen des IIJB.
- a) Die,,Schule der Solidarität“ als Manifestation der Solidaritätsarbeit .......
- b) Das IIJB als Form der Entwicklungszusammenarbeit und Fortsetzung außenpolitischer Ziele......
- D. Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Geschichte des Internationalen Instituts für Journalistik Berlin (IIJB), das in der DDR als „Schule der Solidarität“ gegründet wurde. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und die Strukturen des IIJB, wobei der Fokus auf die Ausbildung von Journalisten aus Entwicklungsländern liegt.
- Die Rolle der Medien im Kalten Krieg
- Die Bedeutung der journalistischen Ausbildungshilfe in der DDR
- Die Gründung und Entwicklung der „Schule der Solidarität“
- Die Transformation der „Schule der Solidarität“ zum IIJB
- Die Zusammenarbeit des IIJB mit internationalen und nationalen Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel skizziert den Kontext der Arbeit und die Bedeutung der Medien im Kalten Krieg sowie die Rolle der DDR bei der Ausbildung von Fachkräften aus Entwicklungsländern.
- Der Verband der Journalisten der DDR: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Verband der Journalisten der DDR (VDJ) und seine Rolle im politischen System.
- Das Internationale Institut für Journalistik Berlin 1963 bis 1989: Dieses Kapitel erzählt die Geschichte des IIJB, von seinen Anfängen als „Schule der Solidarität“ bis zu seiner Umwandlung zum IIJB. Es werden die wichtigsten Meilensteine, die Struktur, die Ausbildungsformen und die Finanzierung des Instituts behandelt.
- Ausbildungsformen und -inhalte am IIJB: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Ausbildungsformen und -inhalte, die am IIJB angeboten wurden.
- Lehrgangsteilnehmer: Dieses Kapitel widmet sich den Teilnehmern der Lehrgänge, beleuchtet ihre Bildungsvoraussetzungen, ihre Herkunftsländer und die Betreuung während ihres Aufenthalts in der DDR.
- Das IIJB und die Zusammenarbeit mit internationalen Vereinigungen: Dieses Kapitel analysiert die Zusammenarbeit des IIJB mit internationalen und nationalen Einrichtungen.
- Die Funktionen des IIJB: Dieses Kapitel untersucht die Funktionen des IIJB als Manifestation der Solidaritätsarbeit und als Form der Entwicklungszusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Internationale Journalistik, Journalismus in der DDR, „Schule der Solidarität“, Internationales Institut für Journalistik Berlin (IIJB), Ausbildungshilfe, Entwicklungsländer, Medien im Kalten Krieg, Propaganda, Entwicklungszusammenarbeit.
Details
- Titel
- Das Internationale Institut für Journalistik Berlin - „Schule der Solidarität“ 1963-1989/90
- Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Geschichtswissenschaften)
- Note
- 1,0
- Autor
- Marc Castillon (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 99
- Katalognummer
- V163168
- ISBN (eBook)
- 9783640780068
- ISBN (Buch)
- 9783640780464
- Dateigröße
- 878 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Schule der Solidarität IIJB Internationales Institut für Journalistik Berlin VDJ VDP Hans Treffkorn IOJ Rüdiger Claus Sonja Brie Klaus Vieweg Schule der Freundschaft Verband der Journalisten der DDR Verband der Deutschen Presse Afrikanischer Rat für Kommunikationserziehung Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst Internationale Vereinigung für die Erforschung der Massenkommunikation Konföderation der ASEAN-Journalisten Deutscher Journalistenverband Föderation der Arabischen Journalisten Lateinamerikanische Föderation der Journalisten Internationales Institut für Journalismus Berlin Internationale Organisation der Journalisten Internationales Programm für die Entwicklung der Kommunikation Radio Berlin International Sozialistische Einheitspartei Deutschland Sender Freies Berlin Union der Afrikanischen Journalisten Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung Wissenschaft und Kultur Organisation der Vereinten Nationen Weltverband für christliche Kommunikation WACC UNO UNESCO TASS Tanjug SFB PAP IPDC FELAP FAJ DJV ČTK CAJ AIERI/IAMCR ADN ACCE Ausbildung im Inland Ausbildung im Ausland Internationale Solidaritätslotterie Julia Martin Internationales Institut für Journalistik Berlin Brandenburg e.V. Abteilung Agitation beim ZK der SED Solidaritätskomitee der DDR Staatliches Komitee für Rundfunk Staatliches Komitee für Fernsehen Journalistenverband Minholz Stirnberg von Löwis of Menar Solidarität Werner Lamberz Internationales Institut für Journalistik (Berliner Stiftung) – Journalistisches Bildungswerk Dritte Welt e.V. Journalismus Dritte Welt
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Marc Castillon (Autor:in), 2010, Das Internationale Institut für Journalistik Berlin - „Schule der Solidarität“ 1963-1989/90, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/163168
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-