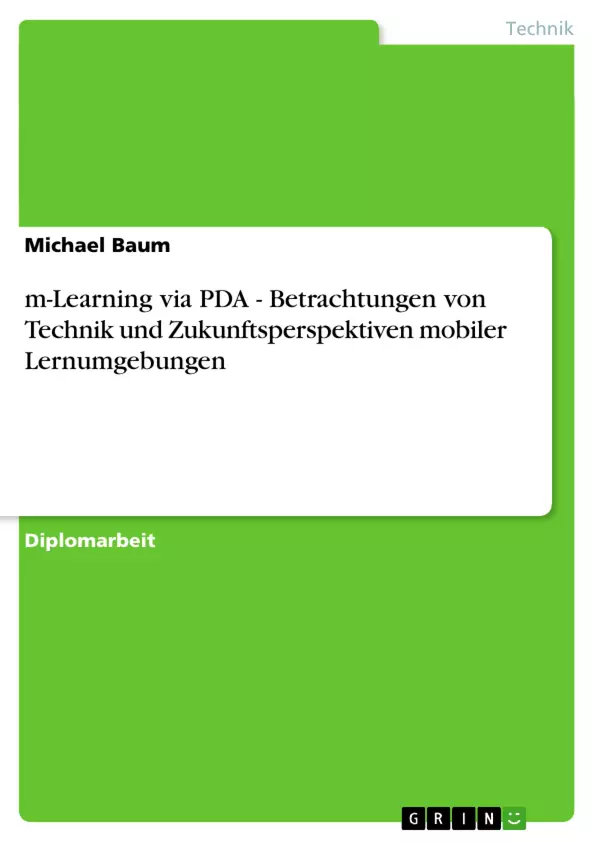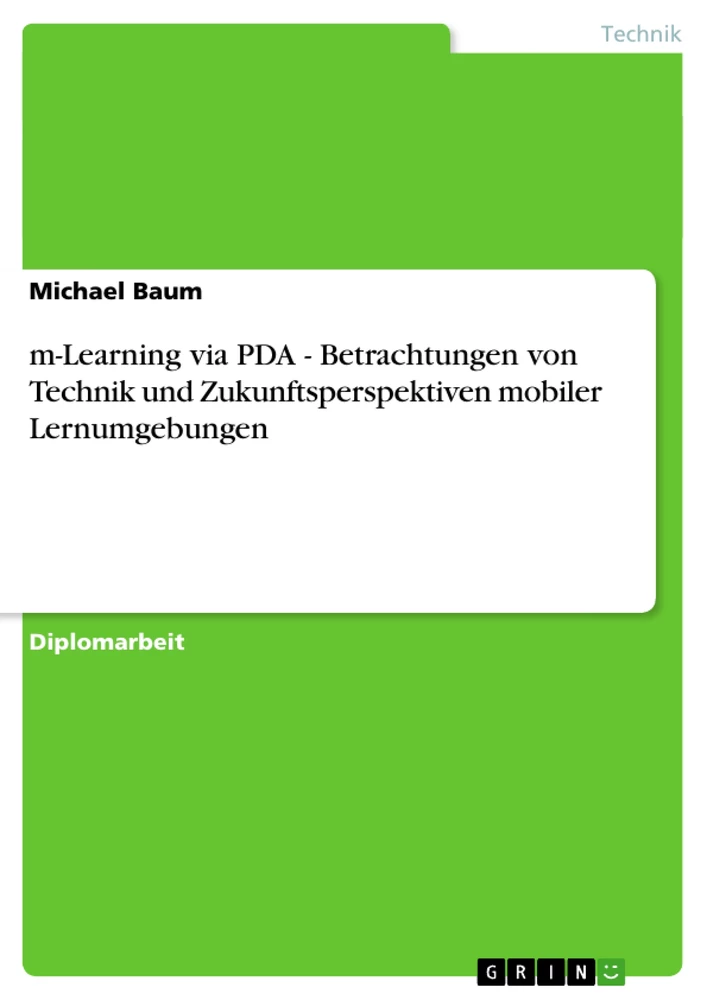
m-Learning via PDA - Betrachtungen von Technik und Zukunftsperspektiven mobiler Lernumgebungen
Diplomarbeit, 2002
84 Seiten, Note: 1,2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Gliederung
- Grundlagen
- Computergestützte Lernumgebungen
- Begriffliche Grundlagen
- Historischer Überblick
- Grundlagen der Didaktik
- Formen computergestützten Lernens
- Präsentation
- Motivation
- Ablaufsteuerung
- Interaktion
- Mobile Endgeräte
- Klassifizierung
- Intention
- Betriebssysteme
- PDA-Typenauswahl
- Datenaustausch
- Schnittstellen
- Kommunikation
- Speicher
- Display
- Funktionen und Einsatzgebiete
- Benutzerschnittstellen
- Mobiles Lernen
- e-Learning vs. m-Learning
- Zielgruppenbetrachtung
- Der typische Nutzer
- Definition der Zielgruppe
- Zielgruppenmerkmale
- Akzeptanz
- Wirtschaftlichkeit
- Mögliche Einsatzbereiche
- Technische Umsetzung
- Design Philosophie
- Dateiformate
- Bildschirmaufbau
- Schwerpunkte der Programmierung
- Programmbeschreibung
- Quellmedien
- Gestaltung der Benutzerschnittstellen
- Grenzen
- Programmaufbau
- Grafische Barrieren
- Speichergrenzen
- Energie-Ressourcen
- Beispiele mobiler Lernumgebungen
- MeduMobile
- pocket-WI
- Smartforce
- Fernuniversität Hagen
- Technische Aspekte von PDAs und deren Eignung für m-Learning
- Didaktische Grundlagen und deren Anwendung im Kontext mobiler Lernumgebungen
- Zielgruppenanalyse und deren spezifische Bedürfnisse im m-Learning
- Praktische Beispiele und Anwendungsbeispiele für m-Learning mit PDAs
- Zukunftsperspektiven und Herausforderungen für den Einsatz von PDAs im m-Learning
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Diplomarbeit dar und gibt einen Überblick über die Gliederung des Textes.
- Grundlagen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen des computergestützten Lernens und der Besonderheiten mobiler Endgeräte. Es werden die Definitionen von Lernumgebungen, der historische Überblick und die didaktischen Prinzipien erläutert. Zudem werden verschiedene Formen des computergestützten Lernens vorgestellt, sowie die Bedeutung von Motivation, Ablaufsteuerung und Interaktion im Lernprozess beleuchtet.
- Mobiles Lernen: Das Kapitel beleuchtet die Unterschiede zwischen e-Learning und m-Learning, analysiert die Zielgruppen und deren Bedürfnisse. Es werden die möglichen Einsatzbereiche des m-Learnings erörtert und die technischen Aspekte der Umsetzung eines m-Learning-Konzepts auf Basis von PDAs betrachtet. Die Gestaltung von Benutzerschnittstellen und die technischen Grenzen des m-Learnings werden ebenfalls diskutiert.
- Beispiele mobiler Lernumgebungen: Hier werden konkrete Beispiele für m-Learning-Anwendungen mit PDAs vorgestellt und analysiert. Die verschiedenen Ansätze und Design-Konzepte der Anwendungen werden erläutert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Einsatz von Personal Digital Assistants (PDAs) im Bereich des m-Learnings. Sie analysiert die technischen Voraussetzungen und die Zukunftsperspektiven für die Verwendung von PDAs als Lernplattform. Die Arbeit beleuchtet die Vorteile und Herausforderungen des m-Learnings im Vergleich zum traditionellen e-Learning.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
m-Learning, PDA, mobile Lernumgebungen, e-Learning, Didaktik, Benutzerschnittstelle, Zielgruppe, Einsatzbereiche, technische Umsetzung, Grenzen, Beispiele, Zukunftsperspektiven, Trends.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter m-Learning via PDA?
m-Learning via PDA bezeichnet das Lernen mit Hilfe von Personal Digital Assistants. Es nutzt die Mobilität dieser Geräte, um Lernumgebungen unabhängig von festen Orten und Zeiten bereitzustellen.
Wie unterscheidet sich m-Learning von klassischem e-Learning?
Während e-Learning allgemein computergestütztes Lernen umfasst, fokussiert sich m-Learning auf die Nutzung mobiler Endgeräte, was spezifische Anforderungen an das Design, die Technik und die Didaktik stellt.
Welche technischen Grenzen gibt es beim Lernen mit PDAs?
Zu den Grenzen gehören unter anderem die Bildschirmgröße (grafische Barrieren), begrenzte Speicherkapazitäten, die Leistungsfähigkeit der Prozessoren und die begrenzten Energieressourcen (Akkulaufzeit).
Welche didaktischen Anforderungen sind für mobile Lernumgebungen wichtig?
Wichtige Aspekte sind die Motivationsgestaltung, eine klare Ablaufsteuerung, Interaktionsmöglichkeiten und die ergonomische Gestaltung der Benutzerschnittstelle für kleine Displays.
Welche Praxisbeispiele für m-Learning werden genannt?
In der Arbeit werden Anwendungen wie MeduMobile, pocket-WI, Smartforce und Projekte der Fernuniversität Hagen als Beispiele für mobile Lernumgebungen analysiert.
Details
- Titel
- m-Learning via PDA - Betrachtungen von Technik und Zukunftsperspektiven mobiler Lernumgebungen
- Hochschule
- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
- Note
- 1,2
- Autor
- Michael Baum (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2002
- Seiten
- 84
- Katalognummer
- V16393
- ISBN (eBook)
- 9783638212588
- Dateigröße
- 1842 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Betrachtungen Technik Zukunftsperspektiven Lernumgebungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Michael Baum (Autor:in), 2002, m-Learning via PDA - Betrachtungen von Technik und Zukunftsperspektiven mobiler Lernumgebungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/16393
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-