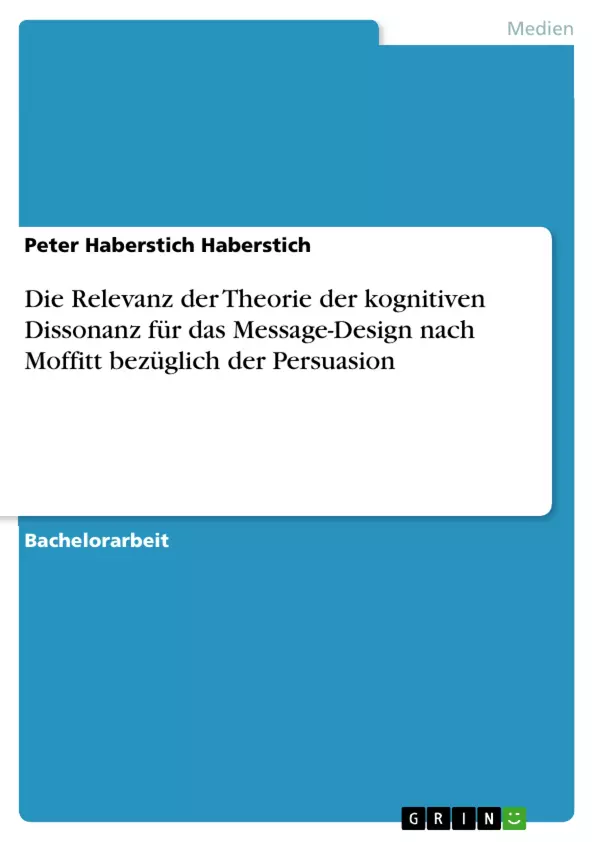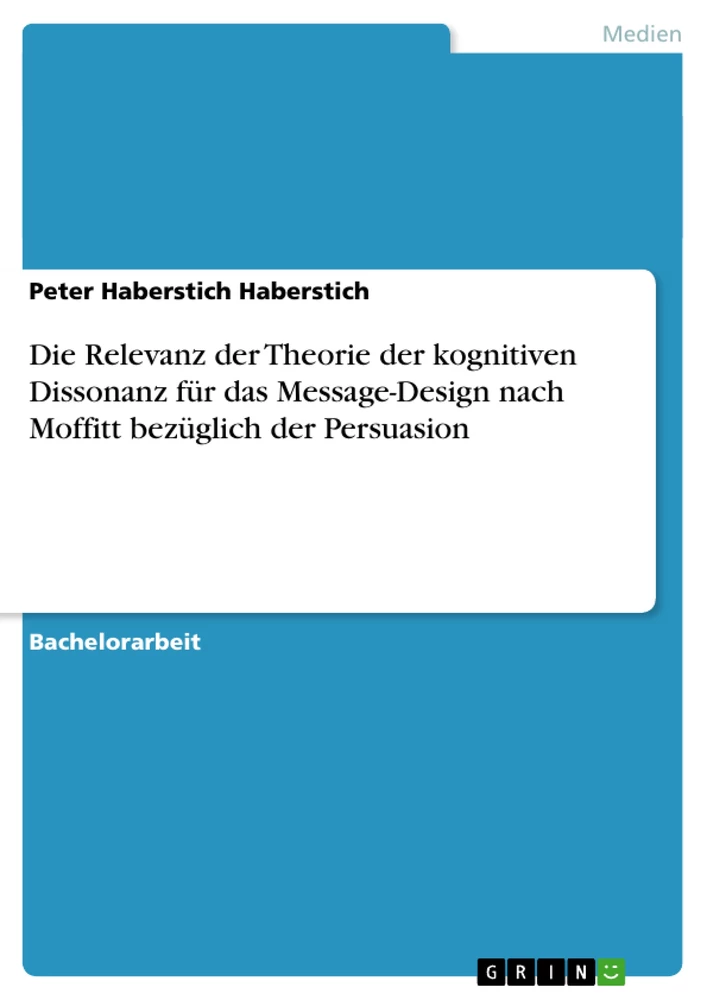
Die Relevanz der Theorie der kognitiven Dissonanz für das Message-Design nach Moffitt bezüglich der Persuasion
Bachelorarbeit, 2010
33 Seiten, Note: 1.5
Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis/Gliederung
1. Einleitung
1.1 Analysegegenstand und Zielsetzung
1.2 Relevanz des Forschungsbeitrags
2. Methode
3. Theoretische Grundlagen
3.1 Message Design
3.2 Persuasion - Persuasive Kommunikation
3.3 Die Theorie der kognitiven Dissonanz
3.4 Abschliessende Definition des Analysegegenstandes
4. Ergebnisse
4.1 Vorbemerkung zu Gültigkeit und Übertragbarkeit
4.2 Die der kognitiven Dissonanz bei Moffitt zugeschriebene Funktion
4.3 Einflüsse von kognitiven-Dissonanz-Prozessen auf die Persuasionsfunktion von Kampagnen-Messages und deren Anwendung im Verfahren von Mary Anne Moffitt
5. Fazit
6. Literaturangaben
7. Anhang
7.1 Elaboration Likelyhood Modell (ELM)
7.2 Kategoriensystem für die Analyse des Korpus über kognitive Dissonanz
7.3 Dilbert und kognitive Dissonanz
1. Einleitung
Am Anfang dieser Arbeit stand das Bedürfnis, die Wirkung von Kommunikationsbeiträgen auf die Rezipienten zu verstehen und Voraussagen dazu machen zu können. Und es stand da auch die vage Vermutung in Raum, dass im Feld der Sozialpsychologie Hinweise dazu zu finden sein könnten; dass es Gesetzmässigkeiten gäbe, die in der menschlichen Natur begründet sind, und nach denen entschieden werden könne, wie Kommunikationsbeiträge gestaltet sein müssten, dass sie die gewünschte Wirkung erzielen; und dass es dazu wis- senschaftliche Zugänge gäbe, die über die Best-Practice-Sammlung von Aristotele’s Rheto- rik (vgl. Courtright / Smudde o.J: 1) hinausgingen. Es folgte ein intensive Auseinanderset- zung mit sozialpsychologischen Theorien und die Bestätigung dieser Vermutungen - aber auch die Erkenntnis, dass dieses Feld so breit ist, dass eine Arbeit dazu im gegebenen Um- fang höchstens eine Auflistung von relevanten Theorien leisten könnte. Deshalb wurde der Forschungsgegenstand laufend eingeschränkt. Aus der Menge der sozialpsychologischen Theorien fielen immer mehr weg, bis schliesslich „nur“ noch die der kognitiven Dissonanz übrig blieb. Aus dem Interesse für Kommunikationsbeiträge im Allgemeinen kristallisierte sich das Interesse für „Message Design“ im Allgemeinen heraus, und schliesslich eine Ent- scheidung für das Verfahren von Mary Anne Moffitt.
1.1 Analysegegenstand und Zielsetzung
In dieser Arbeit möchte ich das aktuelle Wissen um die Entstehung und die Reduktion von kognitiver Dissonanz vertieft daraufhin untersuchen, ob, und wenn ja, welche Vorhersagen damit bezüglich der Persuasivität von Kommunikationsbeiträgen im Sinne Moffitt’s, gemacht werden können. Die Resultate sollen für das Message-Design-Verfahren nach Moffitt an- schlussfähig gemacht werden, um schliesslich für den Berufspraktiker, der nach diesem Verfahren vorgeht, konkrete handlungsleitende Strategien abzuleiten, mit denen die Persua- sivität von Messages gesteuert werden kann. Die in Moffitt's Verfahren der Theorie der ko- gnitiven Dissonanz zugeschriebene Funktion wird dazu vorher analysiert und überprüft. For- schungsleitende Fragen sind demnach:
Welche Kommunikationswirkungen erklärt Moffitt mit der Theorie der kognitiven Dissonanz? Welche weiteren Effekte bezüglich der Persuasivität von Mitteilungen können mit der Theorie der kognitiven Dissonanz (im Weiteren auch "TdkD") und den darauf gründenden aktuellen Forschungsergebnissen erklärt und vorausgesagt werden?
Wie und an welchen Prozessschritten kann der Berufspraktiker, der mit dem Moffitt’schen Verfahren vorgeht, diese Effekte steuern?
1.2 Relevanz des Forschungsbeitrags
Aus berufspraktischer Perspektive liegt die Relevanz der Arbeit darin, dass danach Praktiker, die nach dem Message-Design-Verfahren von Moffitt oder ähnlichen Verfahren arbeiten, die theoretischen und empirischen Aussagen über das allfällige persuasive Potential kognitiver Dissonanz berücksichtigen können und dadurch Botschaften derart gestalten können, dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Persuasivität höher ist.
Aus wissenschaftlicher Perspektive liegt die Relevanz darin, dass die Funktion, welche Moffitt der Theorie der kognitiven Dissonanz in ihrem Verfahren zuweist, kritisch hinterfragt wird und ihr gegebenenfalls eine erweiterte Bedeutung zugewiesen werden kann.
2. Methode
Die Resultate dieser Arbeit beruhen auf Korpora zu den Themen Message-Design, Persua- sion und Kognitive Dissonanz. Diese wurden interpretiert und analysiert, damit deren inter- essierenden Merkmalsausprägungen schliesslich zueinander in Verbindung gesetzt werden konnten. Weil somit] auch die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit mit den im folgenden dargestellten Methoden entwickelt wurden, wird der Methodenteil in dieser Arbeit dem Theo- rieteil vorgezogen.
Die Methodik orientierte sich in erster Linie an den wissenschaftlichen Prämissen der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, der Reliabiliät und der Validität. Diesen wurde versucht gerecht zu werden, indem die Methodik offen gelegt, zu den Quellen verwiesen, und Erörterungen und Folgerungen nachvollziehbar dargestellt wurden.
Zum Einsatz kamen verschiedene Basismethoden des Verstehens: Hermeneutik, Ver- gleichsverfahren, Typenbildung (vgl. Wagner 2009: 101ff.), sowie Grundformen der qualitati- ven Technik, wie die explorativ, und zur Kategorienbildung angewendete (inhaltsanalytische) Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (vgl. Mayring 2003: 56ff.; Wagner 2009: 337ff.). Dabei liess ich mich im Besonderen vom Prinzip der Offenheit (vgl. Mayring 2002: 27f.) und der Problemorientierung (vgl. ebd.: 34) leiten und folgte einer Suchbewegung, die mir in einer hermeneutischen Spirale (vgl. ebd.: 29f) „im ständigen Wechsel von Entwurf und Kenntnisnahme“ (Wagner 2009: 177) eine „sukzessive Annäherung an das fremde Sinnge- bilde“ (ebd.:182) ermöglichte.
Um das Message-Design-Verfahren von Moffitt zu verstehen und derart darstellen zu kön- nen, dass die Resultate, die aus der Analyse der Literatur zur kognitiven Dissonanz hervor- gingen dazu anschlussfähig sind, wurde eine hermeneutische Textinterpretation (vgl. Früh 2004: 48ff.) durchgeführt. Dabei wurde eine ausführliche (Moffitt 1999) sowie eine aktuelle- re, aber kürzere Darstellung (Moffitt 2004) ihres Verfahrensvorschlags interpretiert. Eine historische Gegenstandsauffassung (vgl. Mayring 2002: 34) und viel guter Wille (vgl. Danner 1979: 89f. in Mayring 2003: 28) half dabei, mit begrifflichen und verfahrenstechnischen Inkonsistenzen in Moffitt’s Texten umzugehen. Begriffsdefinitionen, sowie der Verfahrensablauf wurden mit einer typisierenden Strukturierung (vgl. Mayring 2003: 90) erkundet. Ähnlich wurde für das Verstehen und Darstellen der Basistheorien vorgegangen.
Für die Analyse und Typisierung des persuasiven Potentials, das aus den Prozessen der Entstehung, Vermeidung und Reduktion von kognitiver Dissonanz hervorgeht, wurden Zu- sammenfassungen der Theorieentwicklung und von Forschungsresultaten herangezogen.
Da die ersten Theorien und empirischen Befunde über kognitive Dissonanz über 50 Jahre alt sind und eine vielfältige Weiterentwicklung erfuhren, war es m. E. nicht notwendig, diese im Original heranzuziehen. Ich ging von den Darstellungen in Harmon-Jones (2002) sowie O’Keefe (2002) aus und zog zur Exploration und Explikation Texte von Frey (2001) und Cooper (2007) heran. Es handelt sich dabei um viel referenzierte Forscher auf dem Gebiet der Sozialpsychologie mit zum Teil jeweils eigenen Interpretationen der Theorie der kogniti- ven Dissonanz (Harmon-Jones, Cooper). Dadurch sah ich mich veranlasst, die Zuverlässig- keit der theoretischen Darstellungen und der referenzierten empirischen Befunde aus for- schungspraktischen Gründen für gegeben anzusehen, sofern sie sich im Vergleich innerhalb des Korpus’ als konsistent erwiesen. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Resultate mei- ner Arbeit eine gewisse Generalisierbarkeit erlauben.
Da das Analyse-Interesse in erster Linie darin lag, explorativ (vgl. Früh 2004: 76) Komplexität zu reduzieren (vgl. ebd.: 42), das Material zu strukturieren und einzelne Aussagen vergleichbar zu machen, ging ich mit den Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. ebd.: 52ff.; Wagner 2009: 33ff.) an den Korpus heran. Ein erstes, deduktiv erarbeitetes (vgl. Wagner 2009: 338; Früh 2004: 72ff.; 77) Kategoriensystem, das auf der Originaltheorie von Festinger beruhte, sollte helfen, einzelne Phänomene zu isolieren. Das System wurde dann induktiv und mit hypothesengeleiteten Suchstrategien am Material weiterentwickelt (vgl. Wagner 340ff.; Mayring 2002: 114 und Früh 2004: 72ff.; 78). Zur weiteren Explikation wurden Artikel aus der „International Encyclopedia of Communication“ sowie Forschungsberichte aus einschlägigen Fachzeitschriften herangezogen.
Der Forschungsablaufs wurde durch folgende Schritte strukturiert:
1. Erarbeiten und Verstehen der grundlegenden Theorien und Konzepte sowie des Mof- fitt’schen Verfahrens. Begriffsdefinition.
2. Reduktion und Vergleich der einzelnen Darstellungen über die TdkD.
3. Strukturierung und Analyse dieses Materials in mehreren Durchgängen mit jeweils ange- passten Kategoriensystemen und unterschiedlichen Selektionskriterien (Relevanz für Persuasion, Relevanz für Message Design, etc.).
4. Ableiten von Strategien und Operationen und Anschlussfähig-machen und In-Bezug- setzen der Resultate zum Verfahren von Moffitt.
3. Theoretische Grundlagen
3.1 Message Design
Der Begriff „Message Design“ kann als Gestaltungsprozess von Mitteilungen und Botschaf- ten oder aber als Resultat desjenigen verstanden werden. Im Folgenden wird damit der Pro- zess gemeint.
Fragen danach, wie Messages (im Folgenden auch „Mitteilungen“)1 beschaffen sein müssen, um den grösstmöglichen persuasiven Effekt zu haben, liegen im Zentrum der Persuasionsforschung (vlg. Dillard / Pfau 2002: xvi). Dabei liege der Fokus des Interesses auf Stil, Struktur und Inhalt der Mitteilungen (vgl. Dillard / Pfau ebd.: x).
Das Goals-Plans-Action-Modell drückt die empirisch bestätigte Hypothese aus, dass Men- schen Kommunikationsbeiträge aufgrund von Zielen machen und dass dazwischen ein von den Zielen stimulierter Kommunikationsplan steht (vgl. Hample 2008: o.S.). O’Keefe unter- scheidet unterschiedliche „message design logics“ („expressive“, „conventional“, „rhetori- cal“), nach denen Mitteilungen produziert werden (vgl. O’Keefe 1988: 80ff. und Morgan 2010: o.S.).
Szyska definiert Botschaften als die „Kern- oder Schlüsselaussagen“ von Mitteilungen (vlg. Szyska 2005: 578 und 595). Die kommunikationspraxis-orientierte Literatur bietet zur Frage- stellung, wie Mitteilungen und Botschaften strategisch formuliert werden können, eine Viel- zahl an Ansätzen. Dabei wird je nach Ansatz auf die Framing-Theorie (vgl. bspw. Hallahan 2008: o.S.), die Rhetorik, die Diskursanalyse, den Storytelling-Ansatz, das Elaboration- Likelyhood-Model (ELM) und/oder (aber selten)2 andere sozialpsychologischen Theorien verwiesen. Stücheli-Herlach (2010: o.S.) schlägt mit dem „Framework of Messagede- sing/IAM“ ein Verfahren vor, welches Diskursanalyse, Argumentationstheorie und Storytel- ling-Ansatz für die Entwicklung und Überprüfung von Schlüsselbotschaften integriert. Vielen Ansätzen gemein, ist neben der Zielorientierung auch die taktische Orientierung an den Ei- genschaften des Empfängers (vgl. Behrent 2005: 508ff.; Stücheli-Herlach ebd.).
3.1.1 Message Design nach Moffitt (1999 und 2004)
Moffitt braucht den Begriff Message Design sowohl für den Design-Prozess als auch für die ausformulierte Message (welche sie auch „message format“ nennt) (vgl. Moffitt 1999: 84 und 157). Ihr Message-Design-Verfahren kann für alle Arten der Kampagnenkommunikation (Marketing-, PR-, Krisen-, Social-Issue-, Politik -) angewendet werden. Diese sei das zentrale Prinzip heutiger Organisationskommunikation (vgl. ebd.: 2).
Nach Moffitt sind Messages alle einzelnen wahrnehmbaren Komponenten, die (textlich, visuell, auditiv, materiell) in einer „communication selection“ erscheinen (vgl. ebd.: 139; 141). Eine Message kann aber auch eine Copy-Platform sein (vgl. ebd.: 145).
Der Kerngedanke ihres Verfahrens ist das „matching exercise“: Das inhaltliche Anpassen der Message-Formate an die Ziele der Kampagne einerseits, aber auch, und im Besonde- ren, an die Charakteristika der Empfänger: An ihr Wissen, ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle, ihre Einstellungen, ihre Überzeugungen, ihr Verhalten sowie ihre „public position“3. „Messa- ges should contain the textual and visual factors4 that will appeal to the qualities (knowledge areas, attitudes, behaviors or images) in the audience“ (Moffitt 2004: 353f.). Message- Inhalte sollten mit der Lebenswelt und Einstellungen der Empfänger vereinbar sein. Dies führe dazu, dass die Messages und ihre Inhalte eher und vertiefter verarbeitet würden und somit von den Empfängern eher akzeptiert würden (vgl. ebd.: 353; 354; 359).
Messages werden aus „basic strategies“ abgeleitet. Diese umfassen einerseits Ziele („goals“) sowie von diesen abgeleitete „objectives“. Die Ziele gründen auf den Zielen der Kampagne aber auch auf den Eigenschaften der Empfänger, welche gründlich erforscht werden müssten (vgl. Moffitt 1999: 8ff.).
Change Goals definieren einzelne gewünschte Veränderungen in Wissen, Einstellung, Ver- halten, Image5 oder „public position“ der Empfänger (vgl. 1999: 84; 97f.). Appeal Goals ha- ben in erster Linie die Funktion, die Empfänger auf den Inhalt aufmerksam zu machen und sie dafür zu interessieren. Sie sind deshalb an den Empfängerqualitäten („demographics“, „needs“, „psychographics“, „schemas“) ausgerichtet (vgl. ebd.: 88; 101). Appeal Goals und Change Goals können in einer Message oder in einem Message Format kombiniert enthal- ten sein.
Für jedes Ziel werden mehrere entsprechende Objectives abgeleitet. Diese geben an, welcher Zielgruppe wie viele und welche Informationen präsentiert werden sollen (vgl. ebd.: 85). Die Information selber wird dabei nicht ausformuliert, sondern nur die Art des Inhalts.
Ausgehend von den Objectives wird eine bewusste Auswahl von Message-Komponenten getroffen („message strategy“6 ), welche mit den jeweiligen spezifischen Empfängerqualitäten vereinbar sind und zu einem Message-Format verarbeitet werden (vgl. Moffitt 1999: 140; 2004: 354f.). Moffitt schlägt an verschiedenen Stellen (nur 1999) unter Bezugnahme auf ihr „collapse model“ vor, Messages nicht auf Zielgruppen, sondern auf Public-Images (auch Public-Positions genannt) auszurichten (vgl. Fussnote 5).
Sie bezieht sich zudem auf verschiedene Modelle und sozialpsychologische Theorien, welche die erhöhte Aufmerksamkeit für, und vertiefte Verarbeitung von Mitteilungen, die auf den Empfänger zugeschnitten sind, erklären sollen (AIDA, MAO, ELM, selective perception, cognitive dissoance) (vgl. Moffitt 2004: 353f.; Moffitt 1999: 86). Das Elaboration-Likelyhood- Model (ELM) ist im Anhang dargestellt. Ihre Bezugnahme auf „selective perception“ und „cognitive dissonance“ wird im Ergebnisteil dieser Arbeit analysiert.
3.2 Persuasion - Persuasive Kommunikation
Persuasion ist ein zentraler Begriff in dieser Arbeit. Die Definitionen dafür sind in der Literatur widersprüchlich. Merten typisiert Persuasion in „Belehren“, „Überreden“ und „Überzeugen“. Das „Überzeugen“ identifiziert er auch als „Glauben machen“ und somit als das Ziel von PR. Überreden sei eher das Ziel von Werbung (vgl. Merten 2005: 299).
Persuasion kann aus geisteswissenschaftlicher Perspektive (Rhetorik) oder naturwissen- schaftlicher Perspektive betrachtet werden, wo sie im Bereich der Sozialpsychologie er- forscht wird (vgl. Hunt 2004: 138). Diese Arbeit basiert auf sozialpsychologischen Persuasi- onsmodellen und entsprechender Empirie. Mit Blick auf die Beziehungskomponente von öffentlicher Kommunikation und den sozialpsychologischen Grundfragen danach, wie Ge- danken, Gefühle oder Verhalten von Menschen gegenseitig beeinflusst werden, darf aus diesem Wissenschaftsfeld hohe Aussagekraft für die Kampagnenkommunikation erwartet werden (vgl. Femers 2005: 50).
Weitgehend einig ist man sich in der Literatur darüber, dass es sich bei Persuasion um soziale Beeinflussung durch den Austausch von verbalen oder nonverbalen Symbolen handelt, und dass diese Beeinflussung beabsichtigt sein muss (vgl. Dillard / Pfau 2002: x; Miller 2002; 4ff.; Hunt 2004: 140; O’Keefe 2002; 2ff.). Dazu Miller:
Persuasive communication is any message that is intended to shape, reinforce or change the responses of others (Miller 1980 zit. nach Hunt 2004: 140).
Diese vielzitierte Definition Millers zeigt zudem, dass Persuasion nicht auf eine Ä nderung von Reaktionen („responses“) beschränkt ist, sondern diese auch bilden oder verstärken kann. Mit dem Begriff „response“ nimmt Miller überdies Rücksicht auf ein weiteres Definiti- onsproblem:
Einstellung oder Verhalten
Eine von verschiedenen grundsätzliche Definitionsfragen ist, ob mit Persuasion nur die Ein- stellung eines Menschen (attitude) oder nur das Verhalten (behavior) beeinflusst werden will, oder beides. Miller bemerkt dazu, dass „attitude“ eine intervenierende Variable sei, die eigentlich gar nicht gemessen werden könne. Es könnten bloss Einstellungs- Indikatoren gemessen werden, welche aber wiederum nur durch Verhalten zum Vorschein kämen (bspw. beim Ausfüllen eines Fragebogens) (vgl. Miller 2002: 12ff.). Trotzdem sei „Einstel- lung“ das wichtigste Konzept in der Sozialpsychologie (vgl. ebd.), und „the key mental state relevant to persuasive effects“ (O’Keefe 2002: 23). Die meisten Fachleute seien sich einig, dass Einstellung eine best ä ndige, positive oder negative Bewertung einer Person, Sache oder Idee sei, welche den Träger prädestiniere, in einer bestimmten Art auf diese zu reagie- ren (vgl. Hunt 2004: 144). Neben ihrer Position auf der positiv-negativ-Skala („Magnitude“) kann auch die Intensität, die Persistenz und die Funktion einer Einstellung unterschieden und gemessen werden. (vgl. Miller 2002: 13f.; O’Keefe: 2002: 24 und 29ff.)
Obwohl der Zusammenhang von Einstellung und entsprechendem Verhalten je nach Beziehungsdefinition sehr gering ist (im Mittel r=.30) (vgl. Leffelsend / Mauch / Hannover 2004: 52ff.) wird allgemein davon ausgegangen, dass die Einstellungsänderung eine wichtige Determinante für die Verhaltensänderung ist (vgl. O’Keefe 2002: 5).
Freiwilligkeit und Zwang
Persuasion wird gerne von anderen Formen sozialer Beeinflussung, die auf Zwang basie- ren, unterschieden (vgl. Hunt 2004: 140; Miller 2002: 4). Diesbezüglich zeigt sich aber eine weitere Definitionsunschärfe angesichts der Tatsache, dass Menschen auch mittels Dro- hungen oder Belohnungsversprechen rein kommunikativ beeinflusst werden können. Miller macht darauf aufmerksam, dass viel persuasiver Diskurs im weitesten Sinne indirekter Zwang darstellt, insbesondere dann, wenn die Effektivität der Mitteilung von der Glaubwür- digkeit dieser kommunizierten Handlungsanreizen abhängt. Zu letzteren zählt er auch sozia- le Konsequenzen, wie Beliebtheit oder Ächtung, die auf die Befolgung7 („compliance“) einer persuasiven Mitteilung folgen können (vgl. Miller 2002: 4ff). Sogenannte Compliance- gaining-Strategien, die sich in hohem Masse auf die Überzeugungskraft von physischen oder nicht physischen Anreizen verlassen, werden aber von den meisten Autoren aus der Definition von Persuasion ausgeschlossen (vgl. Hunt 2002: 140; Miller 2002: 4; O’Keefe 2002: 3f.). Dies zeigt sich auch in den folgenden Definitionen. O’Keefe verdichtet dazu Merkmale von exemplarischen Fällen „into something that looks like a definition of persuasi- on“:
„A successful intentional effort at influencing anothers mental state through communication in a circumstance in which the persuadee has some measure of freedom“ (O’Keefe 2002: 5).
Miller folgert aus seinen Ausführungen eine Definition, die, entgegen O’Keefe’s, auf Verhalten basiert:
„Thus, the phrase ‚beeing persuaded’ applies to situations where behavior has been modified by symbolic transactions (messages) that are sometimes, but not always, linked with coercive force (indirect coercive) and that appeal to the reason and emotions of the person(s) beeing persuaded“ (Miller 2002: 6).
Dies macht Sinn, wenn man in Betracht zieht, dass auch Einstellung schliesslich nur durch Verhalten gemessen werden kann. Und es macht auch Sinn, wenn sich der Theoretiker dar- auf besinnt, dass der Praktiker schliesslich immer auf eine Verhaltensänderung abzielt. Denn durch Einstellung allein wird noch kein Stimmzettel ausgefüllt und kein Produkt ge- kauft. Mit welchem Konzept von „Persuasion“ in dieser Arbeit zweckmässigerweise operiert werden soll, wird nach der Darlegung der weiteren theoretischen Grundlagen gefolgert.
3.2.1 Das Persuasionskonzept in Moffitt’s Message-Design-Verfahren
Bei Moffitt konnte weder eine Definition von Persuasion noch eine Definition von Einstellung („attitude“) gefunden werden (vgl. Moffitt 1999 und 2004). Aufgrund der Analyse ihrer Aussagen über die Ziele von Kampagnen und Mitteilungen bietet sich aber eine Interpretationen ihres Konzepts von Persuasion an:
Eine Kampagne dient nach Moffitt dazu, "to inform [and/ / P.H.] or to persuade" (Moffitt 1999: 3), und dabei Änderungen in den Kenntnissen, den Einstellungen, dem Verhalten, den Images oder der "public position" (gemäss Grunig) bei der Zielgruppe herbeizuführen (vgl. 1999: 84). Unter weiterer Berücksichtigung folgender Aussagen Moffitt’s zu den Zielen von Message-Design und Messages, „Your Task is to create messges that match the interest of the audience, so that they will, firts pay attention to them and, then, be persuaded to accept them“ (1999: 86).
„[...] so that it gets their attention and, hopefully, has a persuasive effect on them“ (1999: 87).
„[...] to get the audience to pay attention to these messages, and hopefully then be persuaded to accept accept their content“ (2004: 352 / Hervorheb. i. O.).
und wenn man „to accept the messages“ und „to accept their content“ als „den Inhalt der Mitteilungen als wahr zu akzeptieren“ versteht, kann man folgern, dass nach Moffitt Mittei- lungen mehrere Funktionen haben können. Einerseits lassen sich daraus zwei direkte Per- suasionsfunktionen ableiten: 1. Die Einstellung bezüglich der Wahrheit des Inhalts zu verän- dern, und 2. Einstellungen und Verhalten dem Inhalt entsprechend zu verändern. Anderer- seits lassen sich daraus aber auch indirekte Persuasionsziele von Messages ableiten: Näm- lich, Aufmerksamkeit und Interesse für die Mitteilung und ihren Inhalt zu generieren, damit das Publikum anschliessend "hopefully" überzeugt ist (oder wird), diesen Inhalt zu akzeptie- ren.
[...]
1 vgl. Merriam Webster’s Online Dictionary (2010): „Message“: 1: a communication in writing, in speech, or by signals, 2: a messenger's mission, 3: an underlying theme or idea. Und: Communication: 2 a: information communicated; b: a verbal or written message.
2 vgl. dazu Femers 2005: 59.
3 Definiert nach der „Grunig Typology“ („Grunig & Hunt 1984“) den Grad an Interesse oder Betroffenheit der
Empfänger bezüglich des Inhalts oder des Senders (non-public, latent, aware, active) (vgl. Moffitt 1999: 99; 162).
4 Unter „visual factors“ (oder auch „visualization factors“) versteht sie alle nicht-textlichen Elemente der Message.
5 Der Begriff Image wird an gewissen Stellen auf gleicher hierarchischer Ebene wie Wissen, Einstellung, Verhalten etc. aufgeführt (vgl. Moffitt 1999: 97, an anderen Stellen aber als Überbegriff für diese verwendet (vgl. ebd. :89). In ihrem „collapse model“ (vgl. Moffitt 2001) konzeptualisiert sie „images(s) and public position(s) as the same theoretical construct“ und meint damit „shared knowledge, attitudes, and behaviors within a population“ (vgl. Moffitt 2001: 150 und Moffitt 1999: 28).
6 Der Begriff „message strategy“ wird von Moffitt nicht durchgehend konsistent verwendet (vgl. Moffitt 1999: 140; 166; 2004: 346; 355) und hier deshalb so eingesetzt, dass er am meisten Sinn macht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand der Analyse und die Zielsetzung dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob und welche Vorhersagen bezüglich der Persuasivität von Kommunikationsbeiträgen im Sinne Moffitt's aus dem Wissen um die Entstehung und Reduktion von kognitiver Dissonanz gemacht werden können. Die Resultate sollen für das Message-Design-Verfahren nach Moffitt anschlussfähig gemacht werden, um handlungsleitende Strategien für Berufspraktiker abzuleiten.
Warum ist dieser Forschungsbeitrag relevant?
Aus berufspraktischer Sicht hilft die Arbeit Praktikern, die Message-Design-Verfahren nutzen, das persuasive Potential kognitiver Dissonanz zu berücksichtigen. Aus wissenschaftlicher Sicht wird die Funktion der kognitiven Dissonanz in Moffitts Verfahren kritisch hinterfragt und möglicherweise erweitert.
Welche Methoden wurden für die Analyse verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Interpretation und Analyse von Korpora zu Message-Design, Persuasion und kognitiver Dissonanz. Es wurden hermeneutische Textinterpretation, Vergleichsverfahren, Typenbildung und qualitative Techniken wie Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung eingesetzt. Die Methodik orientierte sich an intersubjektiver Nachvollziehbarkeit, Reliabilität und Validität.
Was versteht man unter "Message Design"?
"Message Design" kann sowohl den Gestaltungsprozess von Mitteilungen und Botschaften als auch das Ergebnis dieses Prozesses bezeichnen. In dieser Arbeit wird der Prozess selbst damit gemeint.
Wie definiert Moffitt "Message Design"?
Moffitt verwendet den Begriff sowohl für den Design-Prozess als auch für die ausformulierte Message. Ihr Verfahren zielt darauf ab, Message-Formate an die Ziele der Kampagne und an die Charakteristika der Empfänger anzupassen ("matching exercise").
Was sind die "basic strategies" im Message-Design-Verfahren nach Moffitt?
Die "basic strategies" umfassen Ziele ("goals") und davon abgeleitete "objectives". Die Ziele basieren sowohl auf den Zielen der Kampagne als auch auf den Eigenschaften der Empfänger. Es gibt Change Goals (Veränderungen in Wissen, Einstellung, Verhalten) und Appeal Goals (Aufmerksamkeit und Interesse der Empfänger).
Wie definiert Miller persuasive Kommunikation?
Persuasive Kommunikation ist jede Botschaft, die beabsichtigt, die Reaktionen anderer zu formen, zu verstärken oder zu verändern.
Wie ist das Persuasionskonzept in Moffitts Message-Design-Verfahren?
Moffitt selbst definiert weder Persuasion noch Einstellung explizit. Aus ihren Aussagen lässt sich ableiten, dass Kampagnen informieren und/oder überzeugen sollen, um Änderungen in Wissen, Einstellungen, Verhalten, Images oder der "public position" zu bewirken. Messages sollen Aufmerksamkeit erregen und die Akzeptanz ihres Inhalts fördern.
Details
- Titel
- Die Relevanz der Theorie der kognitiven Dissonanz für das Message-Design nach Moffitt bezüglich der Persuasion
- Hochschule
- ZHAW - Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (Institut für Angewandte Medienwissenschaft)
- Note
- 1.5
- Autor
- Peter Haberstich Haberstich (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 33
- Katalognummer
- V164052
- ISBN (eBook)
- 9783640787456
- ISBN (Buch)
- 9783640787654
- Dateigröße
- 1016 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kommunikation Sozialpsychologie kognitive Dissonanz Persuasion Rhetorik Message Design Mary Anne Moffitt elaboration likelyhood model ELM selective exposure selective perception Boomerang-Effect cognitive dissonance theorie der kogntiven dissonanz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Peter Haberstich Haberstich (Autor:in), 2010, Die Relevanz der Theorie der kognitiven Dissonanz für das Message-Design nach Moffitt bezüglich der Persuasion, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/164052
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-