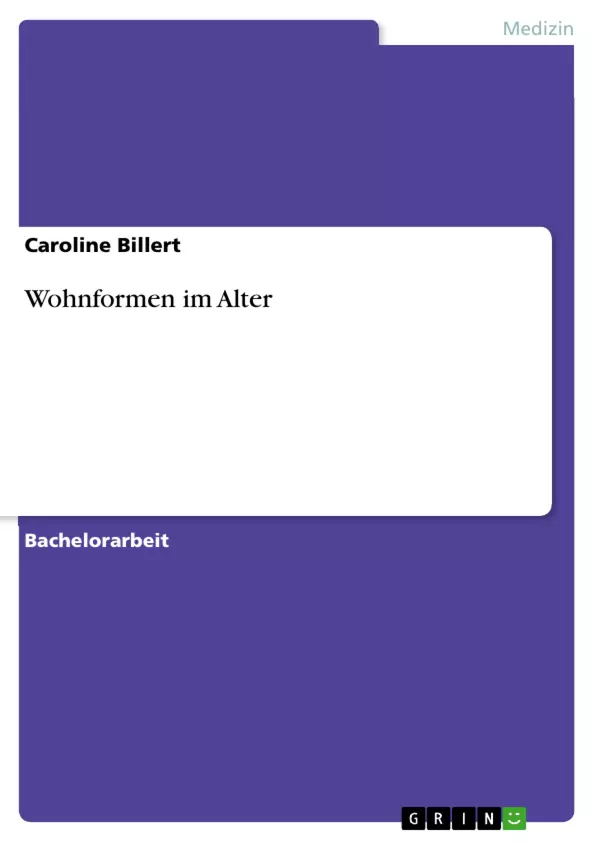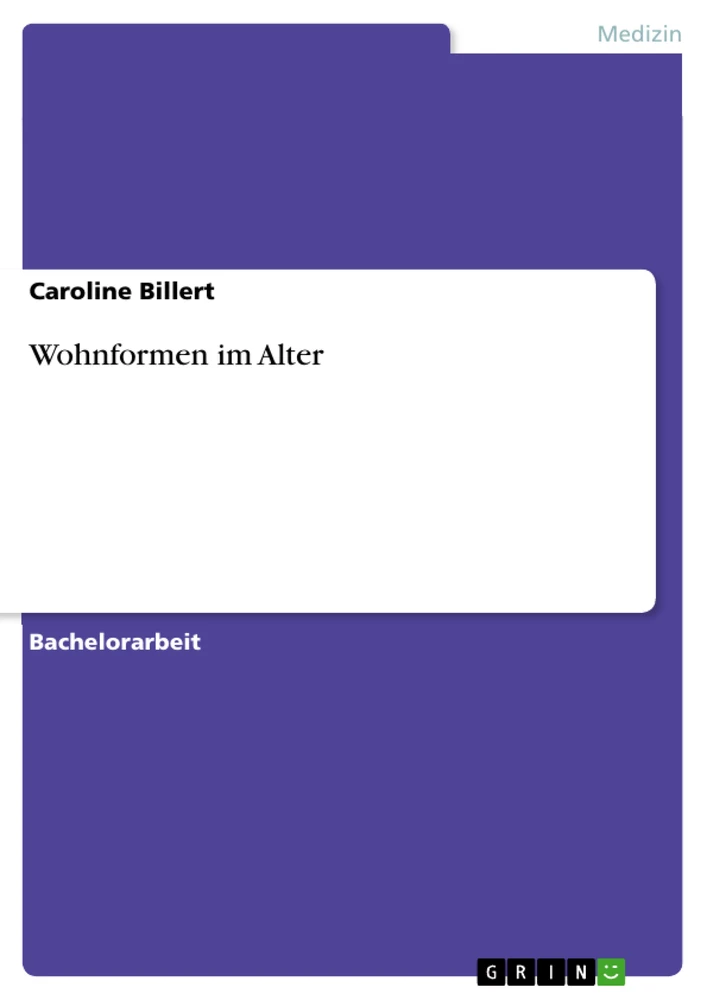
Wohnformen im Alter
Bachelorarbeit, 2009
44 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Hintergrund
- 2.1 Wohnen im Wandel
- 2.2 Wohnsituation im Alter
- 2.3 Wohnbedürfnisse im Alter
- 3 Wohnformen im Alter
- 3.1 Im eigenen Zuhause bleiben
- 3.1.1 Die Wohnraumanpassung
- 3.1.2 Mobile soziale Dienste
- 3.1.3 Betreutes Wohnen zu Hause
- 3.1.4 Ambulante Pflegedienste
- 3.1.5 Teilstationäre Betreuung - Tagespflege
- 3.2 Vorausschauende Wohnungswechsel im Alter
- 3.2.1 Betreutes Wohnen
- 3.2.2 Selbstorganisierte Wohn- und Hausgemeinschaften
- 3.2.3 Wohnstifte
- 3.3 „Rundum-Versorgung“ im neuen zu Hause
- 3.3.1 Betreute Wohn- und Hausgemeinschaften
- 3.3.2 Alten- und Pflegeheime
- 4 Kritische Darstellung der Wohnformen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit „Wohnformen im Alter“ befasst sich mit den verschiedenen Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen und analysiert deren Vor- und Nachteile. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über das vielseitige Angebot an Wohnformen im Alter zu geben und die Bedürfnisse und Anforderungen älterer Menschen in Bezug auf ihr Wohnumfeld zu beleuchten.
- Der Wandel der Wohnsituation im Alter
- Die verschiedenen Wohnformen im Alter
- Die Bedeutung von Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter
- Die Herausforderungen und Chancen der verschiedenen Wohnformen
- Kritische Betrachtung der verschiedenen Wohnformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas „Wohnformen im Alter“ im Kontext der demografischen Entwicklung und den Bedürfnissen älterer Menschen hervorhebt. Das zweite Kapitel beleuchtet den Hintergrund des Themas, indem es den Wandel der Wohnsituation im Alter und die Bedürfnisse älterer Menschen im Hinblick auf ihr Wohnumfeld analysiert.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Wohnformen im Alter vorgestellt. Es werden sowohl Möglichkeiten für ein selbstständiges Wohnen im eigenen Zuhause, wie auch verschiedene Formen des betreuten Wohnens und der vollstationären Pflege behandelt. In diesem Kapitel wird auf die verschiedenen Angebote und Dienstleistungen im Bereich des betreuten Wohnens, des betreuten Wohnens zu Hause und der teilstationären Betreuung eingegangen.
Das vierte Kapitel widmet sich einer kritischen Darstellung der verschiedenen Wohnformen im Alter. Hierbei werden die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Wohnens im Alter, den verschiedenen Wohnformen, den Bedürfnissen älterer Menschen, der Bedeutung von Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter sowie den Herausforderungen und Chancen der verschiedenen Wohnformen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Wohnformen gibt es für das Alter in Deutschland?
Es wird zwischen dem Verbleib im eigenen Zuhause (mit Unterstützung), vorausschauenden Wohnungswechseln (z.B. Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften) und der Rundum-Versorgung (Pflegeheime) unterschieden.
Was versteht man unter "Betreutem Wohnen zu Hause"?
Hierbei bleiben Senioren in ihrer gewohnten Wohnung, nutzen aber Dienstleistungen wie mobile soziale Dienste, Notrufsysteme oder ambulante Pflege, um ihre Selbstständigkeit zu erhalten.
Sind moderne Wohnformen wie Hausgemeinschaften für Senioren geeignet?
Ja, selbstorganisierte Wohn- und Hausgemeinschaften fördern soziale Kontakte und wirken der Einsamkeit entgegen, erfordern jedoch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Kompromissbereitschaft.
Wie beeinflusst der demographische Wandel den Wohnungsmarkt?
Durch die steigende Zahl älterer Menschen wächst der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum und speziellen Versorgungsangeboten massiv an, was zu einer hohen Dynamik im Pflegesektor führt.
Welche Rolle spielt die Wohnraumanpassung im Alter?
Wohnraumanpassungen (z.B. Badumbau, Treppenlifte) sind oft entscheidend, um trotz körperlicher Einschränkungen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben zu können.
Details
- Titel
- Wohnformen im Alter
- Hochschule
- Universität Vechta; früher Hochschule Vechta (Institut für Gerontologie)
- Note
- 1,7
- Autor
- Caroline Billert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V164231
- ISBN (eBook)
- 9783640790067
- ISBN (Buch)
- 9783656561453
- Dateigröße
- 594 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Wohnformen Alter
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Caroline Billert (Autor:in), 2009, Wohnformen im Alter, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/164231
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-