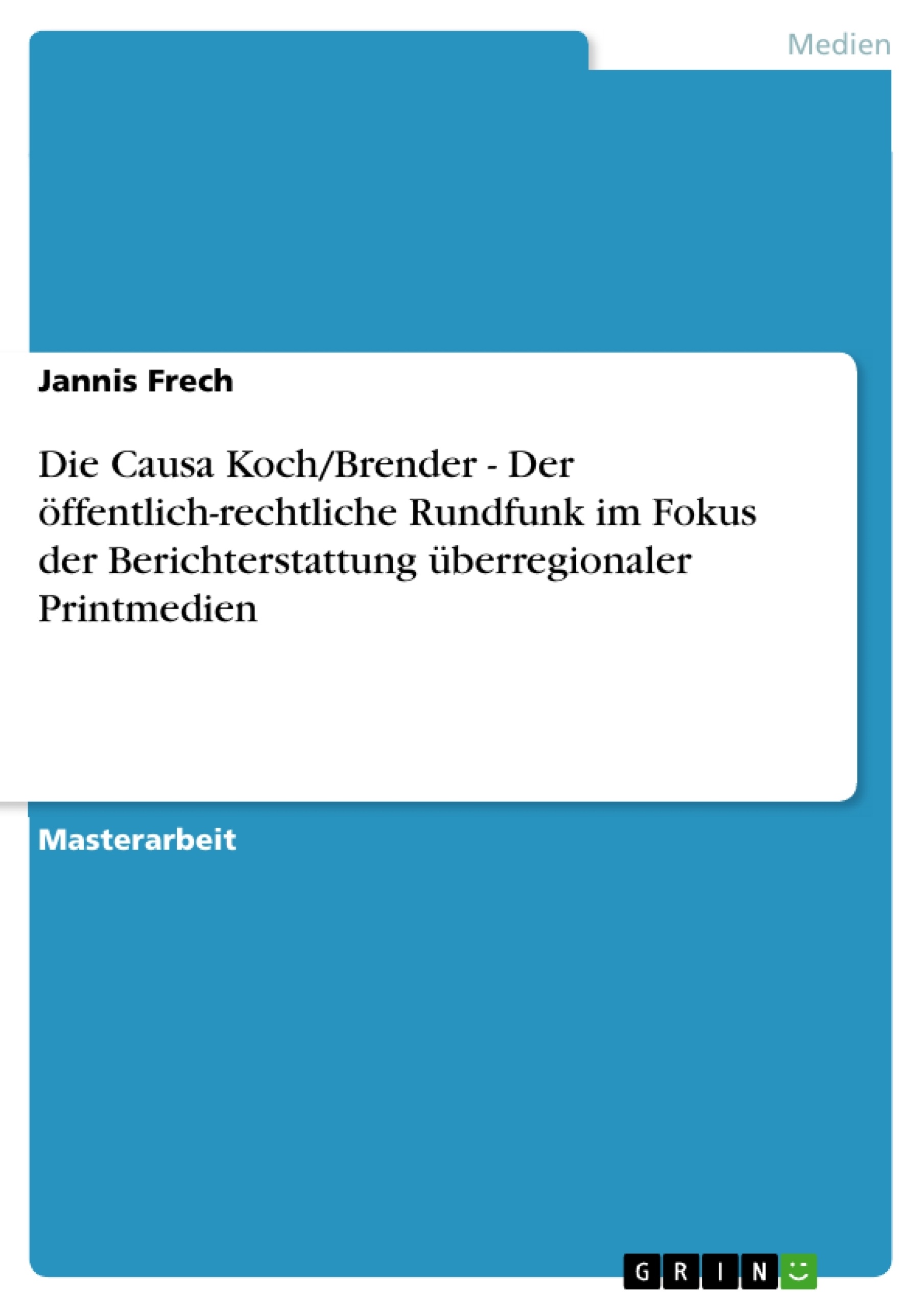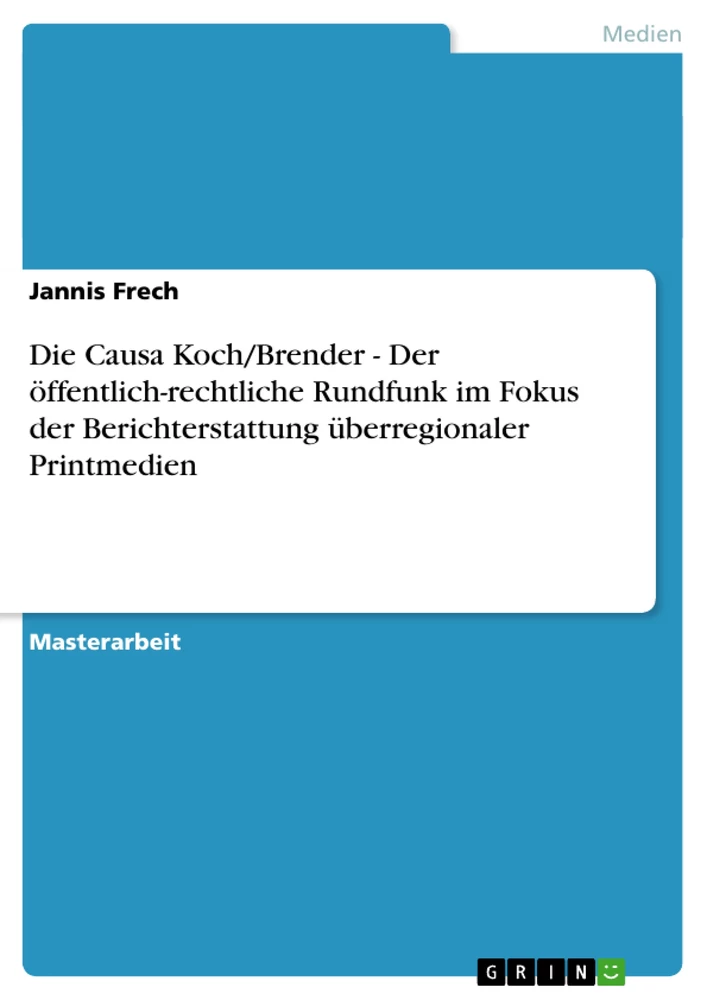
Die Causa Koch/Brender - Der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Fokus der Berichterstattung überregionaler Printmedien
Masterarbeit, 2010
162 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- Theoretische Überlegungen und Entstehung
- Gesetzliche Regelungen
- Bundesebene
- Länderebene
- EU-Recht
- Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht
- Die Aufsicht des öffentlich rechtlichen Rundfunks
- Interne Aufsicht
- Rundfunk- oder Fernsehrat
- Verwaltungsrat
- Intendant
- Externe Aufsicht
- Rechtsaufsicht
- Exkurs: Finanzbedarfsermittlung durch die KEF
- Finanzaufsicht
- Interne Aufsicht
- Der Untersuchungsgegenstand: Die Causa Brender/Koch
- Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF)
- Geschichte und Kennzahlen
- Aufsichtsstruktur
- Chronologie der Causa Brender/Koch
- Berichterstattung zur Causa Brender/Koch
- Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF)
- Empirische Analyse
- Forschungsleitfragen
- Stichprobenauswahl
- Methodik
- Kategoriensystem
- Erstellung des Kategoriensystems
- Theoriegeleitete Kategorienbildung
- Empiriegeleitete Kategorienbildung
- Stichprobenauswahl
- Erhebungskriterien
- Erhebung und Auswertung
- Bildung der Unterkategorien
- Erstellung des Kategoriensystems
- Codierung
- Pretest
- Stichprobenauswahl
- Codierer-Schulung
- Ergebnis
- Überarbeitung des gesamten Codebuchs
- Erhebung
- Auswahl und Schulung der Codierer
- Durchführung
- Auswertung
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Analyse der Ergebnisse
- Methodenkritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert die Berichterstattung überregionaler Printmedien zur sogenannten Causa Brender/Koch, einem Konflikt um die Vertragsverlängerung des ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender, der im Jahr 2008 öffentlich wurde. Ziel der Arbeit ist es, die mediale Rezeption des Konflikts zu untersuchen und dabei insbesondere die Frage nach der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu beleuchten.
- Die Rolle der Aufsichtsgremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
- Die Berichterstattung überregionaler Printmedien zur Causa Brender/Koch
- Die Frage der Staatsferne und Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- Der Einfluss politischer Interessen auf die Medienlandschaft
- Die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Mediensystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Causa Brender/Koch dar und erläutert die Bedeutung des Themas für die Frage der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
- Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen und rechtlichen Grundlagen der Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Hier werden verschiedene Konzepte und gesetzliche Regelungen auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene vorgestellt.
- Kapitel 3 befasst sich mit den Aufsichtsstrukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sowohl intern (Rundfunkrat, Verwaltungsrat, Intendant) als auch extern (Rechtsaufsicht, Finanzaufsicht).
- Kapitel 4 stellt den Fall Brender/Koch im Detail vor, inklusive einer Chronologie des Konflikts und einer Analyse der Berichterstattung verschiedener Medien.
- Kapitel 5 beschreibt die empirische Analyse der Masterarbeit, inklusive der Forschungsleitfragen, der Stichprobenauswahl, der Methodik, der Kategorienbildung und der Auswertung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Staatsferne, Unabhängigkeit, Medienaufsicht, Causa Brender/Koch, ZDF, Chefredakteur, Verwaltungsrat, Politik, Berichterstattung, Printmedien, Empirische Analyse, Kategoriensystem, Codierung, Auswertung, Methodenkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter der „Causa Brender/Koch“ verstanden?
Die Causa Brender/Koch bezeichnet den politischen Konflikt um die Nicht-Verlängerung des Vertrages des ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender im Jahr 2009, die maßgeblich vom damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch vorangetrieben wurde.
Was ist das zentrale Thema der Masterarbeit zur Causa Koch/Brender?
Die Arbeit untersucht, wie überregionale Printmedien über die politische Einflussnahme auf Personalentscheidungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Fall Brender/Koch berichteten und welche Rolle dabei die Staatsferne spielt.
Was bedeutet „Staatsferne“ im Kontext des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Staatsferne bedeutet, dass der Rundfunk unabhängig von staatlicher oder politischer Einflussnahme agieren muss, um eine freie und objektive Berichterstattung zu gewährleisten.
Welche Aufsichtsgremien gibt es beim ZDF?
Das ZDF verfügt über interne Aufsichtsstrukturen wie den Fernsehrat und den Verwaltungsrat sowie externe Kontrollinstanzen wie die Rechts- und Finanzaufsicht.
Warum ist die Berichterstattung der Printmedien in diesem Fall so wichtig?
Da sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk oft schwertut, über eigene Unabhängigkeitsprobleme zu berichten, fungiert die Presse als stellvertretender Verteidiger der Pressefreiheit.
Welche Methodik wurde in der empirischen Analyse verwendet?
Es wurde eine empirische Inhaltsanalyse mit einem spezifischen Kategoriensystem und Codierung durchgeführt, um die Berichterstattung überregionaler Zeitungen systematisch auszuwerten.
Details
- Titel
- Die Causa Koch/Brender - Der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Fokus der Berichterstattung überregionaler Printmedien
- Hochschule
- Universität Hamburg (Hamburg )
- Note
- 1,3
- Autor
- Jannis Frech (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 162
- Katalognummer
- V164305
- ISBN (eBook)
- 9783640793457
- ISBN (Buch)
- 9783640793624
- Dateigröße
- 1503 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Journalismus öffentlich-rechtlicher Rundfunk Staatsferne Medien Mediensystem Nikolaus Brender Roland Koch ZDF Rundfunkgremien Fernsehrat Rundfunkrat Medienaufsicht Inhaltsanalyse
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 56,99
- Arbeit zitieren
- Jannis Frech (Autor:in), 2010, Die Causa Koch/Brender - Der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Fokus der Berichterstattung überregionaler Printmedien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/164305
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-