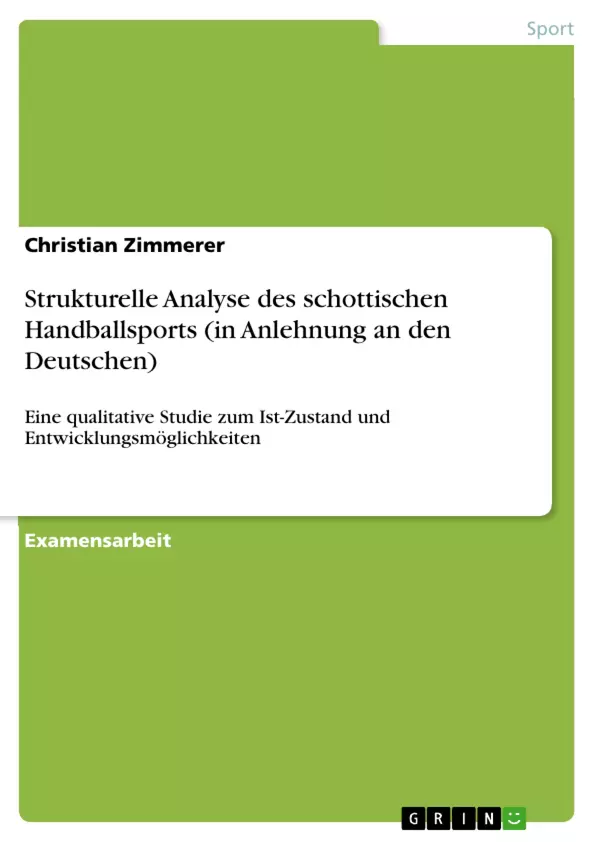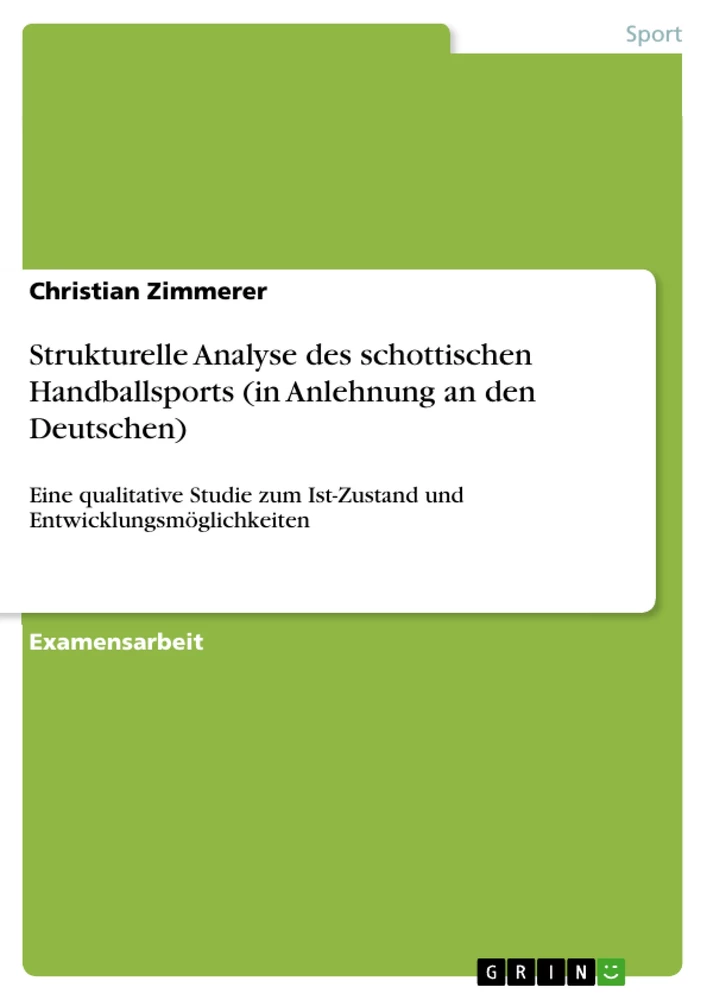
Strukturelle Analyse des schottischen Handballsports (in Anlehnung an den Deutschen)
Examensarbeit, 2010
114 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte des Handballsports von der Antike bis zum Mittelalter
- Geschichte des Handballsports in Deutschland
- Geschichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
- Geschichte von 1897 bis 1917
- Nach dem Ersten Weltkrieg (Entwicklung des Hallenhandballs)
- Während & nach dem Zweiten Weltkrieg
- Geschichte des schottischen Handballsports
- Verbandsstrukturen
- Internationale Handballföderation (IHF)
- Europäische Handballföderation (EHF)
- Deutscher Handballbund (DHB)
- Regionalverband (SHV) & Landesverband (HVW)
- Britischer Handballverband (BHA)
- Schottischer Handballverband (SHA)
- Interviews mit schottischen Offiziellen
- Qualitative Befragung – Leitfadeninterview als Experteninterview (Theorie)
- Persönlicher Leitfaden - Entstehung & Theorie
- Praktische Durchführung der Experteninterviews
- Auswertung der Experteninterviews
- Gesellschaft & Umwelt
- Programmatische Vorgaben & Prioritätensetzung
- Interesse & Partizipation
- Organisationen & deren Aufgabenbereiche sowie Personalstruktur
- Finanzquellen
- Strukturen, Talentsuche, Ausbildung sowie finanzielle Unterstützung (Athleten, Trainer, Schiedsrichter & Offizielle)
- Sportstätten, Trainingsort & -art sowie Wettkampfwesen
- Aktuelle Trends
- Interorganisationale Angleichung aus der Perspektive des Neo-Institutionalismus
- Organisationstypisierung nach Mintzberg
- Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit einer strukturellen Analyse des schottischen Handballsports im Vergleich zum deutschen Handballsport. Ziel der Arbeit ist es, den Ist-Zustand des schottischen Handballsports zu analysieren und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Fokus der Untersuchung steht die Frage, wie sich die Strukturen des schottischen Handballsports im Vergleich zum deutschen System darstellen und welche Herausforderungen und Potenziale sich daraus ergeben.
- Vergleich der Verbandsstrukturen und Organisationsformen im deutschen und schottischen Handball
- Analyse der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für den Handballsport in Schottland
- Untersuchung der finanziellen Ressourcen und der Finanzierungsmöglichkeiten des schottischen Handballsports
- Bewertung der Trainingsbedingungen, der Talentförderung und der Ausbildung von Spielern, Trainern und Schiedsrichtern in Schottland
- Identifizierung von Entwicklungspotenzialen und Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung des schottischen Handballsports
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Motivation und die Relevanz der Untersuchung. In Kapitel 2 wird die Geschichte des Handballsports von der Antike bis zum Mittelalter beleuchtet, wobei der Fokus auf die Entwicklung des Sports in Deutschland und Schottland gelegt wird. Kapitel 3 befasst sich mit den Verbandsstrukturen im Handball, wobei die internationalen, nationalen und regionalen Verbände im Detail vorgestellt werden. In Kapitel 4 werden die Interviews mit schottischen Handball-Offiziellen beschrieben und die Methodik der qualitativen Befragung erläutert. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Experteninterviews und analysiert die verschiedenen Aspekte des schottischen Handballsports, wie z.B. die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Finanzierungsmöglichkeiten und die Strukturen der Talentförderung. Das Fazit und der Ausblick in Kapitel 6 fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und geben Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung des schottischen Handballsports.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Handball, Sport, Verbandsstrukturen, Organisation, Entwicklung, Vergleich, Deutschland, Schottland, Experteninterviews, qualitative Forschung, Finanzierung, Talentförderung, Training, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Neo-Institutionalismus, Organisationstypisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der strukturellen Analyse des schottischen Handballs?
Die Arbeit vergleicht die Strukturen des schottischen Handballsports mit denen in Deutschland, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen.
Welche Verbandsstrukturen werden untersucht?
Die Untersuchung umfasst die IHF, EHF, den DHB (Deutschland) sowie den Britischen (BHA) und Schottischen Handballverband (SHA).
Wie wurde die Forschung durchgeführt?
Es wurden qualitative Experteninterviews mit schottischen Offiziellen geführt, um Einblicke in Organisation, Finanzierung und Talentförderung zu erhalten.
Welche Herausforderungen hat der Handball in Schottland?
Die Arbeit beleuchtet Aspekte wie geringes Interesse und Partizipation, begrenzte Finanzquellen und die Notwendigkeit besserer Sportstätten und Trainerausbildungen.
Welche theoretischen Modelle werden zur Analyse genutzt?
Die Arbeit nutzt den Neo-Institutionalismus sowie die Organisationstypisierung nach Mintzberg zur Auswertung der Strukturen.
Was sind die zentralen Schlüsselwörter?
Handball, Schottland, Verbandsstrukturen, Sportentwicklung und Experteninterviews.
Details
- Titel
- Strukturelle Analyse des schottischen Handballsports (in Anlehnung an den Deutschen)
- Untertitel
- Eine qualitative Studie zum Ist-Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten
- Hochschule
- Universität Konstanz
- Note
- 1,5
- Autor
- Christian Zimmerer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 114
- Katalognummer
- V164964
- ISBN (eBook)
- 9783640810703
- ISBN (Buch)
- 9783640812813
- Dateigröße
- 1950 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- strukturelle analyse handballsports anlehnung deutschen) eine studie ist-zustand entwicklungsmöglichkeiten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 48,99
- Arbeit zitieren
- Christian Zimmerer (Autor:in), 2010, Strukturelle Analyse des schottischen Handballsports (in Anlehnung an den Deutschen), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/164964
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-