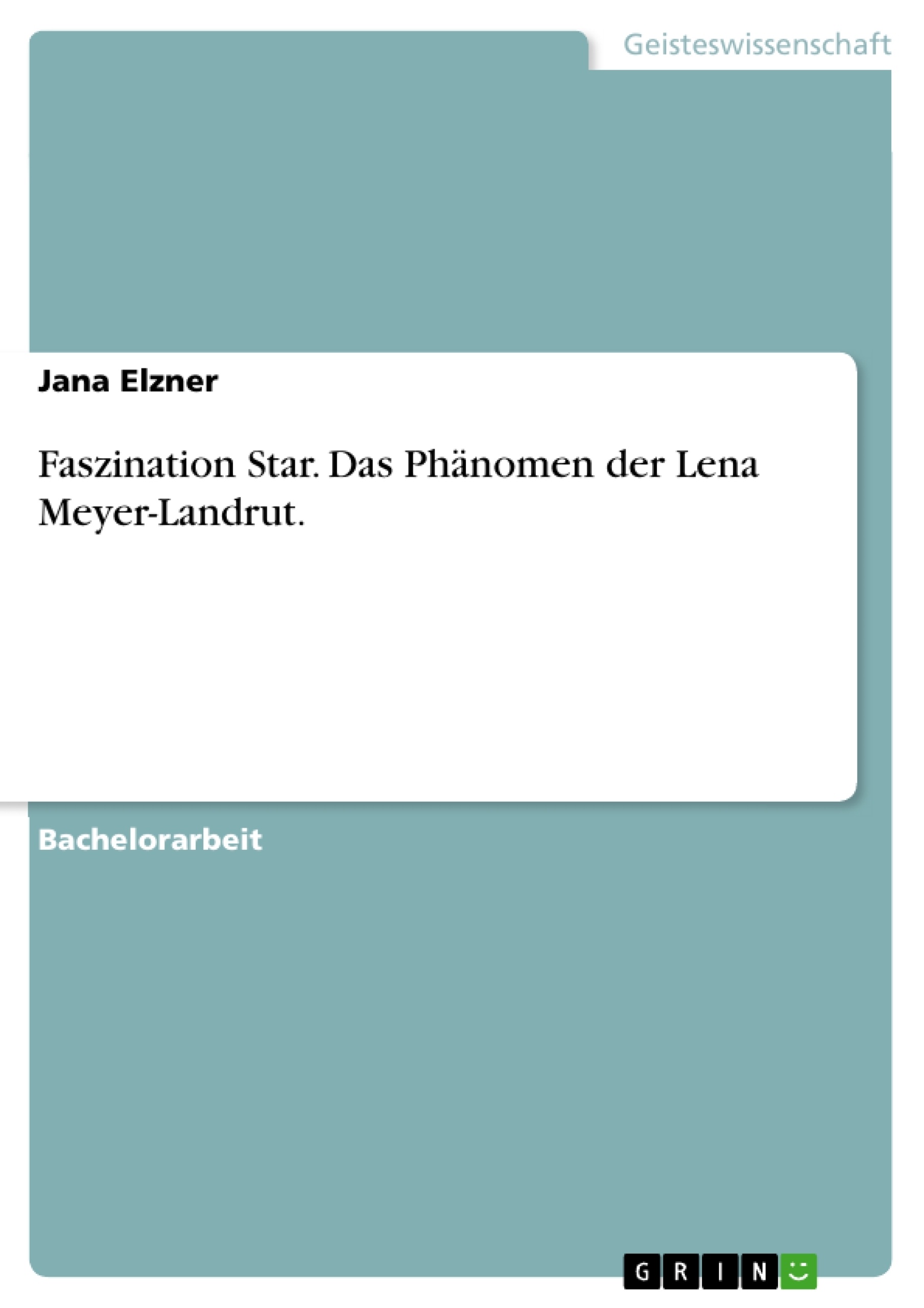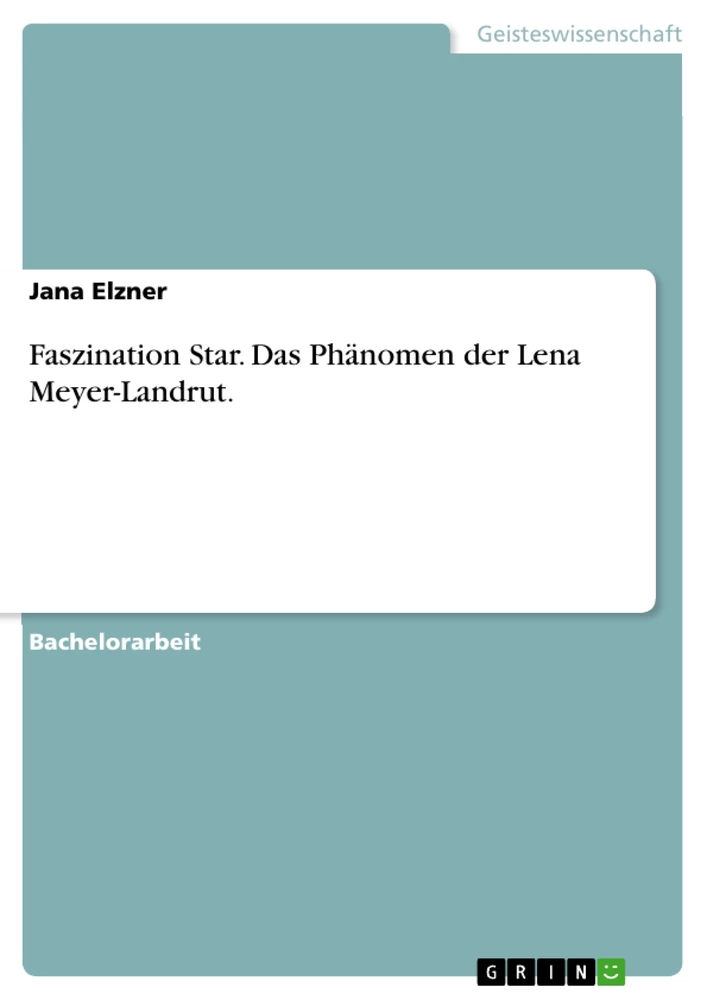
Faszination Star. Das Phänomen der Lena Meyer-Landrut.
Bachelorarbeit, 2010
51 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kultur – Medien - Medienkultur
- 2.1. Populärkultur: Historie und Gesellschaft
- 2.2. Sozialer Wandel und Medienkultur
- 3. Der Star
- 3.1 Seine Wegbereiter und ihre soziale Funktion
- 3.2. Starbegriff
- 3.2.1. Das Idol
- 3.2.2. Das Vorbild
- 3.3. ,,Star-Sein“
- 4. Der Star als „soziales Konstrukt“
- 4.1. „Star-Image“
- 4.2. „Star-Mensch“ und „Star-Rolle“
- 5. Die Parasoziale Beziehung zwischen Star und Nutzer
- 5.1. Einführende Begriffsbestimmungen
- 5.2. Parasoziale Beziehungen
- 5.3. Nähe-Distanz und Projektion
- 5.4. Identität und Identifikation
- 6. Empirie Teil: Eine Qualitative Inhaltsanalyse
- 6.1. Vorgehensweise der Online-Datenerhebung
- 6.2. Forschungsmethode
- 6.3. Durchführung der Qualitativen Inhaltsanalyse
- 6.4. Starportrait: Lena Meyer-Landrut
- 7. Fallanalyse am Star-Phänomen der Lena Meyer-Landrut
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Faszination, die von Medienstars ausgeht, am Beispiel von Lena Meyer-Landrut. Ziel ist es, die sozialen Beweggründe und Motive hinter dieser Faszination zu erforschen und die sozialen Funktionen von Stars in modernen Mediengesellschaften zu beleuchten. Die Arbeit nähert sich dem Thema interdisziplinär, indem sie soziologische, medienwissenschaftliche, sozialpsychologische und kulturwissenschaftliche Perspektiven integriert.
- Entwicklung und Geschichte der Medien- und Populärkultur
- Der Star als soziales Konstrukt und seine verschiedenen Bedeutungen (Idol, Vorbild)
- Parasoziale Beziehungen zwischen Star und Publikum
- Qualitative Inhaltsanalyse des Lena Meyer-Landrut Phänomens
- Soziale Funktionen des Stars in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Faszination für Medienstars ein und stellt die Forschungsfrage nach den sozialen Motiven dieser Anziehungskraft. Sie begründet die Wahl von Lena Meyer-Landrut als Fallbeispiel und skizziert den interdisziplinären Ansatz der Arbeit, der Soziologie, Medienwissenschaft, Sozialpsychologie und Cultural Studies vereint. Der "Medienhype" um Lena Meyer-Landrut wird als Ausgangspunkt der Untersuchung genannt und die Komplexität des Star-Phänomens als weitgehend unerforschtes Feld der Wissenschaft hervorgehoben.
2. Kultur - Medien - Medienkultur: Dieses Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Medien und Kultur, beginnend mit der Kritik an den Massenmedien im 20. Jahrhundert und der Gegenüberstellung von Hochkultur und Massenkultur. Es wird die zunehmende Verschmelzung von Medien und Kultur im Laufe des gesellschaftlichen Wandels beschrieben und der Begriff der Populärkultur im Kontext der Industrialisierung, Verstädterung und der Entstehung von Massenmedien erläutert. Der Wandel des Kulturbegriffs und seine praktische Bedeutung im Alltag werden im Kontext der Cultural Studies diskutiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Das Star-Phänomen Lena Meyer-Landrut
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Faszination, die von Medienstars ausgeht, am Beispiel von Lena Meyer-Landrut. Sie erforscht die sozialen Beweggründe und Motive hinter dieser Faszination und beleuchtet die sozialen Funktionen von Stars in modernen Mediengesellschaften.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Welche sozialen Motive stecken hinter der Faszination für Medienstars wie Lena Meyer-Landrut? Die Arbeit untersucht die sozialen Funktionen von Stars in modernen Mediengesellschaften und analysiert das „Lena Meyer-Landrut Phänomen“ als Fallbeispiel.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der soziologische, medienwissenschaftliche, sozialpsychologische und kulturwissenschaftliche Perspektiven integriert. Eine qualitative Inhaltsanalyse der Online-Daten zu Lena Meyer-Landrut bildet einen zentralen empirischen Teil der Arbeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Entwicklung und Geschichte der Medien- und Populärkultur; Der Star als soziales Konstrukt und seine verschiedenen Bedeutungen (Idol, Vorbild); Parasoziale Beziehungen zwischen Star und Publikum; Qualitative Inhaltsanalyse des Lena Meyer-Landrut Phänomens; Soziale Funktionen des Stars in der Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kultur - Medien - Medienkultur, Der Star, Der Star als „soziales Konstrukt“, Die Parasoziale Beziehung zwischen Star und Nutzer, Empirie Teil: Eine Qualitative Inhaltsanalyse, Fallanalyse am Star-Phänomen der Lena Meyer-Landrut.
Wie wird das Kapitel "Kultur - Medien - Medienkultur" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Medien und Kultur, die Verschmelzung von Medien und Kultur im gesellschaftlichen Wandel und den Begriff der Populärkultur im Kontext der Industrialisierung, Verstädterung und der Entstehung von Massenmedien. Der Wandel des Kulturbegriffs und seine praktische Bedeutung im Alltag werden im Kontext der Cultural Studies diskutiert.
Wie wird die Fallstudie zu Lena Meyer-Landrut durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet eine qualitative Inhaltsanalyse von Online-Daten zu Lena Meyer-Landrut, um das Star-Phänomen aus empirischer Perspektive zu untersuchen. Die Vorgehensweise der Online-Datenerhebung und die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse werden detailliert beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit soll die sozialen Funktionen von Stars in der modernen Mediengesellschaft aufzeigen und die Motive der Faszination für Medienstars wie Lena Meyer-Landrut erklären. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse liefern empirische Belege für die theoretischen Überlegungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Soziologie, Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Kulturwissenschaften, die sich mit dem Thema Medienstars, Populärkultur und sozialen Beziehungen auseinandersetzen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text der Bachelorarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Auszug dient lediglich als Übersicht.
Details
- Titel
- Faszination Star. Das Phänomen der Lena Meyer-Landrut.
- Hochschule
- Universität Siegen
- Veranstaltung
- Medienwissenschaften; Soziologie; Sozialpsychologie
- Note
- 1,5
- Autor
- Jana Elzner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 51
- Katalognummer
- V166948
- ISBN (Buch)
- 9783640832132
- ISBN (eBook)
- 9783640832613
- Dateigröße
- 746 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- aktuelle empirische Forschungsarbeit Lena Meyer-Landrut Parasoziale Beziehung Fantum Medien Soziologie Sozialpsychologie Faszination Star Medienstar Eurovision Song Contest Grand Prix Eurovision Fanverhalten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 25,99
- Arbeit zitieren
- Jana Elzner (Autor:in), 2010, Faszination Star. Das Phänomen der Lena Meyer-Landrut., München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/166948
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-