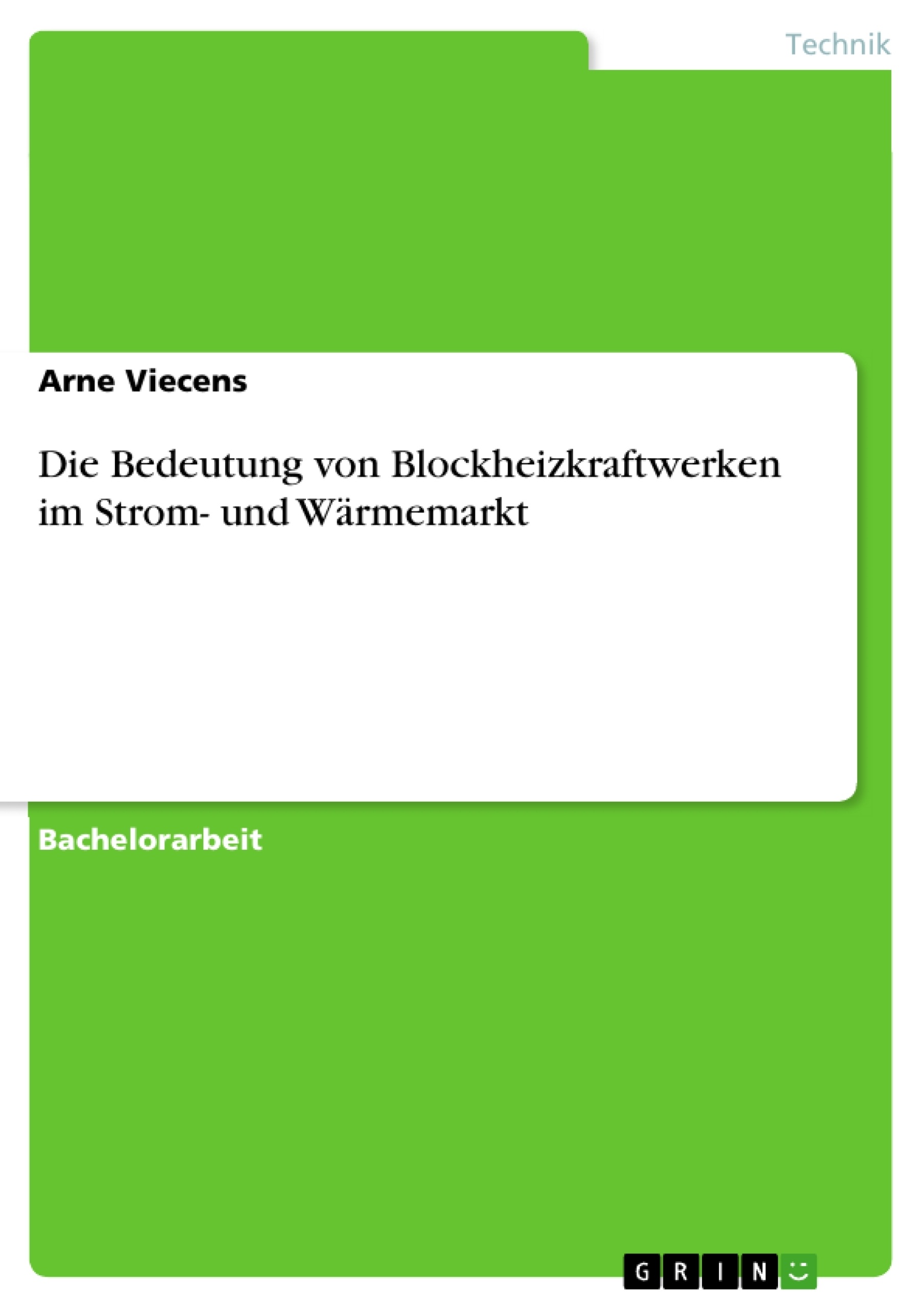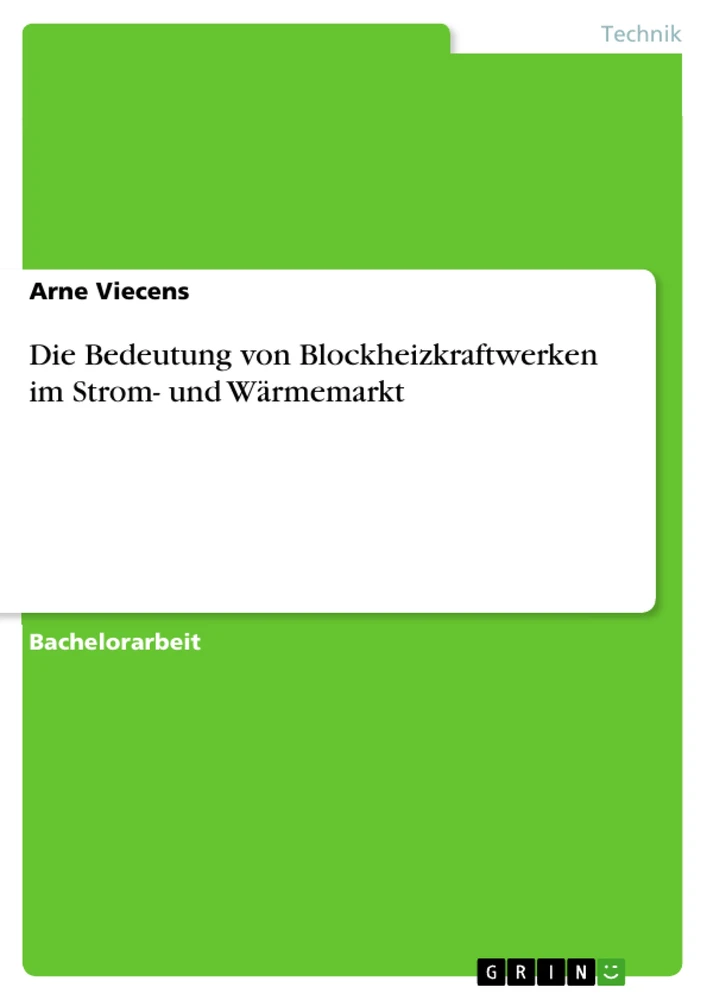
Die Bedeutung von Blockheizkraftwerken im Strom- und Wärmemarkt
Bachelorarbeit, 2010
49 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Energieverbrauch Deutschland
- 3. Strommarkt
- 4. Wärmemarkt
- 5. Fördermaßnahmen
- 5.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz
- 5.2 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
- 6. Kraft-Wärme-Kopplung
- 6.1 KWK-Techniken
- 6.1.1 Heizkraftwerke
- 6.1.2 Gasturbinen mit Abhitzenutzung
- 6.1.3 GuD-Anlagen
- 6.1 KWK-Techniken
- 7. Blockheizkraftwerke
- 7.1 Aufbau
- 7.1.1 Motorische Antriebe
- 7.1.2 Generatoren
- 7.1.3 Wärmetauscher
- 7.1.4 Überwachungssysteme
- 7.2 Brennstoffe
- 7.3 Abgas-Emissionsminderung
- 7.3.1 Oxidationskatalysatoren
- 7.3.2 Dreiwegekatalysatoren
- 7.3.3 Selektive katalytische Reduktion
- 7.3.4 Ruß- und Partikelfilter
- 7.4 Lärm-Emissionsschutz
- 7.1 Aufbau
- 8. Neue KWK-Technologien
- 8.1 Dampfmotoren
- 8.2 Stirlingmotoren
- 8.3 Brennstoffzellen
- 9. Praxisbeispiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Blockheizkraftwerken im Strom- und Wärmemarkt. Sie untersucht die Entwicklung des deutschen Energiemarktes im Kontext der Energiewende und der steigenden Bedeutung erneuerbarer Energien. Die Arbeit beleuchtet die Funktionsweise und die technischen Aspekte von Blockheizkraftwerken und analysiert deren Rolle bei der effizienten Nutzung von Energie und der Reduzierung von CO2-Emissionen.
- Entwicklung des deutschen Energiemarktes und die Rolle der Energiewende
- Funktionsprinzip und technische Aspekte von Blockheizkraftwerken
- Bedeutung von Blockheizkraftwerken für die effiziente Energieversorgung
- Reduzierung von CO2-Emissionen durch den Einsatz von Blockheizkraftwerken
- Fördermaßnahmen für Blockheizkraftwerke
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von Blockheizkraftwerken im Kontext der aktuellen Energiedebatte. Die Ölkrisen der 1970er Jahre und die Katastrophe in Tschernobyl werden als wichtige Meilensteine in der Entwicklung der erneuerbaren Energien vorgestellt. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und weitere Fördermaßnahmen werden als Reaktion auf die steigende Energiepreise und den Klimawandel diskutiert.
- 2. Energieverbrauch Deutschland: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Energieverbrauch in Deutschland und die Bedeutung verschiedener Energiequellen. Die Entwicklung des Energieverbrauchs und die Herausforderungen im Kontext der Energiewende werden beleuchtet.
- 3. Strommarkt: Das Kapitel analysiert den deutschen Strommarkt und die Bedeutung der Energiewende für diesen Sektor. Die verschiedenen Akteure und die aktuellen Entwicklungen im Strommarkt werden vorgestellt.
- 4. Wärmemarkt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Wärmemarkt in Deutschland und den verschiedenen Wärmequellen. Die Bedeutung der Energiewende für den Wärmemarkt und die Möglichkeiten der Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien werden untersucht.
- 5. Fördermaßnahmen: Das Kapitel beleuchtet die wichtigsten Fördermaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Funktionsweise und die Bedeutung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) werden diskutiert.
- 6. Kraft-Wärme-Kopplung: Dieses Kapitel erklärt das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und deren Vorteile. Die verschiedenen KWK-Techniken, wie Heizkraftwerke, Gasturbinen und GuD-Anlagen, werden vorgestellt und im Detail erläutert.
- 7. Blockheizkraftwerke: Dieses Kapitel befasst sich mit der Funktionsweise und dem Aufbau von Blockheizkraftwerken. Die verschiedenen Bestandteile, wie Motorische Antriebe, Generatoren, Wärmetauscher und Überwachungssysteme, werden erläutert. Die Auswahl der Brennstoffe, die Abgas-Emissionsminderung und der Lärm-Emissionsschutz werden ebenfalls behandelt.
- 8. Neue KWK-Technologien: Das Kapitel stellt neue KWK-Technologien, wie Dampfmotoren, Stirlingmotoren und Brennstoffzellen, vor und analysiert deren Potenzial im Hinblick auf Effizienz und Nachhaltigkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themenbereiche Energieverbrauch, Energiewende, Blockheizkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, erneuerbare Energien, CO2-Emissionen, Effizienzsteigerung, Fördermaßnahmen und neue Technologien. Die Analyse bezieht sich auf den deutschen Energiemarkt und die Relevanz von Blockheizkraftwerken für die effiziente und nachhaltige Energieversorgung.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert ein Blockheizkraftwerk (BHKW)?
Ein BHKW nutzt das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Ein Motor treibt einen Generator zur Stromerzeugung an, während die dabei entstehende Abwärme zum Heizen genutzt wird.
Warum sind BHKW ökologisch sinnvoll?
Durch die gleichzeitige Nutzung von Strom und Wärme erreichen sie einen sehr hohen Wirkungsgrad von über 90 %, was Primärenergie spart und CO2-Emissionen reduziert.
Welche Brennstoffe können in einem BHKW genutzt werden?
BHKW können mit fossilem Erdgas, aber auch mit erneuerbaren Energien wie Biogas, Pflanzenöl oder Biomethan betrieben werden.
Was regelt das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)?
Das KWKG fördert den Erhalt und Ausbau der KWK-Technologie durch Zuschläge für eingespeisten Strom, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu unterstützen.
Was sind neue Technologien im Bereich KWK?
Dazu zählen Stirlingmotoren, Dampfmotoren und insbesondere Brennstoffzellen, die auch für kleinere Wohneinheiten hocheffizient Strom und Wärme liefern können.
Details
- Titel
- Die Bedeutung von Blockheizkraftwerken im Strom- und Wärmemarkt
- Hochschule
- Europa-Universität Flensburg (ehem. Universität Flensburg)
- Note
- 1,3
- Autor
- Arne Viecens (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V167723
- ISBN (Buch)
- 9783640843039
- ISBN (eBook)
- 9783640846894
- Dateigröße
- 1053 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bedeutung blockheizkraftwerken strom- wärmemarkt
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Arne Viecens (Autor:in), 2010, Die Bedeutung von Blockheizkraftwerken im Strom- und Wärmemarkt, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/167723
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-