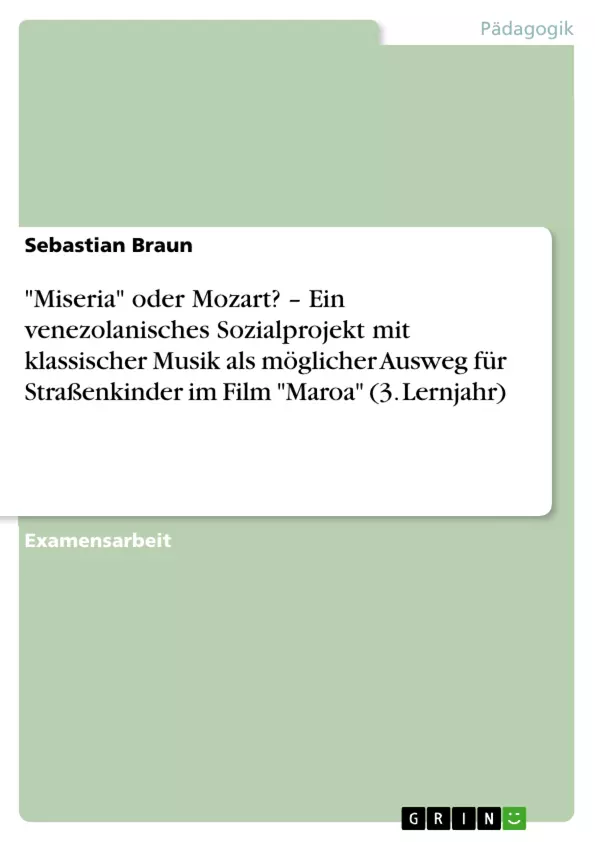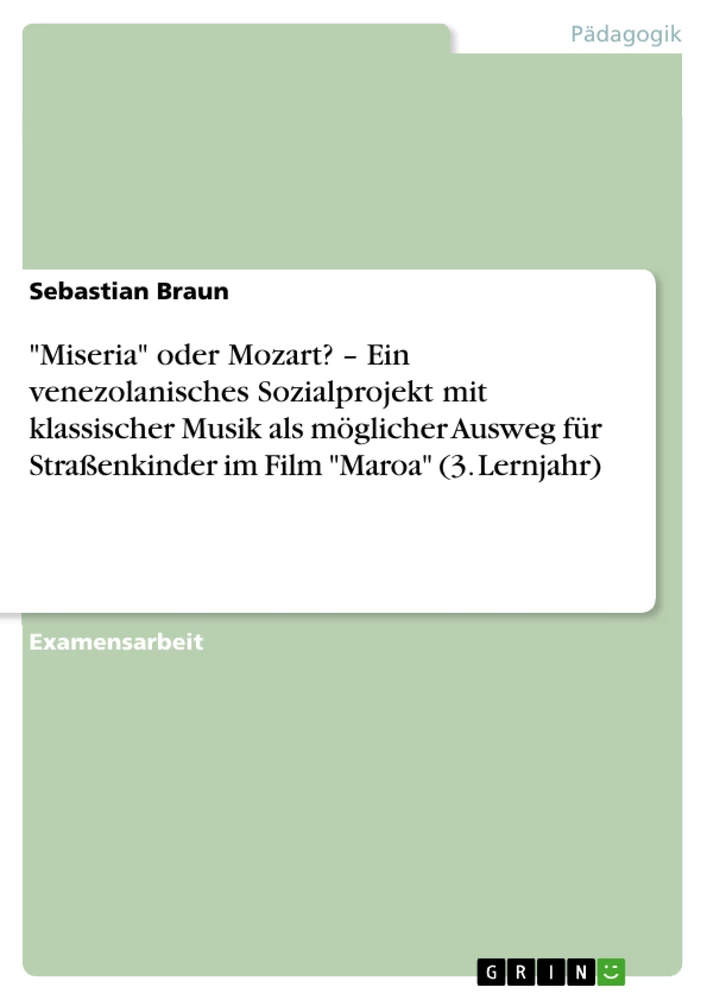
"Miseria" oder Mozart? – Ein venezolanisches Sozialprojekt mit klassischer Musik als möglicher Ausweg für Straßenkinder im Film "Maroa" (3. Lernjahr)
Examensarbeit, 2009
35 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretische Überlegungen zur Unterrichtseinheit
- Bedeutung der Landeskunde und von Filmen im Fremdsprachenunterricht
- Bezug zum Bildungsplan
- Emotionale Beteiligung am Filmgeschehen und Motivation
- Planung und Konzeption der Unterrichtseinheit
- Rahmenbedingungen und Klassensituation
- Aufbau und Inhalt
- Materialauswahl
- Auswahl der Methoden
- Arbeits- und Sozialformen
- Lernziele und Kompetenzen
- Durchführung der Unterrichtseinheit
- Übersicht über die gehaltenen Stunden
- Schematische Verlaufsübersicht und Vorstellung ausgewählter Einzelstunden
- Reflexion der Unterrichtseinheit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit dokumentiert eine Unterrichtseinheit für die zweite Staatsprüfung für den höheren Schuldienst an Gymnasien. Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit dem venezolanischen Sozialprojekt „El Sistema“, das Kindern aus sozial schwachen Milieus durch den Zugang zu klassischer Musik eine Perspektive eröffnet. Der Film „Maroa“ dient dabei als Grundlage für die Unterrichtsgestaltung.
- Die Bedeutung von Landeskunde und Filmen im Fremdsprachenunterricht
- Die Integration des Themas in den Bildungsplan
- Die Rolle von Emotionen und Motivation im Fremdsprachenlernen
- Die Darstellung von sozialer Ungleichheit und kulturellen Unterschieden in Venezuela
- Die Analyse von filmischen Elementen zur Förderung von Medienkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen klassischer Musik und dem Leben in venezolanischen Elendsvierteln und stellt „El Sistema“ als einen möglichen Ausweg für Straßenkinder vor. Kapitel 2 befasst sich mit theoretischen Überlegungen zur Bedeutung von Landeskunde und Filmen im Fremdsprachenunterricht. Der Bezug zum Bildungsplan und die Bedeutung von emotionaler Beteiligung am Filmgeschehen werden ebenfalls betrachtet. Kapitel 3 beinhaltet die Planung und Konzeption der Unterrichtseinheit, einschließlich der Rahmenbedingungen, des Aufbaus, der Materialien, Methoden, Arbeits- und Sozialformen sowie der Lernziele und Kompetenzen. In Kapitel 4 werden die einzelnen Unterrichtsstunden vorgestellt, wobei eine Doppelstunde und 4 Einzelstunden ausführlicher besprochen werden. Die Reflexion der gesamten Unterrichtseinheit rundet die Arbeit ab.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: El Sistema, Venezuela, Klassische Musik, Sozialprojekt, Straßenkinder, Film, Landeskunde, Fremdsprachenunterricht, Bildungsplan, Emotionen, Motivation, Medienkompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "El Sistema" in Venezuela?
Es ist ein 1975 von José Antonio Abreu gegründetes Sozialprojekt, das Kindern aus armen Verhältnissen kostenlosen Musikunterricht und Zugang zu Jugendorchestern bietet.
Worum geht es im Film "Maroa"?
Der Film dient als Unterrichtsgrundlage und zeigt das Leben eines Straßenkindes in Venezuela, das durch die Musik einen Ausweg aus Gewalt und Armut sucht.
Warum wird klassische Musik als Sozialprojekt genutzt?
Die Musikschulen (núcleos) fungieren als soziales Auffangbecken, fördern Disziplin und Selbstwertgefühl und bieten eine Alternative zur Barriokultur und Kriminalität.
Welche Rolle spielt die Landeskunde im Fremdsprachenunterricht?
Sie hilft Schülern, kulturelle Unterschiede und soziale Realitäten in spanischsprachigen Ländern wie Venezuela besser zu verstehen und fördert die Medienkompetenz.
Welche Musikstile dominieren den Alltag in Venezuela?
Neben Salsa und Merengue sind vor allem Vallenato und der bei Jugendlichen sehr populäre Reggaetón weit verbreitet.
Details
- Titel
- "Miseria" oder Mozart? – Ein venezolanisches Sozialprojekt mit klassischer Musik als möglicher Ausweg für Straßenkinder im Film "Maroa" (3. Lernjahr)
- Hochschule
- Staatl. Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymn), Tübingen
- Note
- 1,5
- Autor
- Sebastian Braun (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 35
- Katalognummer
- V167940
- ISBN (Buch)
- 9783640844814
- ISBN (eBook)
- 9783640848348
- Dateigröße
- 626 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- miseria mozart sozialprojekt musik ausweg straßenkinder film maroa lernjahr)
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Sebastian Braun (Autor:in), 2009, "Miseria" oder Mozart? – Ein venezolanisches Sozialprojekt mit klassischer Musik als möglicher Ausweg für Straßenkinder im Film "Maroa" (3. Lernjahr), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/167940
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-