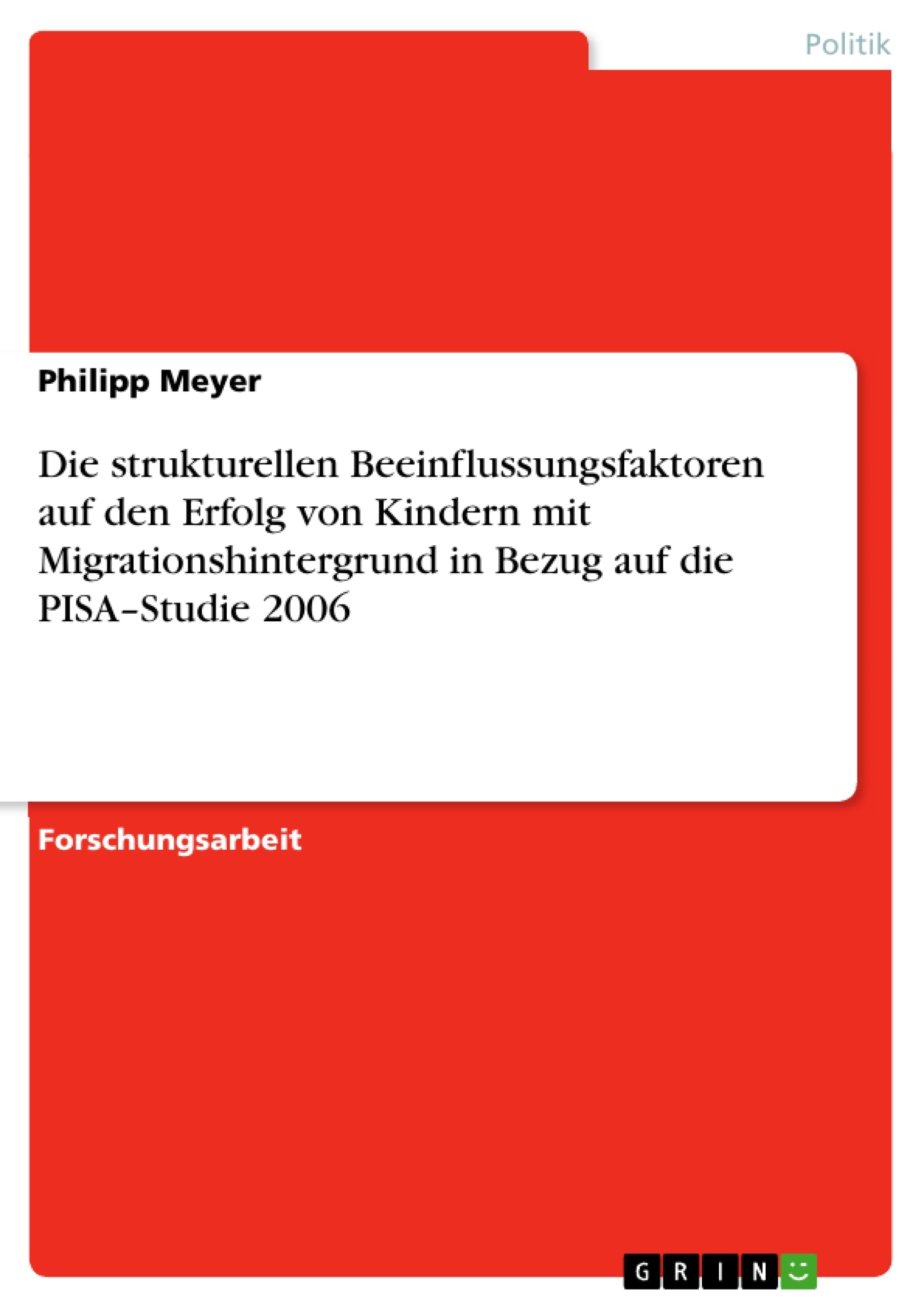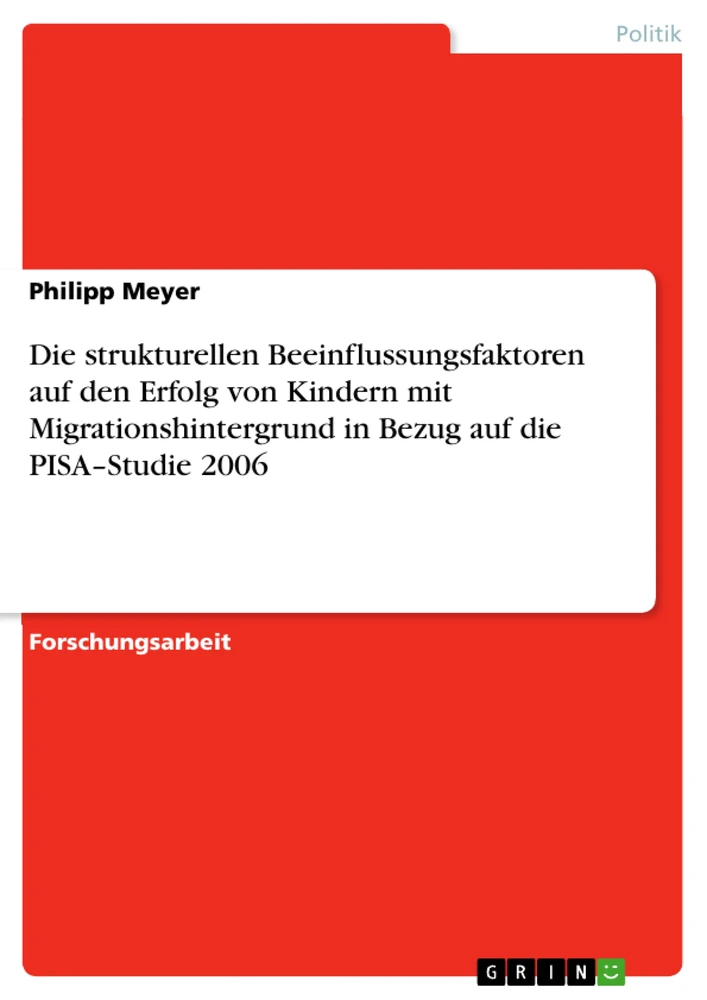
Die strukturellen Beeinflussungsfaktoren auf den Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die PISA–Studie 2006
Forschungsarbeit, 2009
44 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie als Ausgangspunkt der Untersuchung
- Definition des Begriffs „Migrationshintergrund“; Und die abhängigen Variablen
- Hintergrundfaktoren
- Historisch
- Ökonomisch
- Strukturell
- Finanzierung des Bildungssystems
- Öffentliche Ausgaben für Bildung
- Private Ausgaben für Bildung
- Ausprägungen des Schulsystems
- Erste Selektion der Schüler
- Ganztagsschulen
- Operationalisierung und Forschungsdesign
- Die PISA – Studie 2006 und die abhängigen Variablen
- Die unabhängigen Variablen im Einzelnen
- Hintergrundfaktoren
- Finanzierungsfaktoren
- Schulsystemfaktoren
- Forschungsdesign und Fallauswahl
- Die vergleichende Analyse als Endpunkt der Untersuchung
- Datenfunde und Datenprobleme
- Univariate Analyse
- Bivariate Analyse
- Multivariate Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht den Einfluss von strukturellen Faktoren auf den Erfolg von Schülern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die PISA-Studie 2006. Dabei geht es darum zu analysieren, inwieweit allgemeine Rahmenbedingungen, wie z.B. die Wirtschaftskraft, die Höhe der Bildungsausgaben oder die Struktur des Schulsystems, den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund beeinflussen.
- Der Einfluss von allgemeinen Rahmenbedingungen auf den Bildungserfolg von Migrantenkindern
- Die Analyse von strukturellen Faktoren, wie z.B. Wirtschaftskraft, Bildungsfinanzierung und Schulsystem
- Die Untersuchung der Ergebnisse der PISA-Studie 2006 im Kontext von Migrantenkindern
- Die Operationalisierung und statistische Analyse der erhobenen Daten
- Die Bewertung der Bedeutung der untersuchten Faktoren für den Bildungserfolg von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erklärt die Bedeutung von Bildungschancen für Migrantenkinder. Sie erläutert die Forschungsfrage, die sich auf die strukturellen Einflussfaktoren auf den Erfolg von Migrantenkindern in der PISA-Studie 2006 bezieht. Das zweite Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Untersuchung. Es werden die wichtigsten Begrifflichkeiten definiert, wie z.B. „Migrationshintergrund“ sowie die abhängigen Variablen, die auf den Ergebnissen der PISA-Studie 2006 basieren. Es werden drei Bereiche mit strukturellen Einflussfaktoren vorgestellt: Hintergrundfaktoren, Finanzierungsfaktoren und Schulsystemfaktoren. Im dritten Kapitel wird die Operationalisierung der Variablen und das Forschungsdesign der Arbeit vorgestellt. Es wird erläutert, wie die theoretischen Konzepte in messbare Werte umgesetzt werden und welche statistischen Methoden zur Analyse der Daten verwendet werden. Kapitel 4 beleuchtet die Ergebnisse der vergleichenden Analyse. Es werden die Ergebnisse der univariaten, bivariaten und multivariaten Analysen präsentiert. Im letzten Kapitel wird das Fazit der Arbeit gezogen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden zusammengefasst und es werden weitere Forschungsansätze vorgeschlagen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die strukturellen Beeinflussungsfaktoren auf den Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die PISA – Studie 2006. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher: Migrationshintergrund, PISA-Studie, Bildungserfolg, strukturelle Faktoren, Wirtschaftskraft, Bildungsfinanzierung, Schulsystem, Ganztagsschulen, Selektion, Urbanisierung, OECD-Länder.
Details
- Titel
- Die strukturellen Beeinflussungsfaktoren auf den Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die PISA–Studie 2006
- Hochschule
- Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaften)
- Veranstaltung
- Bildungs- und Hochschulpolitik im internationalen Vergleich
- Note
- 1,3
- Autor
- Philipp Meyer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V168517
- ISBN (eBook)
- 9783640881802
- ISBN (Buch)
- 9783640881871
- Dateigröße
- 742 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- beeinflussungsfaktoren erfolg kindern migrationshintergrund bezug pisa–studie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Philipp Meyer (Autor:in), 2009, Die strukturellen Beeinflussungsfaktoren auf den Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die PISA–Studie 2006, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/168517
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-