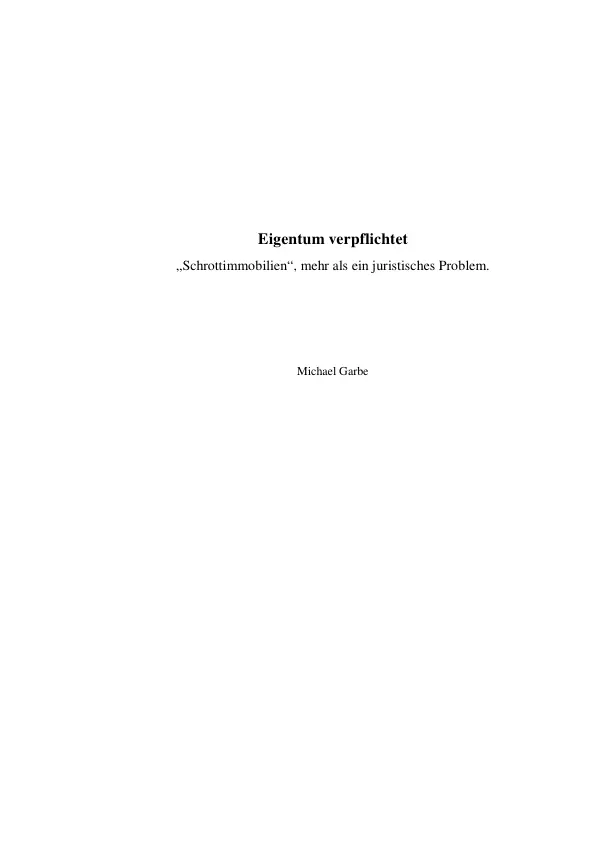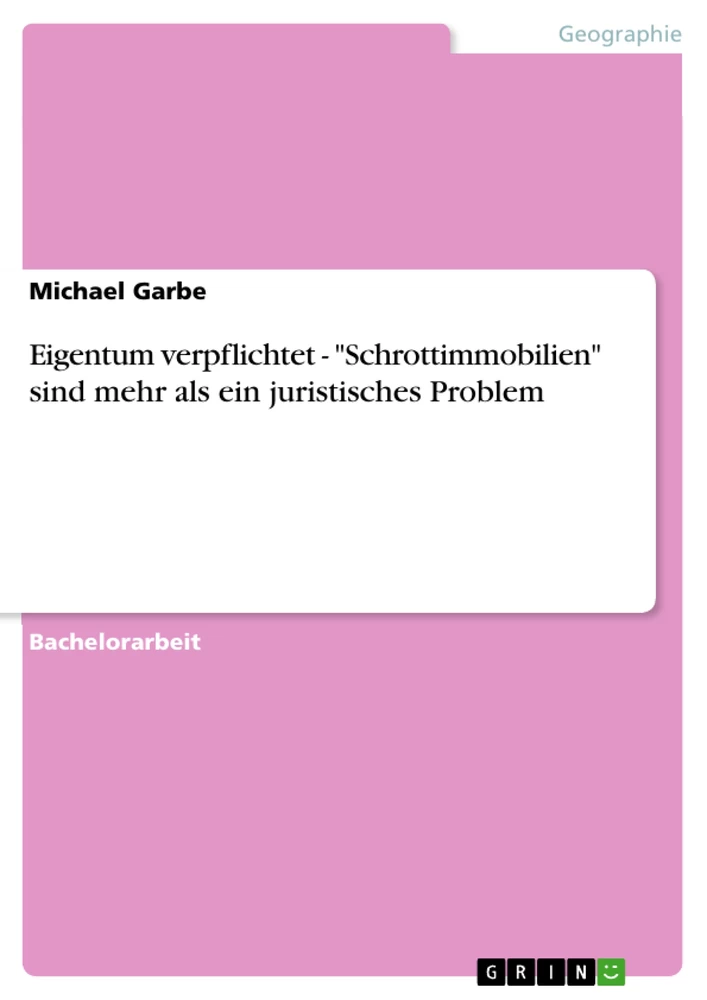
Eigentum verpflichtet - "Schrottimmobilien" sind mehr als ein juristisches Problem
Bachelorarbeit, 2010
44 Seiten, Note: 1,3
Geowissenschaften / Geographie - Bevölkerungsgeographie, Stadt- u. Raumplanung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Grundlage und Vorgehensweise der Arbeit
- 2.1 Eigentum verpflichtet
- 2.2 Qualitative Interviews
- 3 Ursachen und Folgen von Schrottimmobilien
- 3.1 Ursachen für die Entstehung von Schrottimmobilien
- 3.1.1 Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
- 3.1.2 Nichtkooperation Privater Eigentümer
- 3.1.3 Immobilienfonds und Immobilienbetrug
- 3.2 Folgen von Schrottimmobilien
- 3.2.1 Imageverlust
- 3.2.2 Erhöhter Kostenaufwand und schwindende öffentliche Einkünfte
- 3.2.3 Ghettoisierung
- 3.2.4 Gefahr für Leib und Leben
- 4 Bewertung der Gründe und Folgen in Bezug auf Artikel 14 II GG
- 5 Instrumente zum Umgang mit Schrottimmobilien
- 5.1 Bauplanungsrecht
- 5.1.1 Enteignung gemäß § 85 BauGB
- 5.1.2 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen gemäß §§ 136 ff. BauGB
- 5.1.3 Stadtumbaumaßnahmen gemäß §§ 171a ff BauGB
- 5.1.4 Die gemeindlichen Vorkaufsrechte nach § 24 und § 25 BauGB
- 5.1.5 Städtebauliche Gebote gemäß §§ 175 ff BauGB
- 5.2 Bauordnungsrecht
- 5.2.1 Abbruch- bzw. Beseitigungsanordnung
- 5.2.2 Anordnung von Sicherungsmaßnahmen
- 5.2.3 Anordnung von Instandsetzungsmaßnahmen
- 5.3 Denkmalrechtliche Eingriffsbefugnisse
- 5.3.1 Anordnung zur Erhaltung von Denkmälern
- 5.3.2 Anordnung zur Wiederherstellung von Denkmälern
- 6 Abschließende Bewertung
- 6.1 Bewertungen der Rechtsinstrumente
- 6.2 Strategien gegen verwahrloste Immobilien
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik von Schrottimmobilien in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die rechtlichen Möglichkeiten der Kommunen, diese zu bekämpfen. Es wird geprüft, ob die Entstehung von Schrottimmobilien eine Verletzung von Artikel 14 II GG ("Eigentum verpflichtet") darstellt und ob die bestehenden Rechtsinstrumente ausreichend sind. Die Arbeit verbindet theoretische Analyse mit empirischen Daten aus qualitativen Experteninterviews.
- Rechtliche Grundlagen und Eigentumsverpflichtungen (Art. 14 II GG)
- Ursachen für die Entstehung von Schrottimmobilien
- Folgen von Schrottimmobilien für Städte und Gemeinden
- Analyse bestehender Rechtsinstrumente im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
- Bewertung der Effektivität der Rechtsinstrumente in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung beschreibt das zunehmende Problem vernachlässigter Immobilien ("Schrottimmobilien") in deutschen Städten und deren negative Auswirkungen auf das Stadtbild und die Stadtentwicklung. Der Begriff "Schrottimmobilie" wird in seinen verschiedenen Bedeutungen erläutert, wobei der Fokus auf den baulichen Verfall und Leerstand liegt, über das rein juristische Verständnis hinausgehend. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Kommunen diese Immobilien nicht mit den vorhandenen Rechtsinstrumenten beseitigen und die zentrale Forschungsfrage nach der ausreichenden gesetzlichen Handhabe formuliert. Die Arbeit soll klären, ob eine Verletzung des Grundgesetzes vorliegt und ob die bestehenden Instrumente effektiv sind.
2 Grundlage und Vorgehensweise der Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt den hermeneutisch-empirischen Ansatz der Arbeit. Die hermeneutische Komponente befasst sich mit der rechtlichen Grundlage in Artikel 14 GG und analysiert die Ursachen und Folgen von Schrottimmobilien im Hinblick auf die Eigentumsverpflichtung. Die empirische Komponente stützt sich auf qualitative Experteninterviews, um die praktische Anwendbarkeit der Rechtsinstrumente zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Vorgehensweise und der methodischen Begründung. Es wird deutlich, dass der Schwerpunkt auf Privateigentum liegt und die Interviews in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden, die Ergebnisse jedoch auf bundesweiter Ebene interpretiert werden sollen.
3 Ursachen und Folgen von Schrottimmobilien: Dieses Kapitel untersucht ausführlich die Ursachen und Folgen von Schrottimmobilien. Es werden demografische Veränderungen, die mangelnde Kooperation von Eigentümern, Immobilienbetrug und die damit verbundenen Folgen wie Imageverlust, erhöhte Kosten für Kommunen, Ghettoisierung und Gefährdung von Leib und Leben detailliert beleuchtet. Die einzelnen Unterkapitel liefern einen umfassenden Überblick über die Faktoren, die zur Entstehung und Verschlimmerung des Problems beitragen.
4 Bewertung der Gründe und Folgen in Bezug auf Artikel 14 II GG: Dieses Kapitel analysiert die im Kapitel 3 dargestellten Ursachen und Folgen vor dem Hintergrund von Artikel 14 II GG. Es bewertet, inwiefern die Entstehung und der Bestand von Schrottimmobilien eine Verletzung der Eigentumsverpflichtung darstellen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Es wird die juristische Perspektive vertieft.
5 Instrumente zum Umgang mit Schrottimmobilien: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Rechtsinstrumente, die Kommunen zur Verfügung stehen, um mit Schrottimmobilien umzugehen. Es differenziert dabei zwischen Instrumenten des Bauplanungsrechts (Enteignung, Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbau etc.), des Bauordnungsrechts (Abbruch-, Sicherungs- und Instandsetzungsanordnungen) und des Denkmalrechts. Jedes Instrument wird detailliert erläutert und seine Anwendbarkeit in der Praxis wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Schrottimmobilien, Eigentum verpflichtet (Art. 14 II GG), Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Denkmalrecht, Kommunale Handlungsmöglichkeiten, Stadtentwicklung, Qualitative Interviews, Leerstand, Verfall, Ghettoisierung, Immobilienbetrug.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Umgang mit Schrottimmobilien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik von Schrottimmobilien in Deutschland. Sie untersucht die Ursachen und Folgen von vernachlässigten Immobilien, analysiert die rechtlichen Möglichkeiten der Kommunen, diese zu bekämpfen, und bewertet die Effektivität der bestehenden Rechtsinstrumente. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob die Entstehung von Schrottimmobilien eine Verletzung von Artikel 14 II GG (Eigentum verpflichtet) darstellt.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet einen hermeneutisch-empirischen Ansatz. Die hermeneutische Komponente analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Eigentumsverpflichtung. Die empirische Komponente basiert auf qualitativen Experteninterviews, um die praktische Anwendbarkeit der Rechtsinstrumente zu untersuchen. Die Interviews wurden in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, die Ergebnisse sollen aber bundesweit interpretiert werden.
Welche Ursachen für die Entstehung von Schrottimmobilien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Ursachen, darunter demografische Veränderungen in Deutschland, die Nichtkooperation privater Eigentümer, und Immobilienbetrug.
Welche Folgen von Schrottimmobilien werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet negative Folgen wie Imageverlust für die Stadt, erhöhte Kosten und schwindende öffentliche Einkünfte, Ghettoisierung und die Gefährdung von Leib und Leben.
Welche Rechtsinstrumente zur Bekämpfung von Schrottimmobilien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Rechtsinstrumente aus dem Bauplanungsrecht (Enteignung, Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbau, Vorkaufsrechte, städtebauliche Gebote), dem Bauordnungsrecht (Abbruch-, Sicherungs- und Instandsetzungsanordnungen) und dem Denkmalrecht (Anordnungen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Denkmälern).
Wie wird Artikel 14 II GG (Eigentum verpflichtet) in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit bewertet, inwieweit die Entstehung und der Bestand von Schrottimmobilien eine Verletzung der Eigentumsverpflichtung nach Artikel 14 II GG darstellen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit bewertet die Effektivität der analysierten Rechtsinstrumente und entwickelt Strategien zur Bekämpfung von Schrottimmobilien. Sie kommt zu einem Fazit, welches die Ergebnisse zusammenfasst und weitere Forschungsfragen aufwirft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schrottimmobilien, Eigentum verpflichtet (Art. 14 II GG), Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Denkmalrecht, Kommunale Handlungsmöglichkeiten, Stadtentwicklung, Qualitative Interviews, Leerstand, Verfall, Ghettoisierung, Immobilienbetrug.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Grundlage und Vorgehensweise der Arbeit, Ursachen und Folgen von Schrottimmobilien, Bewertung der Gründe und Folgen in Bezug auf Artikel 14 II GG, Instrumente zum Umgang mit Schrottimmobilien, Abschließende Bewertung und Fazit. Jedes Kapitel ist detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgelistet.
Details
- Titel
- Eigentum verpflichtet - "Schrottimmobilien" sind mehr als ein juristisches Problem
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum (Geographisches Institut)
- Note
- 1,3
- Autor
- Michael Garbe (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V169762
- ISBN (Buch)
- 9783640893188
- ISBN (eBook)
- 9783640893263
- Dateigröße
- 558 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- eigentum schrottimmobilien Stadtplanung verwahrloste Immobilien Bauplanung Bauordnung Denkmalschutz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Michael Garbe (Autor:in), 2010, Eigentum verpflichtet - "Schrottimmobilien" sind mehr als ein juristisches Problem, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/169762
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-