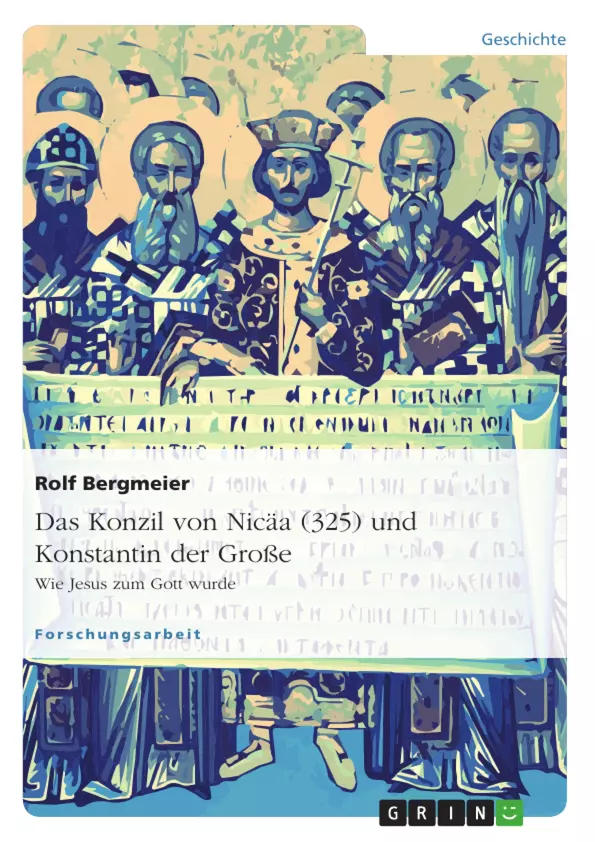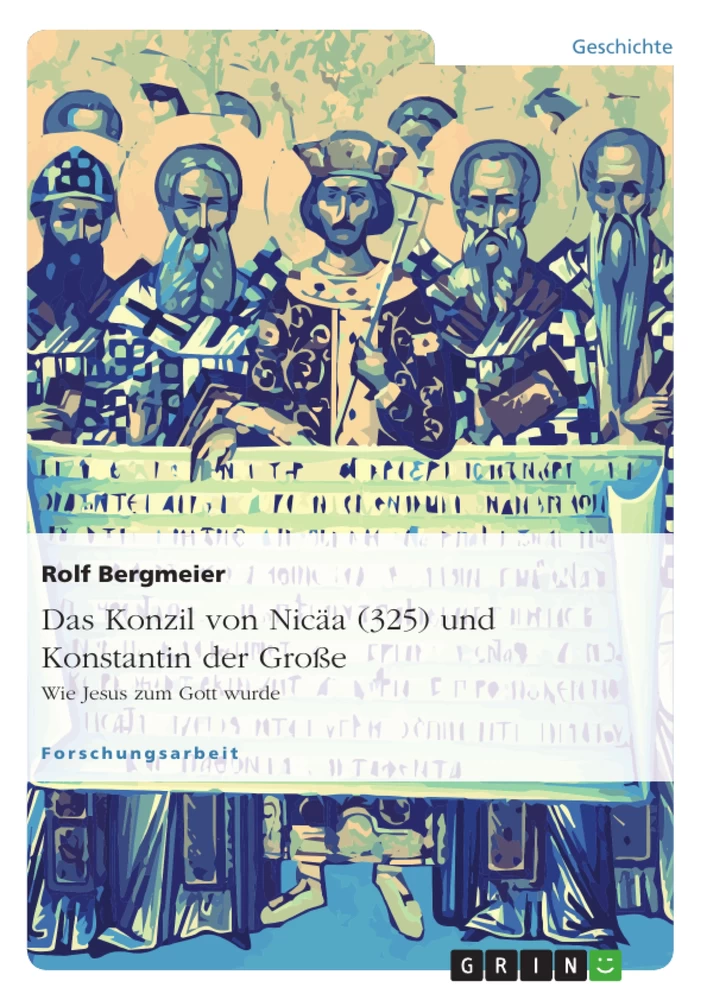
Das Konzil von Nicäa (325) und Konstantin der Große
Forschungsarbeit, 2011
27 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzil
- Der historische Rahmen
- Der religiöse Hintergrund
- Die Rolle des „Papstes“
- Konstantin, ein christlicher Pontifex maximus?
- Der Verlauf des Konzils
- Bewertung und Folgen
- Konstantin, Christ, Heide oder Ketzer?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie untersucht den Verdacht, dass Kaiser Konstantin, der das erste ökumenische Konzil der Christen im Jahre 325 leitete, die umstrittene Gottesformel „Wesensgleichheit“ durchsetzte. Sie analysiert die Rolle Konstantins im Kontext der religiösen und politischen Entwicklungen der Zeit und beleuchtet die Frage, ob er ein Christ, ein Heide oder ein Ketzer war.
- Die historische und religiöse Situation vor dem Konzil von Nicäa
- Die Rolle Konstantins und seine Einflussnahme auf das Konzil
- Die Bedeutung der „Wesensgleichheit“ für die christliche Theologie
- Die Folgen des Konzils von Nicäa für die Entwicklung des Christentums
- Die Frage nach Konstantins persönlicher Religiosität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Studie dar: Wie wurde Jesus zum Gott? Sie führt in den historischen Kontext ein und erklärt die Bedeutung der „Wesensgleichheit“ im christlichen Glauben.
Das Konzil
Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und religiösen Rahmen des Konzils von Nicäa. Es analysiert die Rolle Konstantins, die Position des „Papstes“ sowie den Verlauf des Konzils.
Bewertung und Folgen
Dieses Kapitel widmet sich der Bewertung des Konzils von Nicäa und seinen Folgen für die Entwicklung des Christentums. Es untersucht die Auswirkungen der „Wesensgleichheit“ auf den christlichen Glauben und die Rolle der Kirche im Römischen Reich.
Konstantin, Christ, Heide oder Ketzer?
Dieses Kapitel beleuchtet die Frage nach Konstantins persönlicher Religiosität. Es analysiert seine Rolle als Kaiser und seine Beziehung zum Christentum.
Schlüsselwörter
Die Studie befasst sich mit zentralen Themen wie dem Christentum im 4. Jahrhundert, dem Konzil von Nicäa, der „Wesensgleichheit“, der Rolle Konstantins, dem Verhältnis von Kirche und Staat sowie der Frage nach der persönlichen Religiosität Konstantins.
Details
- Titel
- Das Konzil von Nicäa (325) und Konstantin der Große
- Untertitel
- Wie Jesus zum Gott wurde
- Autor
- M.A. Rolf Bergmeier (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 27
- Katalognummer
- V170202
- ISBN (eBook)
- 9783640889181
- ISBN (Buch)
- 9783640889525
- Dateigröße
- 2283 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- konzil nicäa konstantin 325 Arius homoousios trinität Gottessohn
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- M.A. Rolf Bergmeier (Autor:in), 2011, Das Konzil von Nicäa (325) und Konstantin der Große, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/170202
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-