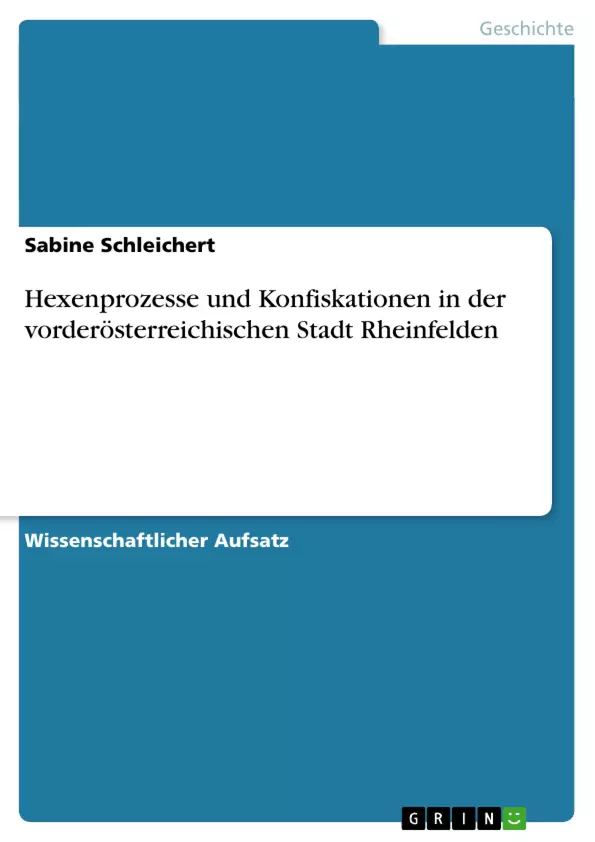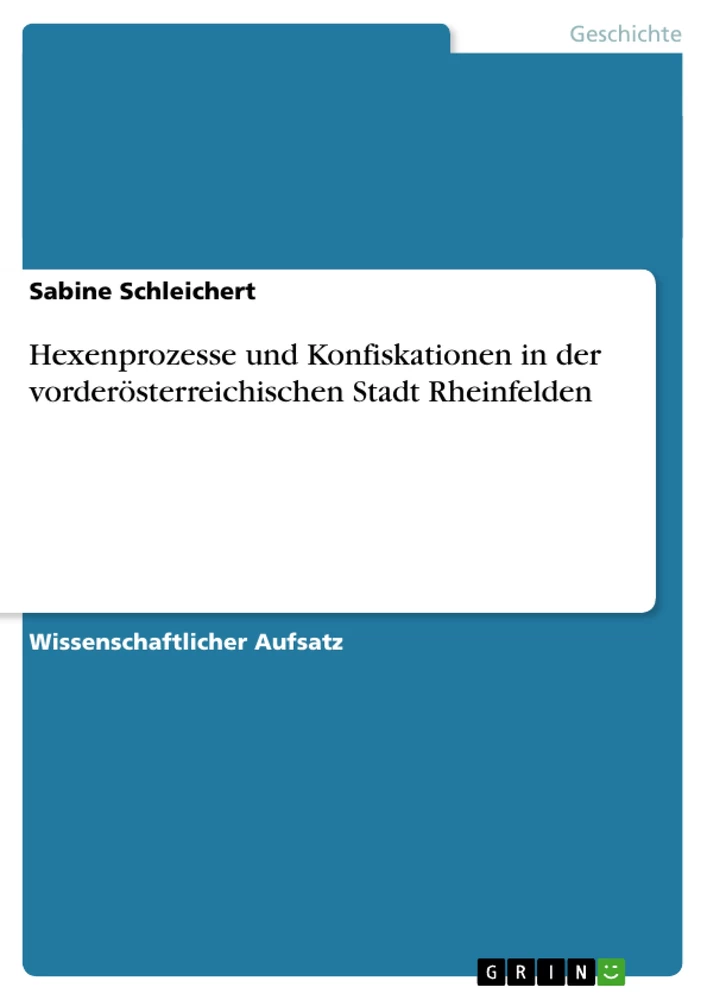
Hexenprozesse und Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden
Wissenschaftlicher Aufsatz, 1995
35 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Hexenprozesse und Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden
- Der Anteil der österreichischen Vorlande an den Hexenprozessen
- Verwaltungsorganisation und Hochgerichtsbarkeit
- Hexenprozesse in Rheinfelden
- Die große Prozeßwelle von 1611-1617
- Folgen und Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hexenprozesse und die damit verbundenen Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden im 16. und 17. Jahrhundert. Ziel ist es, den Ablauf und die Charakteristika dieser Prozesse zu beschreiben und die Hintergründe und Zusammenhänge zu beleuchten.
- Der Anteil Vorderösterreichs an der Hexenverfolgung im Südwesten Deutschlands
- Die Rolle der lokalen Adelsgeschlechter und Städte bei der Durchführung der Prozesse
- Der Zusammenhang zwischen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen und der Intensität der Hexenverfolgung
- Die Verfahren und Praktiken der Hexenprozesse in Rheinfelden
- Die Folgen der Prozesse, insbesondere die Vermögenskonfiskationen
Zusammenfassung der Kapitel
Hexenprozesse und Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Herausforderungen bei der Erforschung der Hexenprozesse in Vorderösterreich aufgrund der zersplitterten Archivbestände. Es stellt die Stadt Rheinfelden als Fallbeispiel vor und beschreibt ihren rechtlichen Status und ihre wirtschaftliche Bedeutung. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der lokalen Gerichtsbarkeit und der Habsburger im Kontext der Hexenprozesse.
Der Anteil der österreichischen Vorlande an den Hexenprozessen: Dieses Kapitel diskutiert den bisher unzureichend beachteten Beitrag Vorderösterreichs zur Hexenverfolgung im Südwesten Deutschlands. Es analysiert die administrative Struktur und die Zuständigkeiten in Bezug auf die Hochgerichtsbarkeit und verdeutlicht, dass die Habsburger vor allem die Steuer- und Militärhoheit besaßen, während die tatsächliche Durchführung der Prozesse in den Händen lokaler Akteure lag. Die Herausforderungen der Quellenlage werden betont.
Hexenprozesse in Rheinfelden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Hexenprozesse in Rheinfelden, beginnend mit den ersten Prozessen im Jahr 1545. Es analysiert die typischen Elemente der damaligen Hexenlehre, die in den Geständnissen auftauchen, und hebt die Perioden erhöhter Aktivität der Hexenverfolgung hervor. Die wohlhabendste der vier österreichischen Waldstädte wird in ihrer wirtschaftlichen Lage und ihrer Nähe zu wichtigen Handelswegen skizziert.
Die große Prozeßwelle von 1611-1617: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die intensive Hexenverfolgung in Rheinfelden und der umliegenden Herrschaft zwischen 1611 und 1617. Es wird der Zusammenhang zwischen dieser Prozeßwelle und einer Häufung von Krisen wie Pest, Missernten, Hungersnöten und hohen Steuern untersucht. Die Reaktion der Bevölkerung, besonders der Bauern, auf diese Situation und deren Anschuldigungen gegen die Obrigkeit werden detailliert dargelegt. Die Beschwerdeschrift der Bauern von 1612 wird als zentrales Dokument analysiert.
Schlüsselwörter
Hexenprozesse, Vorderösterreich, Rheinfelden, Habsburger, Hochgerichtsbarkeit, Konfiskation, Hexenlehre, Teufelspakt, Krisen, Pest, Missernten, Bauernunruhen, Vermögenskonfiskation, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Hexenprozesse und Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Hexenprozesse und die damit verbundenen Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden im 16. und 17. Jahrhundert. Sie beschreibt den Ablauf und die Charakteristika dieser Prozesse und beleuchtet die Hintergründe und Zusammenhänge.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Anteil Vorderösterreichs an der Hexenverfolgung im Südwesten Deutschlands, die Rolle des lokalen Adels und der Städte, den Zusammenhang zwischen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen und der Hexenverfolgung, die Verfahren und Praktiken der Prozesse in Rheinfelden und die Folgen der Prozesse, insbesondere die Vermögenskonfiskationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu den Hexenprozessen und Konfiskationen in Rheinfelden, dem Anteil Vorderösterreichs an den Hexenprozessen, der Verwaltungsorganisation und Hochgerichtsbarkeit, den Hexenprozessen in Rheinfelden, der großen Prozesswelle von 1611-1617 und den Folgen und Auswirkungen.
Was wird im Kapitel "Hexenprozesse und Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden" behandelt?
Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, erläutert die Herausforderungen bei der Erforschung der Hexenprozesse in Vorderösterreich und stellt Rheinfelden als Fallbeispiel vor. Es beschreibt den rechtlichen Status und die wirtschaftliche Bedeutung Rheinfeldens und hebt die Rolle der lokalen Gerichtsbarkeit und der Habsburger hervor.
Was wird im Kapitel "Der Anteil der österreichischen Vorlande an den Hexenprozessen" behandelt?
Dieses Kapitel diskutiert den Beitrag Vorderösterreichs zur Hexenverfolgung im Südwesten Deutschlands, analysiert die administrative Struktur und Zuständigkeiten bezüglich der Hochgerichtsbarkeit und betont die Herausforderungen der Quellenlage. Es verdeutlicht, dass die Habsburger vor allem die Steuer- und Militärhoheit besaßen, während die Durchführung der Prozesse in den Händen lokaler Akteure lag.
Was wird im Kapitel "Hexenprozesse in Rheinfelden" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Hexenprozesse in Rheinfelden ab 1545, analysiert typische Elemente der Hexenlehre in den Geständnissen und hebt Perioden erhöhter Aktivität hervor. Es skizziert die wirtschaftliche Lage Rheinfeldens und seine Nähe zu wichtigen Handelswegen.
Was wird im Kapitel "Die große Prozesswelle von 1611-1617" behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die intensive Hexenverfolgung in Rheinfelden zwischen 1611 und 1617. Es untersucht den Zusammenhang zwischen dieser Prozesswelle und Krisen wie Pest, Missernten und hohen Steuern und analysiert die Reaktion der Bevölkerung, insbesondere der Bauern, und deren Anschuldigungen gegen die Obrigkeit. Die Beschwerdeschrift der Bauern von 1612 wird als zentrales Dokument analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Hexenprozesse, Vorderösterreich, Rheinfelden, Habsburger, Hochgerichtsbarkeit, Konfiskation, Hexenlehre, Teufelspakt, Krisen, Pest, Missernten, Bauernunruhen, Vermögenskonfiskation, Quellenkritik.
Details
- Titel
- Hexenprozesse und Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden
- Autor
- Sabine Schleichert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1995
- Seiten
- 35
- Katalognummer
- V17197
- ISBN (eBook)
- 9783638218276
- Dateigröße
- 505 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Autorin ist Berufsgenealogin und Historikerin.
- Schlagworte
- Hexenprozesse Konfiskationen Rheinfelden Vorderösterreich Hexen Hexenverfolgung Thema Hexenverfolgung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Arbeit zitieren
- Sabine Schleichert (Autor:in), 1995, Hexenprozesse und Konfiskationen in der vorderösterreichischen Stadt Rheinfelden, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/17197
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-