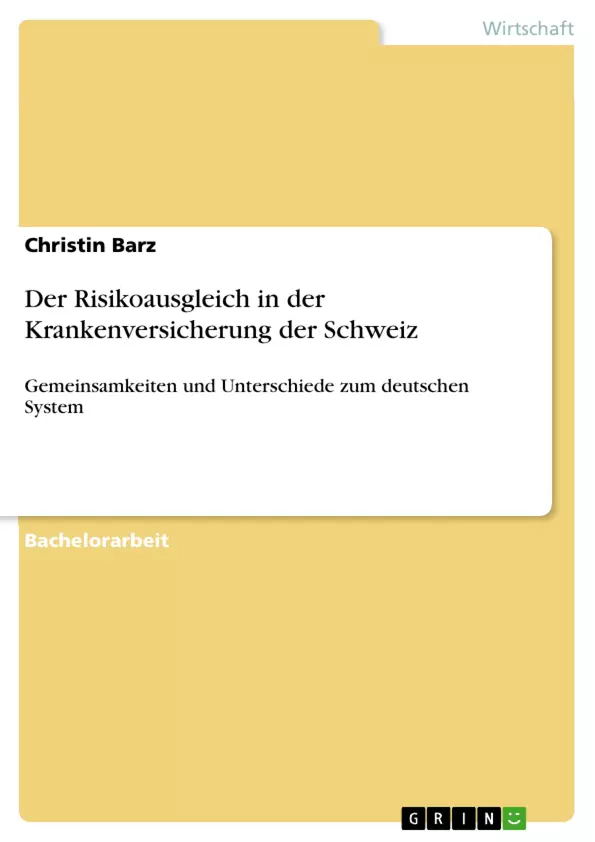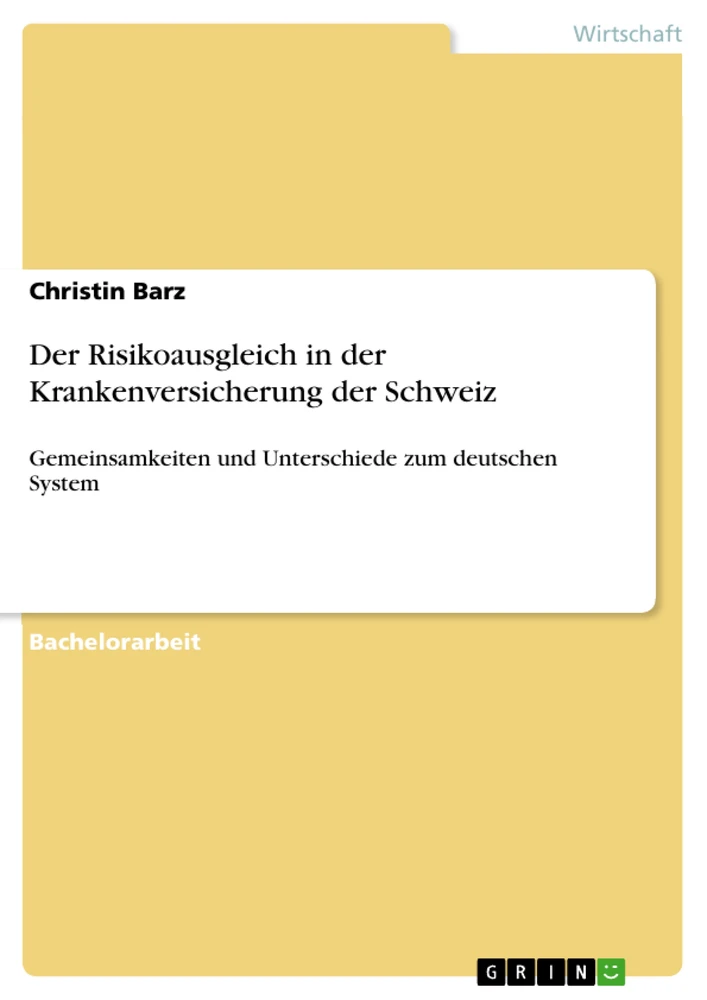
Der Risikoausgleich in der Krankenversicherung der Schweiz
Bachelorarbeit, 2011
44 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das System der Krankenversicherung der Schweiz
- 2.1. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung
- 2.2. Die Finanzierung und das Leistungsangebot der OKP
- 2.3. Die Zusatzversicherung
- 2.4. Übersicht über die Versicherungslandschaft der Schweiz
- 3. Wozu benötigt man einen Risikoausgleich?
- 4. Der Risikoausgleich in der Krankenversicherung der Schweiz
- 4.1. Die Einführung des Risikoausgleiches
- 4.2. Status Quo
- 4.3. Die Problematik in der derzeitigen Ausgestaltung des Risikoausgleichs
- 4.4. Der reformierte Risikoausgleich ab 2012
- 4.5. Zukünftige Entwicklungstendenzen
- 5. Der Risikostrukturausgleich in der deutschen Krankenversicherung
- 5.1. Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland
- 5.2. Die Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs in Deutschland
- 6. Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Risikoausgleichs der Schweiz zum deutschen Risikostrukturausgleich
- 7. Können beide Länder voneinander lernen?
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Risikoausgleich in der schweizerischen Krankenversicherung und vergleicht ihn mit dem deutschen System. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und potentielle Lernmöglichkeiten für beide Länder zu identifizieren. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Risikoausgleichs in der Schweiz, beleuchtet aktuelle Herausforderungen und diskutiert zukünftige Trends.
- Entwicklung des Risikoausgleichs in der Schweiz
- Finanzierung und Leistungsangebot der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)
- Vergleich des schweizerischen und deutschen Systems des Risikoausgleichs
- Herausforderungen und Problematiken des Risikoausgleichs
- Potenziale für zukünftige Entwicklungen und den Ländervergleich
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den stetigen Anstieg der Gesundheitsausgaben in der Schweiz und im weltweiten Vergleich, wobei die demografische Entwicklung und der medizinische Fortschritt als Hauptfaktoren genannt werden. Sie führt in die Thematik des Risikoausgleichs ein und benennt die Notwendigkeit dessen im Kontext von Risikoselektion auf Krankenversicherungsmärkten. Die Arbeit fokussiert auf den Vergleich des schweizerischen und deutschen Systems.
2. Das System der Krankenversicherung der Schweiz: Dieses Kapitel beschreibt das schweizerische Krankenversicherungssystem, mit Fokus auf die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP), ihre Finanzierung, das Leistungsangebot und die Zusatzversicherungen. Es bietet einen Überblick über die Versicherungslandschaft und legt den Grundstein für das Verständnis des Risikoausgleichs im schweizerischen Kontext.
3. Wozu benötigt man einen Risikoausgleich?: Dieses Kapitel begründet die Notwendigkeit eines Risikoausgleichs, indem es die Problematik der Risikoselektion durch Krankenversicherer erläutert. Es wird dargelegt, warum ein Ausgleichssystem notwendig ist, um ein funktionierendes und gerechtes Krankenversicherungssystem zu gewährleisten und einer Benachteiligung von Risikogruppen entgegenzuwirken.
4. Der Risikoausgleich in der Krankenversicherung der Schweiz: Dieses Kapitel analysiert den Risikoausgleich in der Schweiz, beginnend mit seiner Einführung, über den Status Quo bis hin zu den geplanten Reformen ab 2012 und zukünftigen Entwicklungstendenzen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Problematiken der bestehenden Ausgestaltung und beschreibt detailliert die Mechanismen des Risikoausgleichs.
5. Der Risikostrukturausgleich in der deutschen Krankenversicherung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem deutschen System der gesetzlichen Krankenversicherung und dessen Risikostrukturausgleich. Es beschreibt die Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs in Deutschland und liefert somit die Grundlage für den anschließenden Vergleich mit dem schweizerischen System.
6. Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Risikoausgleichs der Schweiz zum deutschen Risikostrukturausgleich: In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem schweizerischen Risikoausgleich und dem deutschen Risikostrukturausgleich umfassend verglichen und analysiert. Die strukturellen, finanziellen und politischen Aspekte werden im Detail gegenübergestellt.
7. Können beide Länder voneinander lernen?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens zwischen der Schweiz und Deutschland im Bereich des Risikoausgleichs. Es werden konkrete Beispiele und Potenziale für Verbesserungen und Optimierungen in beiden Systemen diskutiert.
Schlüsselwörter
Risikoausgleich, Krankenversicherung, Schweiz, Deutschland, obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP), Risikostrukturausgleich, Gesundheitswesen, Gesundheitsausgaben, Risikoselektion, Gesundheitsökonomik, Gesundheitspolitik, Reform, Finanzierung, Leistungsangebot, Ländervergleich.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Risikoausgleich im Vergleich Schweiz-Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Risikoausgleich in der schweizerischen Krankenversicherung und vergleicht ihn mit dem deutschen System. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und potentielle Lernmöglichkeiten für beide Länder zu identifizieren. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Risikoausgleichs in der Schweiz, beleuchtet aktuelle Herausforderungen und diskutiert zukünftige Trends.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Risikoausgleichs in der Schweiz, die Finanzierung und das Leistungsangebot der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP), einen detaillierten Vergleich des schweizerischen und deutschen Systems, die Herausforderungen und Problematiken des Risikoausgleichs sowie Potenziale für zukünftige Entwicklungen und den Ländervergleich. Sie beinhaltet eine umfassende Beschreibung des schweizerischen und deutschen Krankenversicherungssystems.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, das schweizerische Krankenversicherungssystem (inkl. OKP, Finanzierung und Zusatzversicherungen), die Notwendigkeit eines Risikoausgleichs, den Risikoausgleich in der Schweiz (inkl. Einführung, Status Quo, Reformen und zukünftige Trends), den Risikostrukturausgleich in der deutschen Krankenversicherung, einen Vergleich beider Systeme, die Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens und eine Schlussbetrachtung.
Was wird unter Risikoausgleich verstanden?
Der Risikoausgleich zielt darauf ab, die Ungleichgewichte im Gesundheitswesen auszugleichen, die durch Risikoselektion entstehen. Krankenversicherer könnten sonst tendenziell gesunde Personen bevorzugen, was zu Benachteiligung von Risikogruppen führt. Ein funktionierendes und gerechtes Krankenversicherungssystem benötigt daher einen Ausgleich.
Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen zwischen dem schweizerischen und deutschen System?
Die Arbeit analysiert detailliert die strukturellen, finanziellen und politischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen dem schweizerischen Risikoausgleich und dem deutschen Risikostrukturausgleich. Dieser Vergleich bildet einen zentralen Bestandteil der Arbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Potenziale für zukünftige Entwicklungen und den gegenseitigen Lerneffekt zwischen der Schweiz und Deutschland im Bereich des Risikoausgleichs. Konkrete Beispiele und Optimierungspotenziale werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Risikoausgleich, Krankenversicherung, Schweiz, Deutschland, obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP), Risikostrukturausgleich, Gesundheitswesen, Gesundheitsausgaben, Risikoselektion, Gesundheitsökonomik, Gesundheitspolitik, Reform, Finanzierung, Leistungsangebot, Ländervergleich.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem Gesundheitswesen, der Krankenversicherung und dem Risikoausgleich in der Schweiz und Deutschland befassen, einschließlich Studierender, Wissenschaftler, Politikern und Fachleuten im Gesundheitssektor.
Details
- Titel
- Der Risikoausgleich in der Krankenversicherung der Schweiz
- Untertitel
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum deutschen System
- Hochschule
- Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Institut für Management öffentlicher Aufgaben Betriebswirtschaftslehre des öffentlichen Bereichs und Gesundheitswesen)
- Note
- 1,0
- Autor
- Christin Barz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V172237
- ISBN (Buch)
- 9783640920389
- ISBN (eBook)
- 9783640920488
- Dateigröße
- 626 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Risikoausgleich Risikostrukturausgleich obligatorische Krankenpflegeversicherung gesetzliche Krankenversicherung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Christin Barz (Autor:in), 2011, Der Risikoausgleich in der Krankenversicherung der Schweiz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/172237
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-