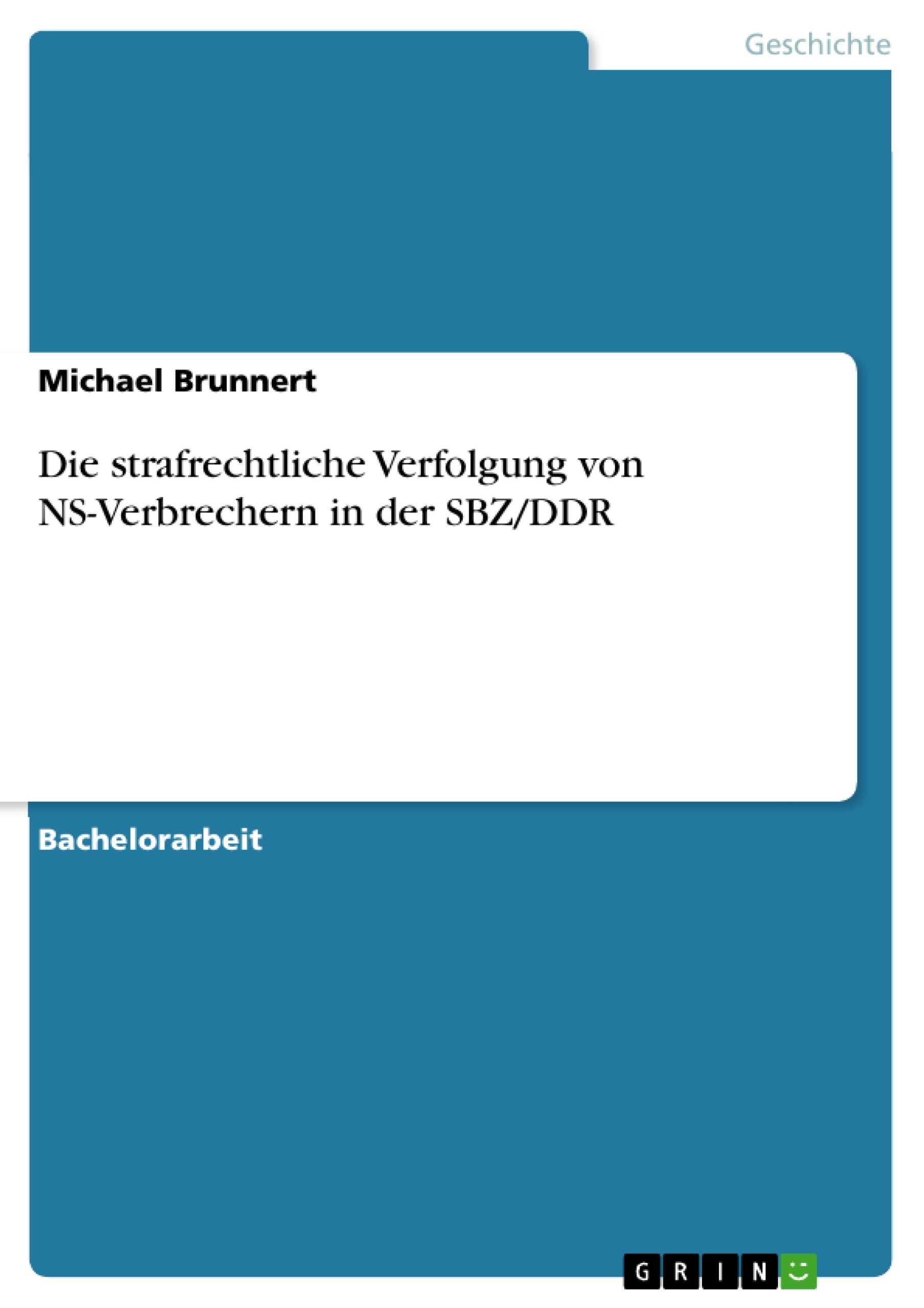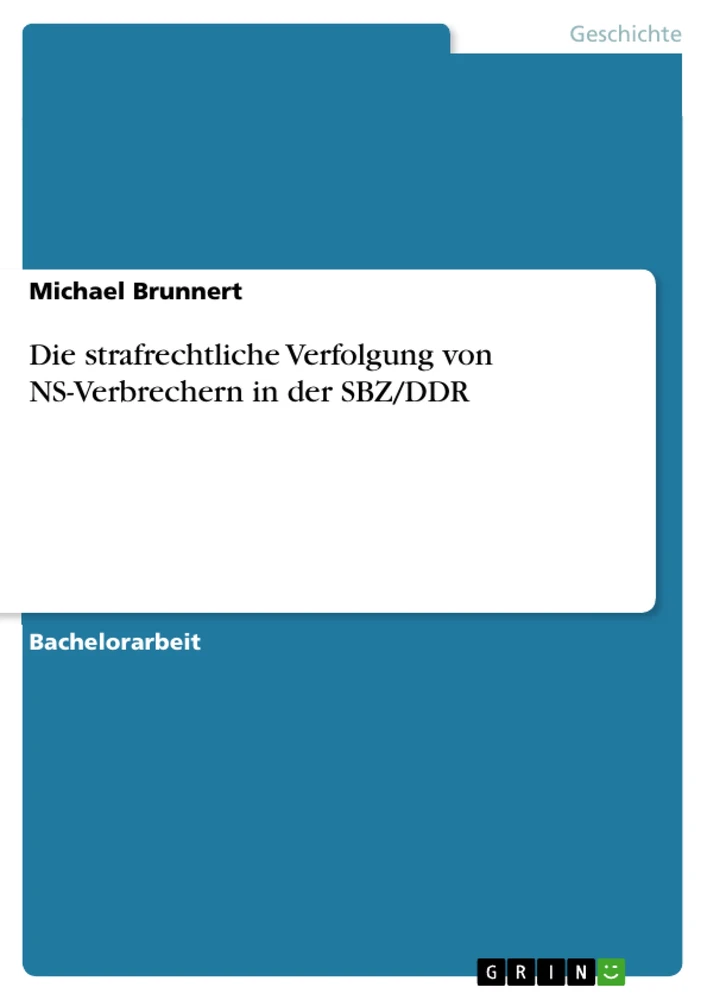
Die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechern in der SBZ/DDR
Bachelorarbeit, 2009
32 Seiten
Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grundlagen alliierter Entnazifizierungspolitik
- Erste Phase, bis August 1947
- Internierungspraxis in der SBZ
- Zweite Phase, ab August 1947 (Der Befehl 201)
- Die Waldheimer Prozesse
- Umgang mit der NS-Vergangenheit nach Waldheim
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechern in der SBZ/DDR und analysiert, wie die angewandten Methoden im Kontext der Entnazifizierung rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprachen. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Entwicklung der Strafverfolgung in der SBZ/DDR, wobei ein Vergleich mit der Strafverfolgung in der Bundesrepublik Deutschland nur marginal betrachtet werden kann.
- Die Entwicklung der Entnazifizierungspolitik in der SBZ/DDR
- Die Unterschiede in den Methoden der Strafverfolgung zwischen den Besatzungszonen
- Die Instrumentalisierung der Entnazifizierung im Kalten Krieg
- Die Bewertung der Strafverfolgung von NS-Verbrechern in Bezug auf ihre intendierten Ziele und die tatsächliche Vorgehensweise
- Die Herausforderungen und Grenzen der Forschung aufgrund des begrenzten Zugriffs auf sowjetische Archive
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Die Arbeit beleuchtet das Desinteresse und die Unkenntnis in der deutschen Bevölkerung bezüglich der DDR-Vergangenheit, insbesondere der strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechern. Sie identifiziert verschiedene Interpretationsströmungen der DDR-Geschichte, darunter „Ostalgie“ und die Bewertung der Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte.
- Grundlagen alliierter Entnazifizierungspolitik: Das Kapitel beschreibt die gemeinsamen Ziele der alliierten Mächte im Umgang mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Bestrafung von Kriegs- und NS-Verbrechern. Es zeichnet die ersten Schritte der Täterklassifizierung und die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie nach.
Schlüsselwörter
Entnazifizierung, Strafverfolgung, NS-Verbrecher, SBZ/DDR, Bundesrepublik Deutschland, Kalter Krieg, Rechtsstaatlichkeit, Staatsapparat, Stasi, sowjetische Archive, historische Interpretationen, Ostalgie, Wiedervereinigung.
Details
- Titel
- Die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechern in der SBZ/DDR
- Hochschule
- Universität Bielefeld (Fakultät für Geschichtswissenschaften, Philosophie und Theologie)
- Veranstaltung
- Politik und Gesellschaft in der DDR
- Autor
- Michael Brunnert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V172875
- ISBN (Buch)
- 9783640929641
- ISBN (eBook)
- 9783640929788
- Dateigröße
- 556 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- DDR SBZ NS-Verbrecher Kontinuität Strafverfolgung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Michael Brunnert (Autor:in), 2009, Die strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechern in der SBZ/DDR, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/172875
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-