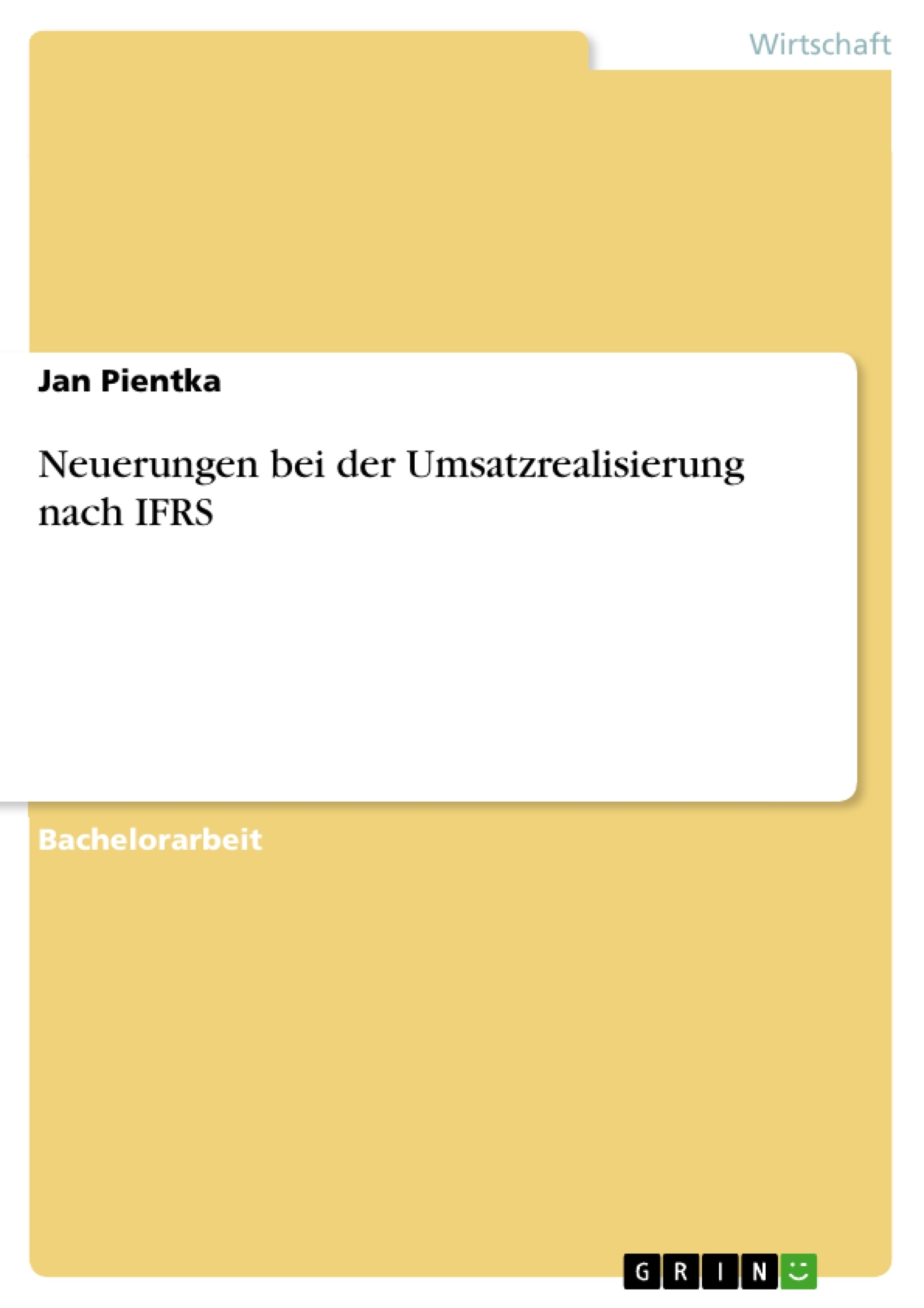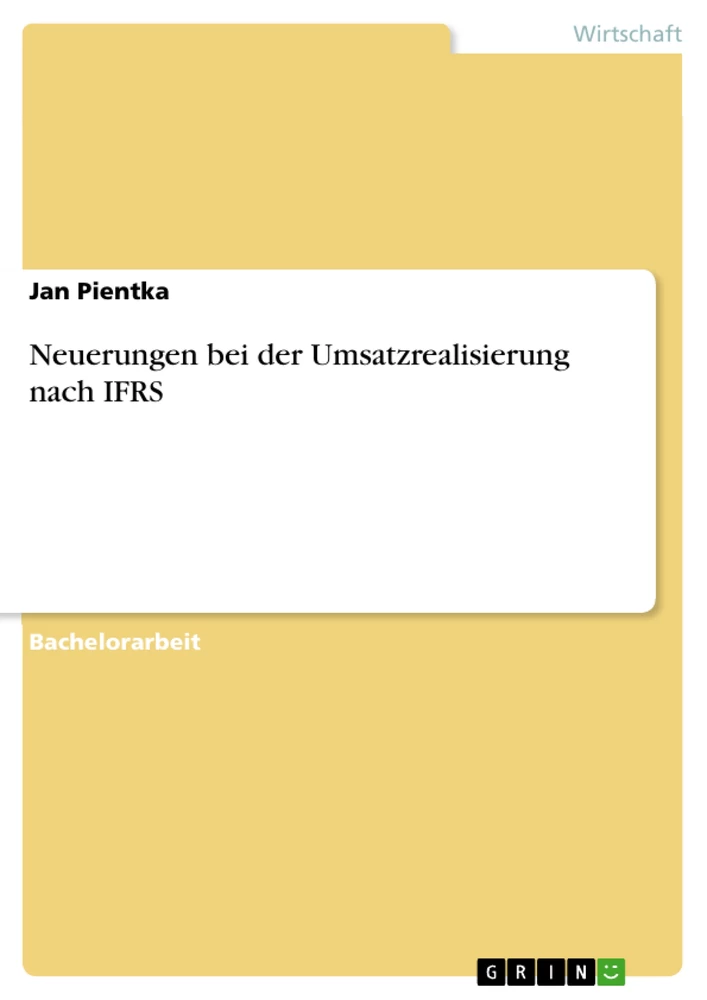
Neuerungen bei der Umsatzrealisierung nach IFRS
Bachelorarbeit, 2011
57 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Prinzipien und Begriffe der Umsatzrealisation
- 2.1. Grundprinzipien deutscher und amerikanischer Rechnungslegung
- 2.2. Erträge und Aufwendungen
- 3. Umsatzrealisation nach IFRS
- 3.1. Standard und Zeitpunkt der Umsatzrealisation
- 3.2. Umsatzrealisation nach IAS 18
- 3.2.1. Umsatzrealisation bei einem Kaufvertrag
- 3.2.2. Sonstige Umsatzrealisation
- 4. Bilanzierung von Mehrkomponentenverträgen
- 4.1. Bilanzierungsansatz der IFRS
- 4.2. Ansätze des EITF 00-21
- 4.3. Umsatzrealisation für Software nach SOP 97-2
- 4.4. Mehrkomponentenverträge nach SOP 97-2
- 5. ED 2010/6
- 5.1. Anwendung und Grundprinzipien des ED
- 5.2. Umsatzrealisation nach den Kernprinzipien
- 5.2.1. Vertragsidentifizierung
- 5.2.2. Identifizierung der Leistungsverpflichtungen
- 5.2.3. Determinierung des Transaktionspreises
- 5.2.4. Verteilung des Transaktionspreises auf Leistungsverpflichtungen
- 5.2.5. Umsatzrealisierung bei Erfüllung der Leistungsverpflichtung
- 5.3. Sonstige Bestimmungen des ED
- 5.4. Mehrkomponentengeschäfte im Beispiel
- 6. Kritische Würdigung ausgewählter Aspekte
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit Neuerungen bei der Umsatzrealisation nach IFRS. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Rechnungslegungsstandards und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Bilanzierung von Unternehmen. Der Fokus liegt insbesondere auf der Anwendung des Exposure Draft (ED) 2010/6 und den Neuerungen, die dieser für die Umsatzrealisation bringt.
- Grundprinzipien und Begriffe der Umsatzrealisation
- Umsatzrealisation nach IFRS und IAS 18
- Bilanzierung von Mehrkomponentenverträgen
- Anwendung des ED 2010/6
- Kritische Würdigung der Neuerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Umsatzrealisation ein und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 behandelt die Grundprinzipien und Begriffe der Umsatzrealisation, wobei die Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Rechnungslegung beleuchtet werden. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Umsatzrealisation nach IFRS, insbesondere mit den Standards und dem Zeitpunkt der Umsatzrealisation. Kapitel 4 widmet sich der Bilanzierung von Mehrkomponentenverträgen und den unterschiedlichen Ansätzen der IFRS, des EITF 00-21 und des SOP 97-2. Kapitel 5 analysiert den ED 2010/6, seine Anwendung und die Kernprinzipien der Umsatzrealisation. Kapitel 6 widmet sich einer kritischen Würdigung ausgewählter Aspekte der Neuerungen. Abschließend enthält Kapitel 7 eine Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen bietet.
Schlüsselwörter
IFRS, Umsatzrealisation, Mehrkomponentenverträge, ED 2010/6, Rechnungslegung, Bilanzierung, IAS 18, EITF 00-21, SOP 97-2
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Umsatzrealisierung nach IFRS so komplex?
Besonders bei langfristigen Verträgen und Mehrkomponentenverträgen ist die zeitliche und wertmäßige Zuordnung des Umsatzes schwierig und anfällig für Manipulationen.
Was ändert sich durch den Standard ED 2010/6?
Der Standard führt neue Kernprinzipien ein, wie die Identifizierung von Leistungsverpflichtungen und die Verteilung des Transaktionspreises.
Was sind Mehrkomponentenverträge?
Das sind Verträge, bei denen verschiedene Leistungen (z. B. Hardware, Software und Service) in einem Paket verkauft werden, was die Bilanzierung erschwert.
Wie unterscheidet sich IAS 18 von den neuen Entwürfen?
IAS 18 war der bisherige Standard für Erträge; die neuen Entwürfe zielen auf eine stärkere Vereinheitlichung und Risikonähe ab.
Welche Rolle spielt die "Vor faturierung" in der Kritik?
Die Ausweisung unrealisierter Umsätze (z.B. im Xerox-Fall) wird scharf kritisiert, da sie den Unternehmenserfolg künstlich aufbläht.
Details
- Titel
- Neuerungen bei der Umsatzrealisierung nach IFRS
- Hochschule
- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Wirtschaftswissenschaften)
- Note
- 1,3
- Autor
- Jan Pientka (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 57
- Katalognummer
- V173284
- ISBN (eBook)
- 9783640934546
- ISBN (Buch)
- 9783640934720
- Dateigröße
- 887 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- ED 2010/6 ED Umsatz Revenue Revenue Recognition Umsatzrealisation Umsatzrealisierung Periodenerfolg Bilanztheorie Ertrag Erträge
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Jan Pientka (Autor:in), 2011, Neuerungen bei der Umsatzrealisierung nach IFRS, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/173284
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-