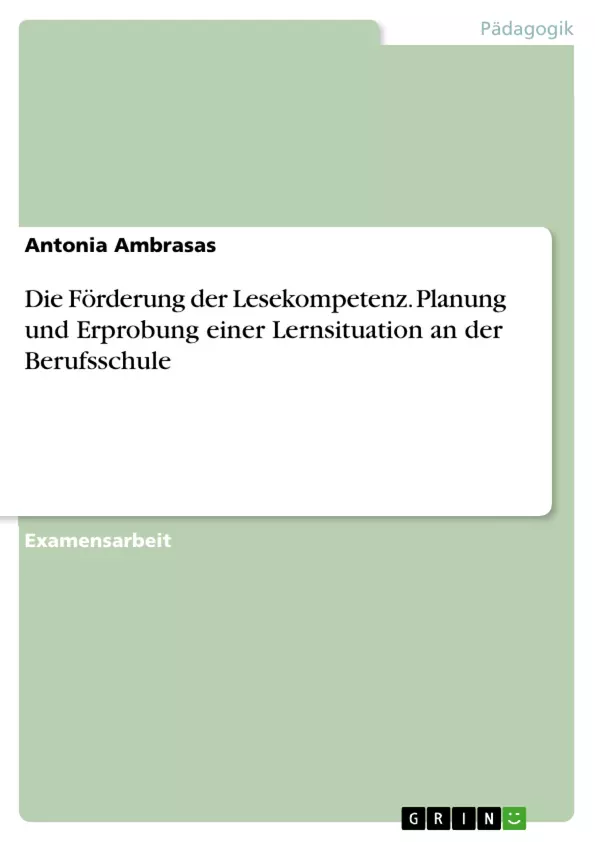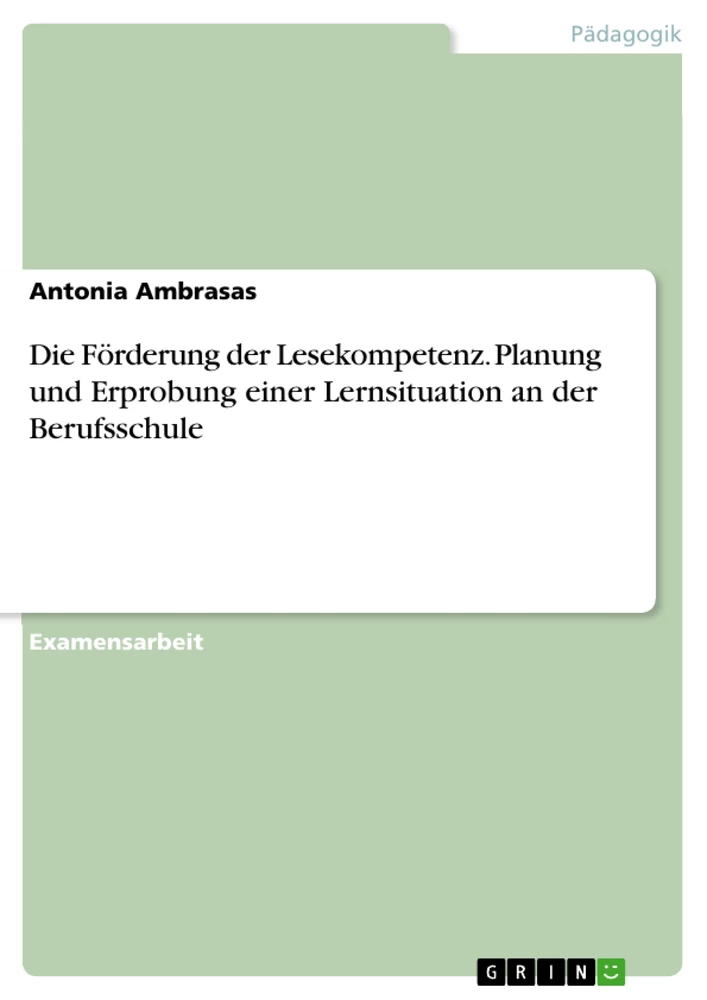
Die Förderung der Lesekompetenz. Planung und Erprobung einer Lernsituation an der Berufsschule
Examensarbeit, 2010
52 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 EINLEITUNG
- 2 DIDAKTISCHER SCHWERPUNKT: FÖRDERUNG VON LESEKOMPETENZ
- 2.1 WAS IST LESEKOMPETENZ? EINE BEGRIFFSBESTIMMUNG
- 2.1.1 LESEN
- 2.1.2 LESEKOMPETENZ
- 2.2 VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN ERFOLGREICHEN LESEPROZESS
- 2.2.1 ARBEITSGEDÄCHTNIS
- 2.2.2 VORWISSEN
- 2.2.3 METAKOGNITION
- 2.2.4 KOGNITIVE STRATEGIEN
- 2.2.5 MOTIVATION, SELBSTKONZEPT UND SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG
- 2.2.6 ZUSAMMENFASSUNG
- 2.3 WIE KANN LESEKOMPETENZ GEFÖRDERT WERDEN?
- 2.3.1 LESESTRATEGIEPROGRAMME
- 2.3.1.1 SQ3R-Methode / PQ4R-Methode
- 2.3.1.2 Reciprocal Teaching (Reziprokes Lehren)
- 2.3.2 DAS VERWENDETE STRATEGIEPROGRAMM: „WIR WERDEN TEXTDETEKTIVE“
- 2.3.1 LESESTRATEGIEPROGRAMME
- 2.4 DIDAKTISCHE LEITFRAGEN UND HYPOTHESEN
- 2.1 WAS IST LESEKOMPETENZ? EINE BEGRIFFSBESTIMMUNG
- 3 PLANUNG DER UNTERRICHTSREIHE
- 3.1 PLANUNGSGRUNDLAGEN
- 3.1.1 CURRICULARE VORGABEN
- 3.1.2 PLANUNGSZUSAMMENHANG
- 3.1.3 SPEZIELLE VORAUSSETZUNGEN UND BESONDERHEITEN
- 3.2 LERNGRUPPE
- 3.2.1 STATISTISCHE ANGABEN
- 3.2.2 KOMPETENZSTAND
- 3.3 DIDAKTISCHE ENTSCHEIDUNGEN
- 3.3.1 RELEVANZ DER THEMATIK
- 3.3.2 DIDAKTISCHE REDUKTION UND INHALTLICHE STRUKTURIERUNG
- 3.3.3 DIDAKTISCHES KONZEPT
- 3.3.4 HANDLUNGSENTWURF FÜR DIE MODERATION
- 3.3.5 KOMPETENZZUWACHS UND INDIKATOREN DER KOMPETENZENTWICKLUNG
- 3.1 PLANUNGSGRUNDLAGEN
- 4 ANALYSE DER DURCHGEFÜHRTEN UNTERRICHTSREIHE
- 4.1 GESAMTEINDRUCK
- 4.2 LEITFRAGENORIENTIERTE ANALYSE
- 5 SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Arbeit ist es, die Förderung der Lesekompetenz von Berufsschülern im Lernfeld 1.1 „Einrichten einer Baustelle“ zu untersuchen. Dazu wird ein Strategietrainingsprogramm geplant, erprobt und analysiert, um zu beurteilen, inwieweit es sich für die Verbesserung der Lesekompetenz eignet.
- Begriffsbestimmung von Lesekompetenz
- Voraussetzungen für einen erfolgreichen Leseprozess
- Lesestrategieprogramme zur Förderung der Lesekompetenz
- Planung und Durchführung einer Unterrichtsreihe zum Thema „Einrichten einer Baustelle“
- Analyse der Wirksamkeit des Strategietrainingsprogramms
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der Lesekompetenzförderung. Es beleuchtet die Problematik mangelnder Ausbildungsreife bei Jugendlichen und stellt den Zusammenhang mit der Lesekompetenz her. Kapitel zwei behandelt den didaktischen Schwerpunkt der Arbeit, die Förderung von Lesekompetenz. Es wird eine Begriffsbestimmung von Lesekompetenz vorgenommen, die psychologischen Determinanten für einen erfolgreichen Leseprozess erläutert und verschiedene Lesestrategieprogramme vorgestellt. Kapitel drei befasst sich mit der Planung der Unterrichtsreihe, die im Rahmen der Arbeit durchgeführt wurde. Es werden die Planungsgrundlagen, die Lerngruppe und die didaktischen Entscheidungen vorgestellt. In Kapitel vier wird die Unterrichtsreihe analysiert und die Wirksamkeit des Strategietrainingsprogramms beurteilt. Der fünfte und letzte Teil dieser Arbeit beinhaltet eine Schlussbetrachtung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lesekompetenzförderung, Strategietraining, Berufsschulunterricht, Lernfeld 1.1 „Einrichten einer Baustelle“, Schüler mit niedrigen Lesekompetenzstufen, psychologisches Determinanten des Leseprozesses und Unterrichtsplanung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Lesekompetenz in der Berufsschule?
Lesekompetenz umfasst die Fähigkeit, Texte nicht nur zu lesen, sondern deren Inhalte zu verstehen, zu behalten und für fachliche Aufgaben (z. B. im Handwerk) anzuwenden.
Warum ist Leseförderung für Dachdecker-Auszubildende relevant?
Da viele Auszubildende in diesem Bereich einen Hauptschulabschluss und teils niedrige Lesekompetenzstufen haben, ist Förderung essenziell für einen erfolgreichen Berufsabschluss.
Was ist das Programm „Wir werden Textdetektive“?
Es handelt sich um ein spezifisches Strategietrainingsprogramm, das Schülern hilft, Texte systematisch zu erschließen.
Welche psychologischen Faktoren beeinflussen den Leseprozess?
Wichtige Faktoren sind das Arbeitsgedächtnis, das Vorwissen, metakognitive Fähigkeiten sowie Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung.
Was ist die SQ3R- oder PQ4R-Methode?
Dies sind klassische Lesestrategieprogramme, die Schritte wie Survey (Überblick), Question (Fragen), Read (Lesen), Recite (Wiedergeben) und Review (Rückblick) umfassen.
Wie lässt sich Leseförderung in den Fachunterricht integrieren?
Die Arbeit zeigt dies am Beispiel des Lernfelds 1.1 „Einrichten einer Baustelle“, wo Fachwissen und Lesestrategien parallel vermittelt werden.
Details
- Titel
- Die Förderung der Lesekompetenz. Planung und Erprobung einer Lernsituation an der Berufsschule
- Note
- 1,0
- Autor
- Antonia Ambrasas (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V174152
- ISBN (eBook)
- 9783668253490
- ISBN (Buch)
- 9783668253506
- Dateigröße
- 2070 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Lesekompetenz Leseförderung Berufsschule
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Antonia Ambrasas (Autor:in), 2010, Die Förderung der Lesekompetenz. Planung und Erprobung einer Lernsituation an der Berufsschule, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/174152
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-