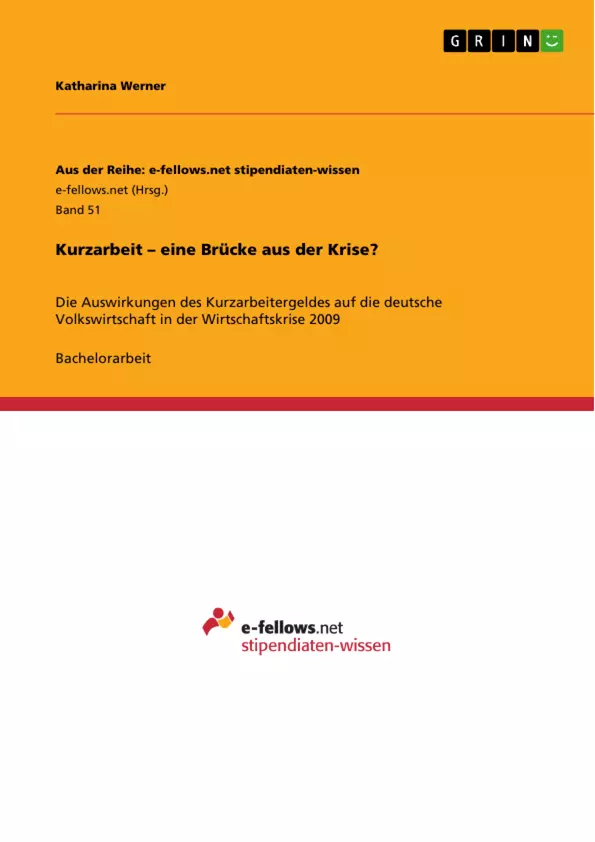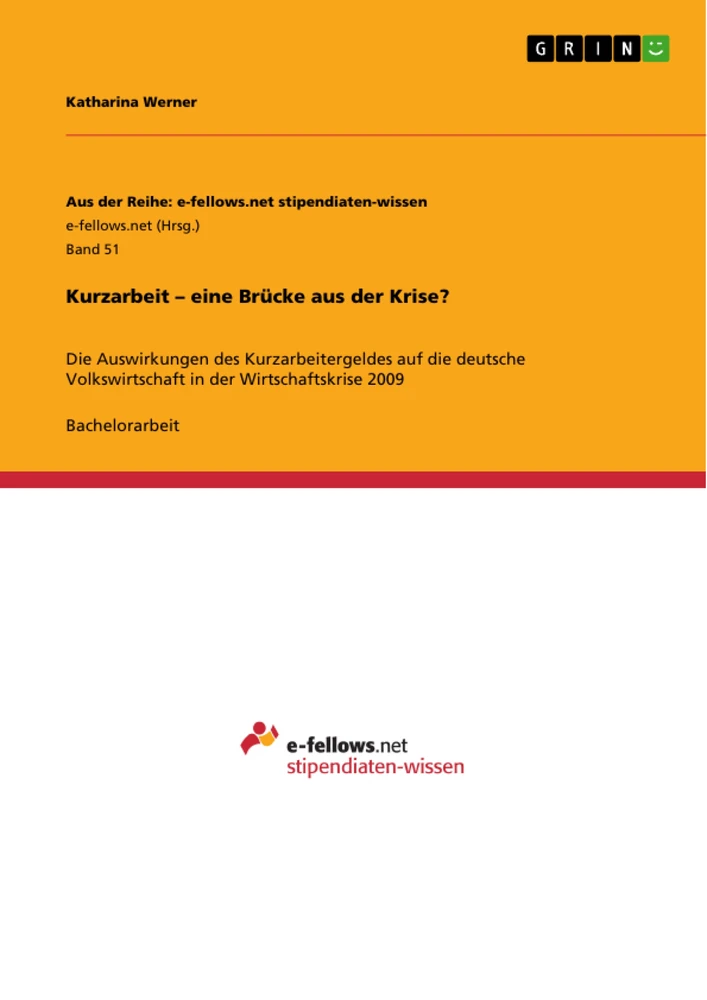
Kurzarbeit – eine Brücke aus der Krise?
Bachelorarbeit, 2009
40 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit
- 2.1 Arbeitsnachfrage, Arbeitsangebot und Arbeitslosigkeit im neoklassischen Modell
- 2.2 Theorien zur Entstehung von Arbeitslosigkeit
- 2.2.1 Effizienzlohnmodelle
- 2.2.2 Die Humankapitaltheorie
- 2.2.3 Die Insider-Outsider-Theorie
- 2.3 Messung der Arbeitslosigkeit
- 3 Kurzarbeit
- 3.1 Definition und Ziele
- 3.2 Gesetzliche Regelungen und Voraussetzungen
- 3.3 Sonderregelungen für 2009/2010, ihre Begründungen und Absichten
- 4 Kritische Analyse der Auswirkungen des Kurzarbeitergeldes
- 4.1 Auswirkungen auf Betriebe
- 4.1.1 Vorteile und Entlastung
- 4.1.2 Kosten und Nachteile
- 4.2 Auswirkungen auf Arbeitnehmer
- 4.2.1 Vorteile für Arbeitnehmer
- 4.2.2 Kosten und Nachteile
- 4.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
- 4.3.1 Gesamtwirtschaftliche Vorteile
- 4.3.2 Gesamtwirtschaftliche Kosten und Nachteile
- 4.4 Wichtige Kritikpunkte am Kurzarbeitergeld
- 5 Empirische Daten zur aktuellen Wirkung der Kurzarbeit
- 5.1 Die derzeitige Lage in Deutschland
- 5.2 Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern
- 5.3 Prognosen für 2010
- 6 Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen des Kurzarbeitergeldes auf die deutsche Volkswirtschaft in der Wirtschaftskrise 2009. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der Arbeitsmarktökonomik, die rechtlichen Rahmenbedingungen des Kurzarbeitergeldes und die Folgen für Unternehmen, Arbeitnehmer und die gesamte Volkswirtschaft.
- Einführung der theoretischen Grundlagen des Arbeitsmarktes
- Analyse der Funktionsweise und der Ziele des Kurzarbeitergeldes
- Bewertung der Auswirkungen des Kurzarbeitergeldes auf Unternehmen und Arbeitnehmer
- Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Folgen des Kurzarbeitergeldes
- Empirische Analyse der aktuellen Situation und Prognosen für die Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die wichtigsten Grundlagen der Arbeitsmarktökonomik, einschließlich der Arbeitsnachfrage, des Arbeitsangebots und der Arbeitslosigkeit im neoklassischen Modell. Es werden auch verschiedene Theorien zur Entstehung von Arbeitslosigkeit vorgestellt, darunter Effizienzlohnmodelle, die Humankapitaltheorie und die Insider-Outsider-Theorie.
Kapitel 3 definiert Kurzarbeit und erläutert ihre Ziele. Es beleuchtet die gesetzlichen Regelungen und Voraussetzungen sowie die Sonderregelungen für 2009/2010, ihre Begründungen und Absichten.
Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen des Kurzarbeitergeldes auf Betriebe, Arbeitnehmer und die Volkswirtschaft. Es analysiert die Vorteile und Nachteile für Unternehmen und Arbeitnehmer sowie die gesamtwirtschaftlichen Folgen.
Kapitel 5 präsentiert empirische Daten zur aktuellen Wirkung des Kurzarbeitergeldes in Deutschland und im Vergleich zu anderen Ländern. Es enthält auch Prognosen für 2010.
Schlüsselwörter
Kurzarbeit, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, Konjunkturpaket, volkswirtschaftliche Auswirkungen, Unternehmen, Arbeitnehmer, Deutschland, Empirie, Prognose
Details
- Titel
- Kurzarbeit – eine Brücke aus der Krise?
- Untertitel
- Die Auswirkungen des Kurzarbeitergeldes auf die deutsche Volkswirtschaft in der Wirtschaftskrise 2009
- Hochschule
- Universität Passau
- Note
- 1,7
- Autor
- Katharina Werner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 40
- Katalognummer
- V174229
- ISBN (Buch)
- 9783640946785
- ISBN (eBook)
- 9783640947089
- Dateigröße
- 994 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kurzarbeit brücke krise auswirkungen kurzarbeitergeldes volkswirtschaft wirtschaftskrise
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Katharina Werner (Autor:in), 2009, Kurzarbeit – eine Brücke aus der Krise?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/174229
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-