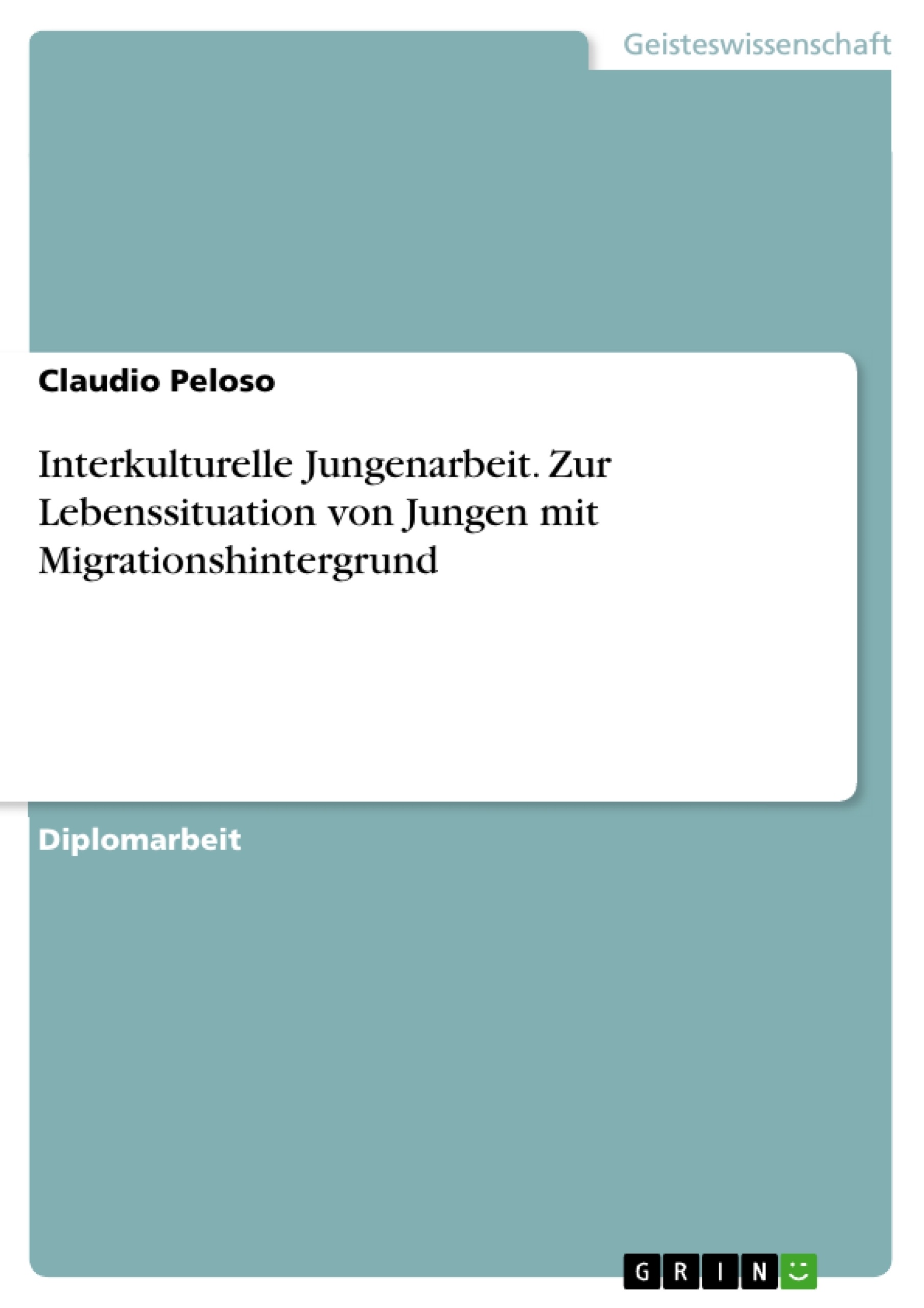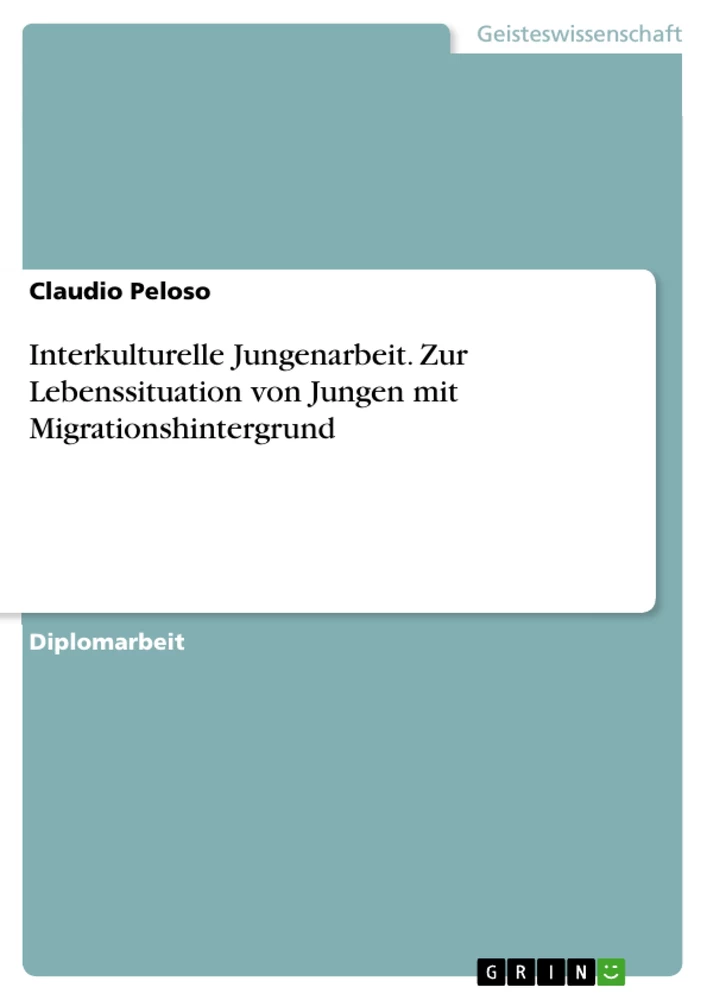
Interkulturelle Jungenarbeit. Zur Lebenssituation von Jungen mit Migrationshintergrund
Diplomarbeit, 2003
172 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interkulturalität
- Zum Begriff der InterKULTURalität
- Diskussion in Deutschland
- MigrantInnen in Deutschland
- Jungenarbeit
- Konstruktionen von Männlichkeiten
- Jungenarbeit in Deutschland
- Experteninterviews
- Zur Lebenssituation von Jungen mit Migrationshintergrund
- In der Schule
- In der Freizeit
- In der Familie
- Interkulturelle Jungenarbeit
- Grundlagen der interkulturellen Jungenarbeit
- Zur Rahmenkonzeption interkultureller Jungenarbeit
- Methoden der interkulturellen Jungenarbeit
- Die Rolle des interkulturellen Jungenarbeiters
- Ziele der interkulturellen Jungenarbeit
- Praxisbeispiele aus der Jungenarbeit
- "ànimo" - Geschlechtsspezifische Arbeit mit Jungen an Schulen
- Sexualpädagogisches Arbeiten von „Pro Familia“ München
- Interkulturelle Jungengruppe „MULTI - KULTI“
- Schlüsselqualifikation „interkulturelle Kompetenz“
- Was ist interkulturelle Kompetenz?
- Interkulturelle Kompetenz in der Sozialen Arbeit
- Schlüsselqualifikation in der interkulturellen Jungenarbeit
- Auswertung der Experteninterviews
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht das Thema der interkulturellen Jungenarbeit und zielt darauf ab, einen Überblick über dieses Feld der Sozialen Arbeit zu bieten. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Arbeit mit Jungen mit Migrationshintergrund ergeben.
- Interkulturelle Kompetenz und ihre Bedeutung in der Sozialen Arbeit
- Die Konstruktion von Männlichkeit in verschiedenen Kulturen
- Die Lebensbedingungen von Jungen mit Migrationshintergrund in verschiedenen Lebensbereichen (Schule, Freizeit, Familie)
- Methoden und Ansätze der interkulturellen Jungenarbeit
- Die Rolle des interkulturellen Jungenarbeiters
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Jungenarbeit ein und erläutert die Relevanz und Brisanz des Themas. Sie beleuchtet die aktuelle Diskussion über Zuwanderung, die Bedeutung von PISA- und Jugendstudien sowie die wachsende Europäisierung und Globalisierung. Zudem werden die eigenen Erfahrungen des Autors im Bereich der Bildungsarbeit mit Jungen und die Inspiration für die Diplomarbeit dargestellt.
- Interkulturalität: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Interkulturalität und seiner Bedeutung in Deutschland. Es beleuchtet die Diskussion über MigrantInnen und die Herausforderungen der Integration in der deutschen Gesellschaft.
- Jungenarbeit: Dieses Kapitel fokussiert auf die Konstruktionen von Männlichkeit in verschiedenen Kulturen und die Situation der Jungenarbeit in Deutschland. Es untersucht die Herausforderungen, die Jungen in Bezug auf ihre Männlichkeitserfahrungen und ihre Rolle in der Gesellschaft erleben.
- Experteninterviews: Dieses Kapitel stellt die Methodik der Experteninterviews vor und beschreibt deren Bedeutung für die Diplomarbeit. Es erläutert die Leitfragen und die Auswahl der Experten aus der Jungenarbeit.
- Zur Lebenssituation von Jungen mit Migrationshintergrund: Dieses Kapitel analysiert die Lebenssituation von Jungen mit Migrationshintergrund in verschiedenen Lebensbereichen (Schule, Freizeit, Familie). Es beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die diese Jungen in jedem Bereich erleben.
- Interkulturelle Jungenarbeit: Dieses Kapitel geht auf die Grundlagen der interkulturellen Jungenarbeit ein, beleuchtet verschiedene Methoden und Ansätze, erläutert die Rolle des interkulturellen Jungenarbeiters und definiert die Ziele der interkulturellen Jungenarbeit. Es werden zudem Praxisbeispiele aus der Jungenarbeit vorgestellt.
- Schlüsselqualifikation „interkulturelle Kompetenz“: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der interkulturellen Kompetenz und ihre Bedeutung in der Sozialen Arbeit. Es beleuchtet die Rolle der interkulturellen Kompetenz in der interkulturellen Jungenarbeit.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselbegriffe und Themen: Interkulturelle Jungenarbeit, Migrationshintergrund, Jungenarbeit, Interkulturelle Kompetenz, Geschlechtsspezifische Arbeit, Lebensbedingungen, Integration, Kultur, Männlichkeit, Sozialpädagogik, Methoden der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der interkulturellen Jungenarbeit?
Sie zielt darauf ab, Jungen mit Migrationshintergrund in ihrer Identitätsbildung zu unterstützen und Fachkräfte für deren spezifische Lebensbedingungen zu sensibilisieren.
Welche Rolle spielt die Konstruktion von Männlichkeit?
Jungen wachsen mit widersprüchlichen Bildern von Männlichkeit auf; die Arbeit untersucht, wie diese Bilder in verschiedenen Kulturen ohne authentische Vorbilder entstehen.
Was versteht man unter „interkultureller Kompetenz“ in der Sozialen Arbeit?
Es handelt sich um eine Schlüsselqualifikation, die es ermöglicht, professionell mit kultureller Vielfalt umzugehen und eigene Vorurteile zu reflektieren.
Welche Lebensbereiche von Migrantenjungen werden untersucht?
Die Diplomarbeit beleuchtet die spezifischen Herausforderungen in der Schule, in der Freizeit und innerhalb der Familie.
Welche Praxisbeispiele werden in der Arbeit genannt?
Es werden Projekte wie „ànimo“ (schulische Jungenarbeit), die Sexualpädagogik von Pro Familia und die Gruppe „MULTI-KULTI“ vorgestellt.
Details
- Titel
- Interkulturelle Jungenarbeit. Zur Lebenssituation von Jungen mit Migrationshintergrund
- Hochschule
- Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Soziale Arbeit)
- Note
- 1,3
- Autor
- Claudio Peloso (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 172
- Katalognummer
- V17533
- ISBN (eBook)
- 9783638220859
- ISBN (Buch)
- 9783640315499
- Dateigröße
- 1100 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Interkulturelle Jungenarbeit Jugendarbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 21,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Claudio Peloso (Autor:in), 2003, Interkulturelle Jungenarbeit. Zur Lebenssituation von Jungen mit Migrationshintergrund, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/17533
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-