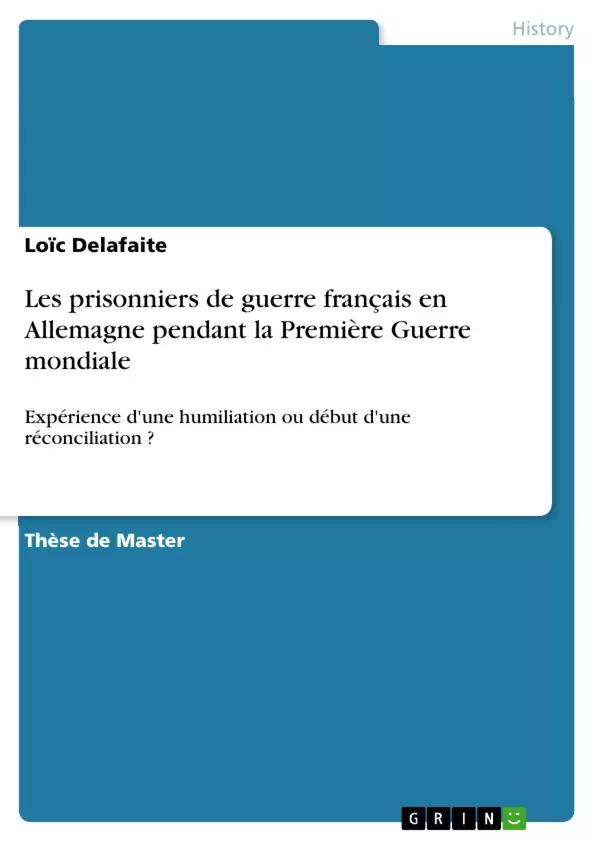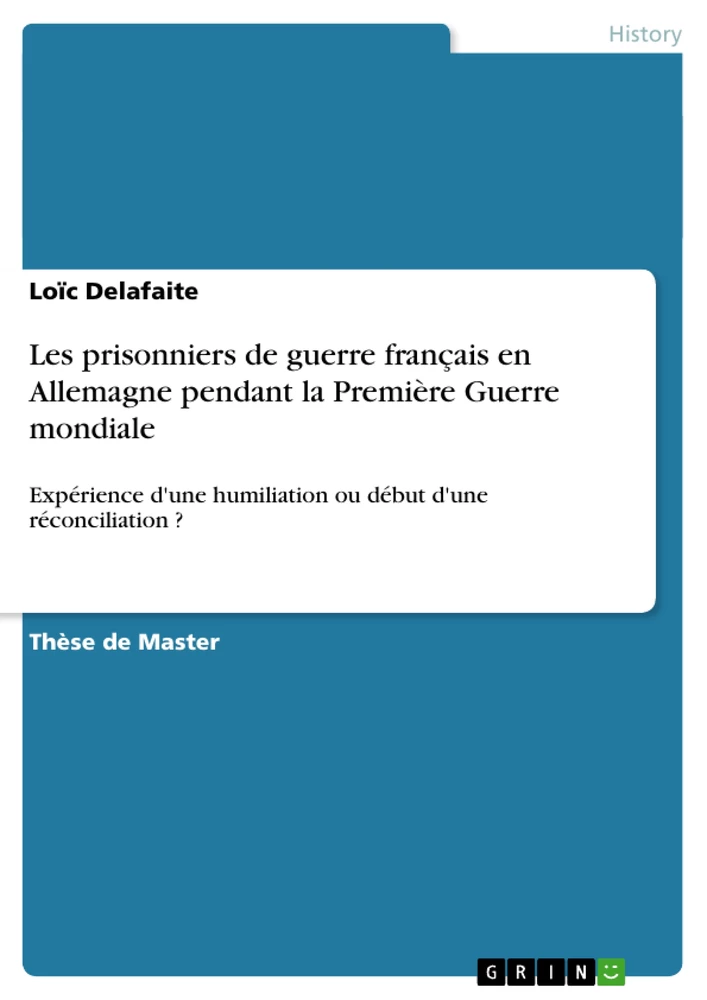
Les prisonniers de guerre français en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale
Masterarbeit, 2007
138 Seiten, Note: 17/20
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- INTRODUCTION ET ETAT DE LA RECHERCHE
- I) LE PRISONNIER FACE A LA CAPTIVITE ET FACE A L'ALLEMAND
- 1) Le début de la captivité
- 2) La vie de prisonnier
- 3) Le prisonnier et la population
- II) L'EXPRESSION DES EXPERIENCES
- 1) Le prisonnier et sa plume
- 2) Le jugement sur l'Allemand
- 3) La fin de la captivité
- III) LE PRISONNIER APRES LA GUERRE
- 1) Accueil des écrits et introduction du débat
- 2) Le chemin vers l'humiliation
- 3) Le prisonnier comme vecteur de réconciliation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfahrungen französischer Kriegsgefangener in Deutschland während des Ersten Weltkriegs. Sie analysiert, ob diese Erfahrung primär als Demütigung oder als Beginn einer Versöhnung zu verstehen ist. Die Studie beleuchtet die verschiedenen Facetten der Gefangenschaft, von den ersten Momenten der Gefangennahme bis hin zu den langfristigen Auswirkungen auf die betroffenen Personen und die deutsch-französischen Beziehungen.
- Die Erfahrung der Gefangenschaft und ihre Auswirkungen auf die französischen Soldaten.
- Die Interaktion zwischen den Gefangenen und der deutschen Bevölkerung.
- Die literarische und schriftliche Aufarbeitung der Erlebnisse durch die Gefangenen.
- Die Rolle der Kriegsgefangenen im Prozess der deutsch-französischen Versöhnung nach dem Krieg.
- Die Darstellung Deutschlands in den Berichten der französischen Kriegsgefangenen.
Zusammenfassung der Kapitel
INTRODUCTION ET ETAT DE LA RECHERCHE: Diese Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem sie den Forschungsstand zum Thema der französischen Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg darlegt. Sie skizziert die Forschungsfragen und die methodischen Ansätze, die im Verlauf der Arbeit verfolgt werden. Die Einleitung dient als notwendige Grundlage, um die folgenden Kapitel in einen wissenschaftlichen Kontext einzuordnen und den Leser auf die Argumentation vorzubereiten. Sie präsentiert eine umfassende Übersicht über bestehende Literatur und identifiziert Forschungslücken, die diese Arbeit zu schließen versucht.
I) LE PRISONNIER FACE A LA CAPTIVITE ET FACE A L'ALLEMAND: Dieses Kapitel analysiert die unmittelbaren Erfahrungen der französischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand. Es beschreibt die Gefangennahme, die anfängliche Konfrontation mit der unbekannten Umgebung und die Herausforderungen des Überlebens im Lager. Der Fokus liegt auf den alltäglichen Bedingungen, der Organisation des Lagerlebens, der Hygiene, der Kommunikation mit der Heimat und der Versorgung mit Lebensmitteln. Darüber hinaus wird die Interaktion mit der deutschen Zivilbevölkerung beleuchtet, einschliesslich der Propaganda und der Versuche, aus dem Lager zu fliehen. Die beschriebenen Aspekte geben ein umfassendes Bild des Lebens in Gefangenschaft wieder und bilden die Grundlage für die folgenden Kapitel.
II) L'EXPRESSION DES EXPERIENCES: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die schriftliche Verarbeitung der Erlebnisse der französischen Kriegsgefangenen. Es untersucht die Bedeutung von Tagebüchern, Memoiren und anderen schriftlichen Zeugnissen als Quelle für das Verständnis der damaligen Erfahrungen. Die Analyse umfasst die Motivation der Schreibenden, die Art und Weise ihrer Darstellung und den Blick auf Deutschland und die deutsche Bevölkerung. Die Untersuchung beleuchtet, wie die Gefangenen ihre Beobachtungen und Emotionen in schriftlicher Form festhielten und wie diese Texte Aufschluss über ihre psychologische Verarbeitung der Situation geben. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Texte als Quelle für das Verständnis der subjektiven Wahrnehmung der Gefangenen.
III) LE PRISONNIER APRES LA GUERRE: Dieses Kapitel widmet sich den langfristigen Folgen der Kriegsgefangenschaft und der Rezeption der gewonnenen Erfahrungen. Es untersucht die Rolle der Literatur aus der Perspektive der Kriegsgefangenen und wie diese in die öffentliche Diskussion nach dem Krieg einfloss. Die Analyse befasst sich mit der Frage, inwiefern die Gefangenschaft zur Demütigung der Heimkehrer beitrug oder aber als Schritt zu einer Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland verstanden werden kann. Es werden sowohl negative als auch positive Aspekte der Nachkriegszeit in Bezug auf die Kriegsgefangenen und ihre Erfahrungen beleuchtet und die Bedeutung dieser Erfahrungen für die deutsch-französische Aussöhnung hinterfragt.
Schlüsselwörter
Französische Kriegsgefangene, Erster Weltkrieg, Deutschland, Gefangenenlager, Erfahrungen, Demütigung, Versöhnung, Literatur, Memoiren, deutsch-französische Beziehungen, psychologische Verarbeitung, Nachkriegssituation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erfahrungen französischer Kriegsgefangener im Ersten Weltkrieg
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht die Erfahrungen französischer Kriegsgefangener in Deutschland während des Ersten Weltkriegs. Sie analysiert, ob diese Erfahrung primär als Demütigung oder als Beginn einer Versöhnung zu verstehen ist, und beleuchtet die verschiedenen Facetten der Gefangenschaft von der Gefangennahme bis zu den langfristigen Auswirkungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Erfahrung der Gefangenschaft und ihre Auswirkungen auf die französischen Soldaten, die Interaktion zwischen Gefangenen und deutscher Bevölkerung, die literarische Aufarbeitung der Erlebnisse, die Rolle der Kriegsgefangenen in der deutsch-französischen Versöhnung und die Darstellung Deutschlands in den Berichten der Gefangenen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (mit Forschungsstand), drei Hauptkapitel und ein Kapitel mit Schlüsselwörtern. Kapitel I behandelt die unmittelbaren Erfahrungen der Gefangenen, Kapitel II die schriftliche Verarbeitung der Erlebnisse und Kapitel III die langfristigen Folgen und die Rezeption der Erfahrungen nach dem Krieg.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung legt den Forschungsstand zum Thema dar, skizziert die Forschungsfragen und methodischen Ansätze und ordnet die Arbeit in einen wissenschaftlichen Kontext ein. Sie präsentiert eine umfassende Übersicht bestehender Literatur und identifiziert Forschungslücken.
Worauf konzentriert sich Kapitel I ("LE PRISONNIER FACE A LA CAPTIVITE ET FACE A L'ALLEMAND")?
Kapitel I analysiert die unmittelbaren Erfahrungen der Gefangenen: Gefangennahme, Leben im Lager (tägliche Bedingungen, Organisation, Hygiene, Kommunikation, Versorgung), Interaktion mit der deutschen Zivilbevölkerung, Propaganda und Fluchtversuche.
Worauf konzentriert sich Kapitel II ("L'EXPRESSION DES EXPERIENCES")?
Kapitel II untersucht die schriftliche Verarbeitung der Erlebnisse durch Tagebücher, Memoiren etc. Es analysiert die Motivation der Schreibenden, ihre Darstellung und ihren Blick auf Deutschland und die deutsche Bevölkerung, sowie die psychologische Verarbeitung der Situation.
Worauf konzentriert sich Kapitel III ("LE PRISONNIER APRES LA GUERRE")?
Kapitel III widmet sich den langfristigen Folgen der Gefangenschaft und der Rezeption der Erfahrungen. Es untersucht die Rolle der Literatur der Kriegsgefangenen in der öffentlichen Diskussion nach dem Krieg und die Frage, ob die Gefangenschaft zur Demütigung oder zur Versöhnung beitrug.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Französische Kriegsgefangene, Erster Weltkrieg, Deutschland, Gefangenenlager, Erfahrungen, Demütigung, Versöhnung, Literatur, Memoiren, deutsch-französische Beziehungen, psychologische Verarbeitung, Nachkriegssituation.
Für welche Art von Lesern ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich wissenschaftlich mit dem Thema der Erfahrungen französischer Kriegsgefangener im Ersten Weltkrieg auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Themen im Kontext der deutsch-französischen Beziehungen und der historischen Aufarbeitung von Kriegserfahrungen.
Details
- Titel
- Les prisonniers de guerre français en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale
- Untertitel
- Expérience d'une humiliation ou début d'une réconciliation ?
- Hochschule
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Université de Reims et RTWH Aachen)
- Veranstaltung
- Civilisation allemande
- Note
- 17/20
- Autor
- Loïc Delafaite (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 138
- Katalognummer
- V175354
- ISBN (eBook)
- 9783640963010
- ISBN (Buch)
- 9783640963294
- Dateigröße
- 1087 KB
- Sprache
- Französisch
- Schlagworte
- prisonnier prisonniers captivité guerre mondiale Grande Guerre Première Guerre mondiale anthropologie France Allemagne français allemand Gaulle Harcourt Riou Rivière Revue journaux littérature soldats mémoire soldat camps de concentration camp
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Loïc Delafaite (Autor:in), 2007, Les prisonniers de guerre français en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/175354
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-