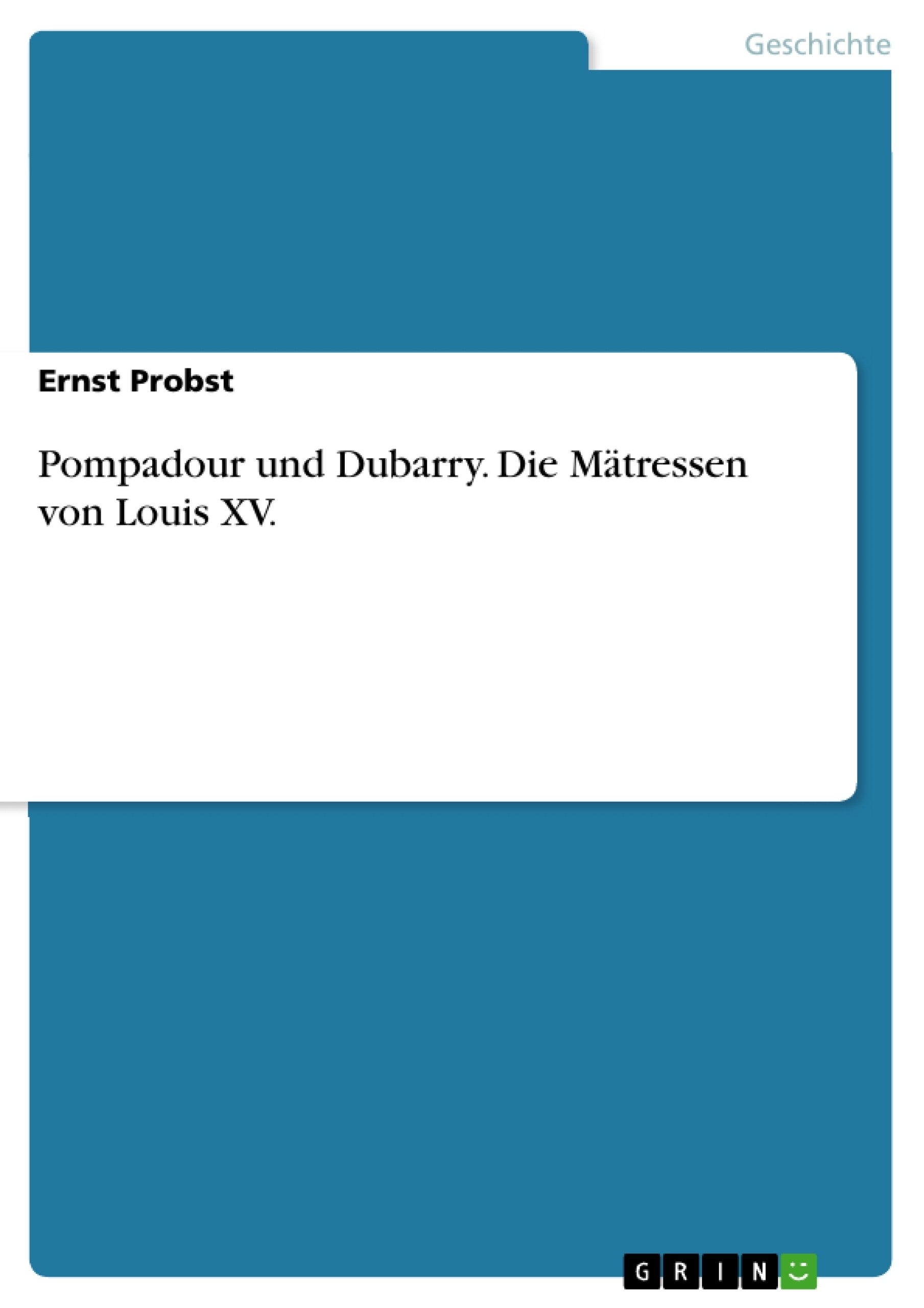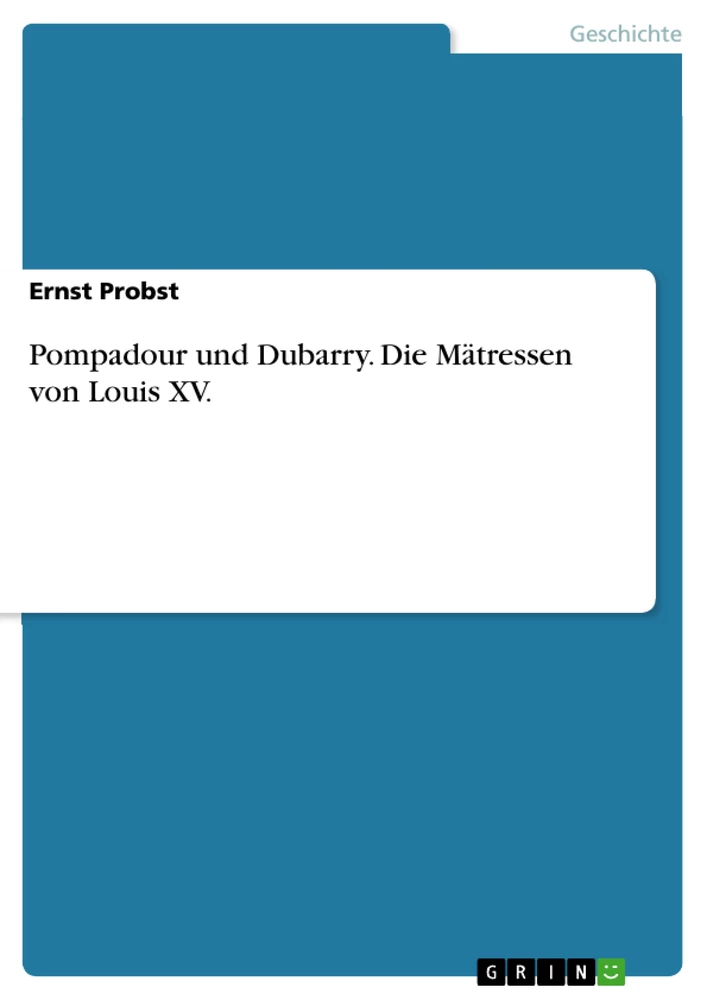
Pompadour und Dubarry. Die Mätressen von Louis XV.
Fachbuch, 2011
310 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Louis XV.: Täter oder Opfer?
- König Louis XV. „Der Vielgeliebte“
- Die Mätressen: Halboffizielle Geliebte der Fürsten
- Die Comtessen de Mailly-Nesle: Vier Schwestern für den König
- Marquise de Pompadour: Die erste bürgerliche Mätresse von Louis XV.
- Marie-Louise O’Morphy de Boisfally: Das Nacktmodell
- Madame Dubarry: Von der Dirne zur Mätresse des Königs
- Weitere Mätressen von Louis XV.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Taschenbuch untersucht das Leben von König Louis XV. und seine zahlreichen Beziehungen zu verschiedenen Frauen. Es beleuchtet die Rolle der Mätressen am französischen Hof, deren Einfluss auf den König und die Politik, sowie die sozialen und moralischen Aspekte dieser Beziehungen. Es geht insbesondere den Fragen nach, ob Louis XV. ein Täter oder Opfer seiner Umstände war und was die Motive der Frauen waren, die sich mit ihm einließen.
- Das Leben und die Persönlichkeit von König Louis XV.
- Die Rolle und der Status von Mätressen am französischen Hof.
- Der Einfluss der Mätressen auf die Politik und das gesellschaftliche Leben.
- Die individuellen Geschichten und Schicksale der Mätressen.
- Soziale und moralische Aspekte des Mätressenwesens im 18. Jahrhundert.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Louis XV.: Täter oder Opfer?: Das Vorwort wirft die zentrale Frage des Buches auf: War Louis XV. ein ausschweifender Wüstling oder ein Opfer der Umstände? Es kündigt die Erörterung des Königs' zahlreicher Geliebter und die Untersuchung der Motive der beteiligten Frauen an, inklusive der bekannten Marquise de Pompadour und Madame Dubarry, sowie der Schwestern Mailly-Nesle.
König Louis XV. „Der Vielgeliebte“: Dieses Kapitel beschreibt die Kindheit und Jugend des Königs, geprägt von Verlusten und einer strengen, einsamen Erziehung, die seine spätere Schüchternheit und Unsicherheit erklärt. Die Darstellung seiner frühen Jahre und die Beschreibung seiner Ausbildung geben einen Einblick in die Entstehung seiner Persönlichkeit und den möglichen Einfluss auf seinen späteren Lebenswandel. Es wird auch seine anfängliche Popularität als „der Vielgeliebte“ und sein späterer Ruf als „der Ungeliebte“ thematisiert.
Die Mätressen: Halboffizielle Geliebte der Fürsten: Dieses Kapitel beleuchtet das Phänomen der Mätressen im 18. Jahrhundert und dessen gesellschaftliche Akzeptanz. Es wird der halboffizielle Status der Mätressen erläutert, ihre Rolle am Hofe und ihr oft erheblicher Einfluss auf politische Entscheidungen. Die Kapitel untersucht auch die gesellschaftlichen und religiösen Aspekte dieser Beziehungen, die trotz des moralischen Verstoßes oft toleriert oder gar akzeptiert wurden.
Die Comtessen de Mailly-Nesle: Vier Schwestern für den König: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die vier Schwestern aus der Familie Mailly-Nesle, die nacheinander und teilweise gleichzeitig Mätressen von Louis XV. waren. Es detailliert ihre Beziehungen zum König, ihre individuellen Persönlichkeiten und ihre unterschiedlichen Rollen am Hof. Die Kapitel verdeutlicht das Ausmaß der königlichen Ausschweifungen und den komplexen Netzwerken von Intrigen am Hofe.
Marquise de Pompadour: Die erste bürgerliche Mätresse von Louis XV.: Das Kapitel erzählt die Lebensgeschichte der Marquise de Pompadour, von ihrer bürgerlichen Herkunft bis zu ihrem Aufstieg zur einflussreichen Mätresse des Königs. Es analysiert ihre Beziehung zu Louis XV., ihren Einfluss auf die Politik und die Künste, sowie ihre strategischen Manöver am Hof, um ihre Position zu sichern und ihren Einfluss zu maximieren. Es geht außerdem auf ihre komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter und ihrem Ehemann ein.
Marie-Louise O’Murphy de Boisfally: Das Nacktmodell: Dieses Kapitel beleuchtet das Leben von Marie-Louise O’Murphy, die als Modell für François Boucher diente und später eine kurze Affäre mit Louis XV. hatte. Es beschreibt ihren Aufstieg und Fall als königliche Mätresse und ihre anschließenden Ehen. Die Geschichte wird als Beispiel der flüchtigen Natur der königlichen Beziehungen und der oft kurzlebigen Karriere als Mätresse dargestellt.
Madame Dubarry: Von der Dirne zur Mätresse des Königs: Das Kapitel erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Madame Dubarry, ihrer Aufstieg von bescheidenen Verhältnissen bis zur letzten offiziellen Mätresse von Louis XV. Es beschreibt ihre strategischen Beziehungen und ihr Leben am Hof, ihre Konflikte mit Marie Antoinette und ihr tragischer Tod während der Französischen Revolution. Der Fokus liegt auf ihrem Aufstieg und ihrem unkonventionellen Lebensweg.
Weitere Mätressen von Louis XV.: Dieses Kapitel stellt weitere Mätressen von Louis XV. vor, skizziert ihre Beziehungen zum König und ihre individuellen Lebensgeschichten. Es verdeutlicht die Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit des Lebenswandels des Königs und die Bandbreite der Frauen, die in seinen Lebenskreis gerieten.
Schlüsselwörter
Louis XV., Mätressen, Marquise de Pompadour, Madame Dubarry, Mailly-Nesle, Frankreich, 18. Jahrhundert, Hofintrigen, Politik, Gesellschaft, Moral, bürgerliche Herkunft, Adel, Französische Revolution, Liebesbeziehungen, königliche Ausschweifungen, Einfluss, Macht.
Häufig gestellte Fragen zum Buch "Louis XV. und seine Mätressen"
Was ist der zentrale Gegenstand des Buches "Louis XV. und seine Mätressen"?
Das Buch untersucht das Leben von König Louis XV. und seine zahlreichen Beziehungen zu verschiedenen Frauen. Es beleuchtet die Rolle der Mätressen am französischen Hof, deren Einfluss auf den König und die Politik, sowie die sozialen und moralischen Aspekte dieser Beziehungen. Ein zentrales Thema ist die Frage, ob Louis XV. ein Täter oder Opfer seiner Umstände war.
Welche Themenschwerpunkte werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt das Leben und die Persönlichkeit Louis XV., die Rolle und den Status von Mätressen am französischen Hof, den Einfluss der Mätressen auf Politik und Gesellschaft, die individuellen Geschichten der Mätressen und die sozialen und moralischen Aspekte des Mätressenwesens im 18. Jahrhundert.
Welche wichtigen Mätressen von Louis XV. werden im Buch vorgestellt?
Das Buch widmet sich ausführlich der Marquise de Pompadour, Madame Dubarry und den vier Schwestern de Mailly-Nesle. Zusätzlich werden weitere Mätressen des Königs erwähnt und ihre Beziehungen zu ihm skizziert.
Wie wird die Persönlichkeit Louis XV. dargestellt?
Das Buch beschreibt Louis XV. von seiner Kindheit und Jugend, geprägt von Verlusten und strenger Erziehung, bis hin zu seinem späteren Leben. Es beleuchtet seine Schüchternheit, Unsicherheit und seine Popularität als "der Vielgeliebte", die später in den Ruf als "der Ungeliebte" umschlug. Die Darstellung seiner frühen Jahre soll einen Einblick in die Entstehung seiner Persönlichkeit und den möglichen Einfluss auf seinen späteren Lebenswandel geben.
Welche Rolle spielten die Mätressen am französischen Hof?
Das Buch beschreibt die Mätressen als halboffizielle Geliebte der Fürsten mit oft erheblichem Einfluss auf politische Entscheidungen und das gesellschaftliche Leben. Ihr Status, ihre Rolle am Hof und die gesellschaftlichen und religiösen Aspekte ihrer Beziehungen werden detailliert untersucht.
Wie wird die Beziehung zwischen Louis XV. und der Marquise de Pompadour dargestellt?
Das Kapitel über die Marquise de Pompadour erzählt ihre Lebensgeschichte vom bürgerlichen Hintergrund bis zu ihrem Aufstieg zur einflussreichen Mätresse des Königs. Analysiert werden ihre Beziehung zu Louis XV., ihr Einfluss auf Politik und Kunst sowie ihre strategischen Manöver am Hof.
Welche Bedeutung hat die Geschichte von Madame Dubarry?
Die Geschichte Madame Dubarrys, vom Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen zur letzten offiziellen Mätresse Louis XV., wird als Beispiel für einen außergewöhnlichen Lebensweg dargestellt. Es wird auf ihre strategischen Beziehungen am Hof, ihre Konflikte mit Marie Antoinette und ihren tragischen Tod während der Französischen Revolution eingegangen.
Welche Schlussfolgerungen zieht das Buch hinsichtlich der Frage, ob Louis XV. Täter oder Opfer war?
Diese Frage wird im Vorwort aufgeworfen und durch die Darstellung des Lebens Louis XV. und seiner Beziehungen zu seinen Mätressen im gesamten Buch beantwortet. Es wird eine umfassende Analyse der Umstände und Motive aller Beteiligten vorgestellt, um zu einer fundierten Schlussfolgerung zu gelangen.
Für wen ist dieses Buch geeignet?
Das Buch ist für alle geeignet, die sich für die Geschichte Frankreichs im 18. Jahrhundert, die Rolle von Frauen am Hofe, die Lebensgeschichte von Louis XV. und die sozialen und moralischen Aspekte des Mätressenwesens interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Buch am besten?
Louis XV., Mätressen, Marquise de Pompadour, Madame Dubarry, Mailly-Nesle, Frankreich, 18. Jahrhundert, Hofintrigen, Politik, Gesellschaft, Moral, bürgerliche Herkunft, Adel, Französische Revolution, Liebesbeziehungen, königliche Ausschweifungen, Einfluss, Macht.
Details
- Titel
- Pompadour und Dubarry. Die Mätressen von Louis XV.
- Autor
- Ernst Probst (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 310
- Katalognummer
- V175589
- ISBN (eBook)
- 9783640966530
- ISBN (Buch)
- 9783640966882
- Dateigröße
- 19973 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Marie Antoinette
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Ernst Probst (Autor:in), 2011, Pompadour und Dubarry. Die Mätressen von Louis XV., München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/175589
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-