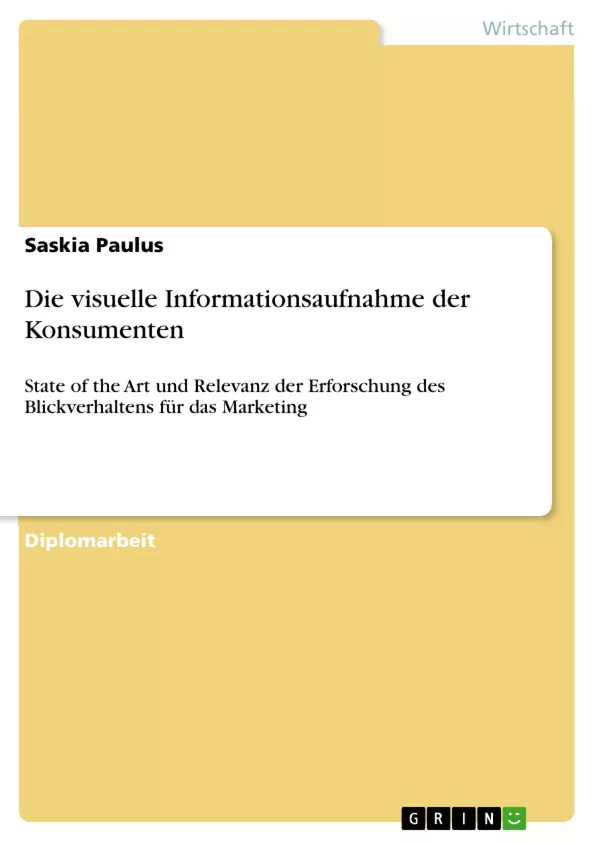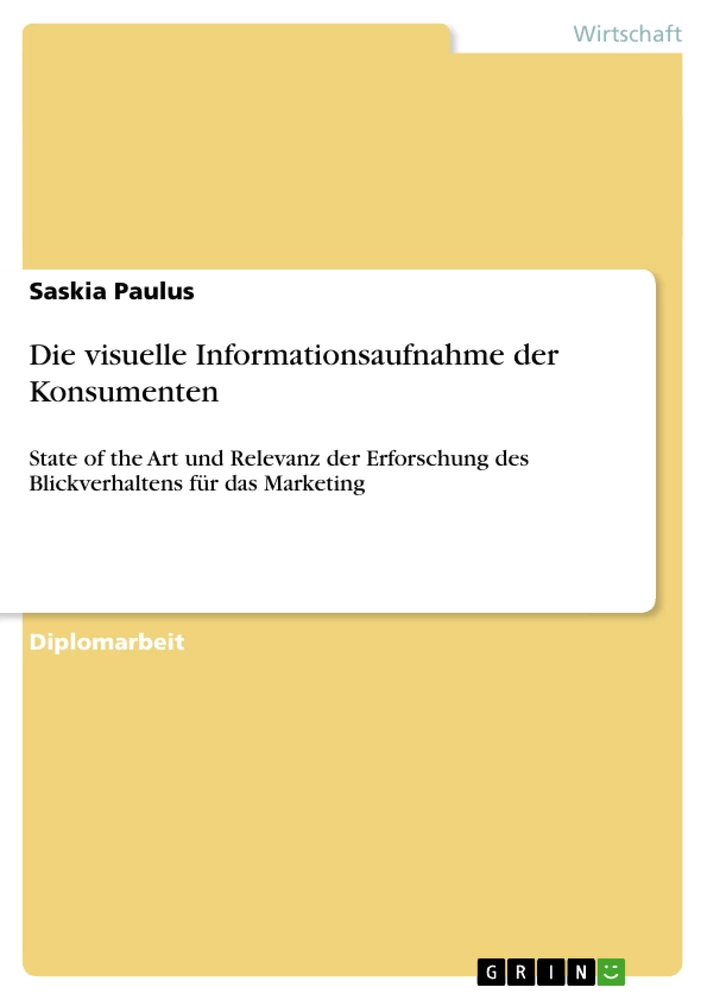
Die visuelle Informationsaufnahme der Konsumenten
Diplomarbeit, 2009
105 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen zur Informationsverarbeitung von Konsumenten
- 2.1 Modales Modell als theoretische Grundlage für Informationsverarbeitungsprozesse
- 2.2 Steuerungsprozesse im Rahmen der Informationsverarbeitungsprozesse
- 2.3 Theoretische Grundlagen visueller Informationsverarbeitung
- 3. Interdependenz zwischen Blickverhalten und Informationsverarbeitungsprozessen
- 3.1 Anatomie des Auges und physiologische Grundlagen des Sehprozesses
- 3.2 Aufbau und Funktion visueller Areale im Gehirn
- 3.3 Zusammenhang zwischen Augenbewegungen und Informationsverarbeitungsprozessen
- 3.4 Zusammenhang zwischen Fixation und Informationsverarbeitungsprozessen
- 3.5 Unbewusste Prozesse in Zusammenhang mit visueller Informationsverarbeitung
- 3.6 Parameter der Blickregistrierung
- 3.6.1 Parameter der Sakkaden
- 3.6.2 Parameter der Fixationen
- 4. Messung des Blickverhaltens und allgemeine Anforderung an die Gütekriterien der Messmethoden
- 4. 1 Allgemeine Anforderungen an Blickregistrierungssysteme
- 4.2 Okulometrische Messmethoden zur Erfassung des Blickverhaltens von Konsumenten
- 4. 3 Allgemeine Anforderungen an Gütekriterien im Rahmen der Blickbewegungsregistrierung
- 4.4 Konzeption von Eye-Tracking-Experimenten - Methodische Anforderungen an Feld - und Laborexperimente
- 5. Interferenz zwischen Blickverhalten und Werbewirkung: Erkenntnisse aus der verhaltenswissenschaftlichen Marketingforschung und Implikationen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die visuelle Informationsaufnahme von Konsumenten und beleuchtet die Relevanz der Erforschung des Blickverhaltens für das Marketing. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Prozesse der visuellen Informationsverarbeitung zu vermitteln und aufzuzeigen, wie diese Erkenntnisse im Marketing eingesetzt werden können.
- Theoretische Grundlagen der Informationsverarbeitung von Konsumenten
- Zusammenhang zwischen Blickverhalten und Informationsverarbeitungsprozessen
- Methoden zur Messung des Blickverhaltens
- Anwendungen von Eye-Tracking im Marketing
- Implikationen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen zur Informationsverarbeitung von Konsumenten dar und beleuchtet insbesondere das modale Modell sowie Steuerungsprozesse und die visuelle Informationsverarbeitung. Kapitel 3 widmet sich der Interdependenz zwischen Blickverhalten und Informationsverarbeitungsprozessen. Es behandelt dabei die Anatomie des Auges, den Aufbau visueller Gehirnareale und die Zusammenhänge zwischen Augenbewegungen und Informationsverarbeitungsprozessen sowie die Parameter der Blickregistrierung. Kapitel 4 befasst sich mit der Messung des Blickverhaltens, den Anforderungen an Blickregistrierungssysteme und den Gütekriterien der Messmethoden. Das Kapitel behandelt auch die Konzeption von Eye-Tracking-Experimenten und die methodischen Anforderungen an Feld- und Laborexperimente. Kapitel 5 beleuchtet die Interferenz zwischen Blickverhalten und Werbewirkung und präsentiert Erkenntnisse aus der verhaltenswissenschaftlichen Marketingforschung sowie deren Implikationen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet wichtige Themen wie visuelle Informationsverarbeitung, Blickverhalten, Eye-Tracking, Marketing, Werbewirkung, Konsumentenverhalten und kognitive Prozesse.
Details
- Titel
- Die visuelle Informationsaufnahme der Konsumenten
- Untertitel
- State of the Art und Relevanz der Erforschung des Blickverhaltens für das Marketing
- Hochschule
- Universität des Saarlandes (Institut für Konsum- und Verhaltensforschung)
- Veranstaltung
- Marketing
- Note
- 1,3
- Autor
- Saskia Paulus (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 105
- Katalognummer
- V175592
- ISBN (eBook)
- 9783640967445
- ISBN (Buch)
- 9783640967711
- Dateigröße
- 2368 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Eye Tracking Blickverhalten State of the Art Informationsverarbeitung Blickregistrierung Messmethoden Werbewirkung Eye Tracker Software-Systeme
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Saskia Paulus (Autor:in), 2009, Die visuelle Informationsaufnahme der Konsumenten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/175592
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-