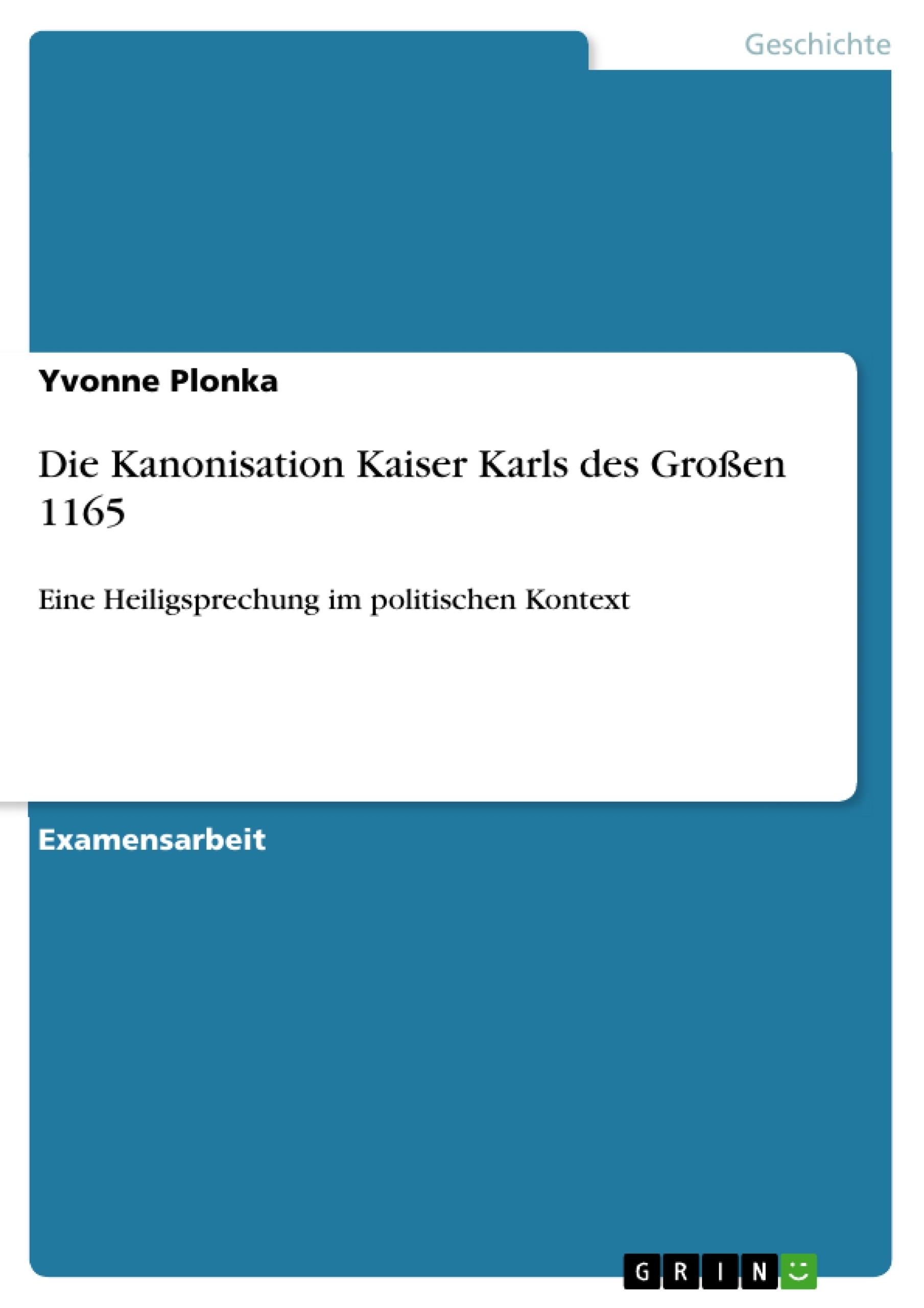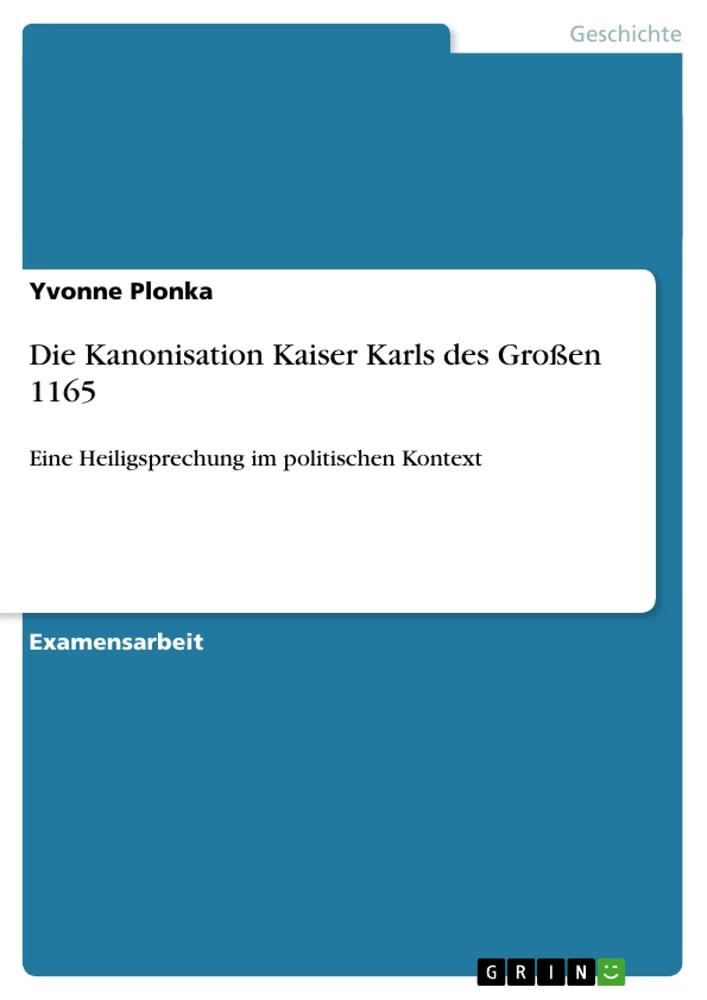
Die Kanonisation Kaiser Karls des Großen 1165
Examensarbeit, 2006
125 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedrich I. Barbarossa und Karl der Große
- Der Kultakt vom 29. Dezember 1165
- Das Barbarossa-Privileg für die Stadt Aachen
- Die Aachener Vita Karoli Magni
- Saint-Denis und Westminster in ihrer Vorbildfunktion für Aachen
- Politischer Kontext
- Zur Politik Friedrich I. Barbarossas - ein kurzer Abriss
- Papst Alexander III. und der kaiserliche Gegenpapst Paschalis
- Der Würzburger Hoftag zu Pfingsten 1165
- Zum Herrschaftsverständnis Friedrich I. Barbarossas
- Mögliche Kritikpunkte an dem Kanonisationsverfahren Karls des Großen
- Vorbemerkung
- Was galt im Mittelalter als heilig?
- Die besondere Entwicklung des Heiligsprechungsverfahren im Mittelalter
- Besonderheiten bei der Kanonisation Karls des Großen
- Otto III. und Karl der Große
- Vorbemerkung
- Graböffnung durch Otto III.
- Vorgang der Graböffnung
- Die Glaubwürdigkeit der Quellen
- Plante Kaiser Otto III. eine Heiligsprechung Karls des Großen?
- Zur politisch ideologisierten Figur Karls des Großen
- Vorbemerkung
- Leben und Wirken Karls des Großen - des ersten abendländischen Kaisers
- Karl der Große und Aachen
- Die Intention Friedrich I. Barbarossas bezüglich der Kanonisation Kaisers Karls des Großen
- Vorbemerkung
- Karl der Große - ein Reichsheiliger?
- Die Kanonisation Karls des Großen - ein Schlag gegen Frankreich?
- Der Barbarossaleuchter
- Karl der Große - ein unbekannter und/oder verkannter Heiliger?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kanonisation Karls des Großen im Jahr 1165 durch Friedrich I. Barbarossa. Die zentrale Fragestellung ist die Analyse der Intentionen Barbarossas hinter diesem Akt. Es wird untersucht, ob religiöse Verehrung oder politische Strategien im Vordergrund standen.
- Die politischen Motive Friedrich Barbarossas bei der Kanonisation.
- Die Rolle Karls des Großen als Identifikationsfigur im Mittelalter.
- Das Heiligsprechungsverfahren im Mittelalter und seine Besonderheiten.
- Der Vergleich der Kanonisation mit ähnlichen Ereignissen in anderen europäischen Ländern.
- Die Bedeutung Aachens im Kontext der Kanonisation.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den Intentionen Friedrich Barbarossas bei der Kanonisation Karls des Großen. Sie skizziert die historische Bedeutung Karls des Großen und seinen anhaltenden Einfluss im Mittelalter. Die Arbeit fokussiert auf die politischen und religiösen Aspekte der Heiligsprechung und deren Kontext innerhalb der damaligen Herrschaftsstrukturen.
2. Friedrich I. Barbarossa und Karl der Große: Dieses Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Barbarossa und Karl dem Großen, untersucht den Kultakt vom 29. Dezember 1165 in Aachen detailliert und analysiert das Barbarossa-Privileg für Aachen. Es setzt sich mit der Aachener Vita Karoli Magni auseinander und vergleicht die Rolle Aachens mit ähnlichen bedeutenden Orten wie Saint-Denis und Westminster. Der Fokus liegt auf der Zusammenstellung von Fakten und Quellen zur Rekonstruktion des Ereignisses und seiner unmittelbaren Folgen.
3. Politischer Kontext: Dieses Kapitel beschreibt den politischen Kontext der Kanonisation, indem es die Politik Friedrichs I. Barbarossas, das Verhältnis zwischen Kaiser und Papst (Alexander III. und der Gegenpapst Paschalis), und den Würzburger Hoftag von 1165 beleuchtet. Es analysiert das Herrschaftsverständnis Barbarossas und dessen Rolle in der politischen Landschaft des 12. Jahrhunderts. Der Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung des Ereignisses mit den herrschenden Machtstrukturen und politischen Konflikten der Zeit.
4. Mögliche Kritikpunkte an dem Kanonisationsverfahren Karls des Großen: Dieses Kapitel befasst sich mit den möglichen Kritikpunkten an dem Verfahren. Es erörtert die mittelalterlichen Heiligsprechungskriterien, die Besonderheiten des Verfahrens im Mittelalter und die spezifischen Aspekte bei der Kanonisation Karls des Großen. Es analysiert, inwiefern das Verfahren den damaligen Standards entsprach und welche Einwände gegen die Heiligsprechung geäußert werden könnten.
5. Otto III. und Karl der Große: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Otto III. und Karl dem Großen, insbesondere die Graböffnung durch Otto III. Es bewertet die Glaubwürdigkeit der Quellen und untersucht, ob Otto III. bereits eine Heiligsprechung Karls des Großen plante. Es wird die Kontinuität der Verehrung und der Versuch einer legitimatorischen Aneignung des Erbes Karls des Großen durch Otto III. untersucht.
6. Zur politisch ideologisierten Figur Karls des Großen: Dieses Kapitel behandelt die politisch-ideologische Bedeutung Karls des Großen, sein Leben und Wirken als erster abendländischer Kaiser, und seine Verbindung zu Aachen. Es analysiert wie die Figur Karls des Großen für politische Zwecke instrumentalisiert wurde und wie diese Instrumentalisierung in der Kanonisation zum Ausdruck kommt.
7. Die Intention Friedrich I. Barbarossas bezüglich der Kanonisation Kaisers Karls des Großen: Dieses Kapitel untersucht die Intentionen Friedrichs I. Barbarossas bei der Kanonisation Karls des Großen. Es analysiert die Frage, ob Karl der Große als Reichsheiliger gedacht war, und ob die Kanonisation als ein Schlag gegen Frankreich verstanden werden kann. Der Barbarossaleuchter wird im Kontext der Kanonisation und der politischen Ziele Barbarossas interpretiert.
8. Karl der Große - ein unbekannter und/oder verkannter Heiliger?: Dieses Kapitel bewertet den Bekanntheitsgrad und die Rezeption Karls des Großen als Heiliger. Es untersucht die langfristige Wirkung der Heiligsprechung und den anhaltenden Stellenwert Karls des Großen in der europäischen Geschichte und Kultur.
Häufig gestellte Fragen: Kanonisation Karls des Großen durch Friedrich I. Barbarossa
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Kanonisation Karls des Großen im Jahr 1165 durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Der zentrale Fokus liegt auf der Untersuchung der Intentionen Barbarossas hinter diesem Akt – waren es religiöse Verehrung oder politische Strategien, die ihn dazu bewogen?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die politischen Motive Friedrichs I. Barbarossas, die Rolle Karls des Großen als Identifikationsfigur im Mittelalter, das Heiligsprechungsverfahren im Mittelalter und dessen Besonderheiten, einen Vergleich mit ähnlichen Ereignissen in anderen europäischen Ländern, und die Bedeutung Aachens im Kontext der Kanonisation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Friedrich I. Barbarossa und Karl der Große, Politischer Kontext, Mögliche Kritikpunkte an dem Kanonisationsverfahren Karls des Großen, Otto III. und Karl der Große, Zur politisch ideologisierten Figur Karls des Großen, Die Intention Friedrich I. Barbarossas bezüglich der Kanonisation Kaisers Karls des Großen, und Karl der Große – ein unbekannter und/oder verkannter Heiliger?
Was ist der Inhalt des Kapitels "Friedrich I. Barbarossa und Karl der Große"?
Dieses Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Barbarossa und Karl dem Großen, untersucht den Kultakt vom 29. Dezember 1165 in Aachen, analysiert das Barbarossa-Privileg, die Aachener Vita Karoli Magni und vergleicht Aachen mit Saint-Denis und Westminster.
Was wird im Kapitel "Politischer Kontext" behandelt?
Das Kapitel beschreibt den politischen Kontext der Kanonisation, Barbarossas Politik, das Verhältnis zum Papst (Alexander III. und Gegenpapst Paschalis), den Würzburger Hoftag 1165 und Barbarossas Herrschaftsverständnis.
Welche Kritikpunkte am Kanonisationsverfahren werden diskutiert?
Das Kapitel "Mögliche Kritikpunkte" erörtert die mittelalterlichen Heiligsprechungskriterien, die Besonderheiten des Verfahrens im Mittelalter und spezifische Aspekte bei der Kanonisation Karls des Großen.
Welche Rolle spielt Otto III. in der Arbeit?
Das Kapitel über Otto III. analysiert dessen Zusammenhang mit Karl dem Großen, insbesondere die Graböffnung durch Otto III., die Glaubwürdigkeit der Quellen und die Frage, ob Otto III. eine Heiligsprechung plante.
Wie wird Karl der Große politisch-ideologisch dargestellt?
Das Kapitel zur politisch ideologisierten Figur Karls des Großen behandelt dessen Leben und Wirken, seine Verbindung zu Aachen und die Instrumentalisierung seiner Figur für politische Zwecke.
Welche Intentionen Barbarossas werden untersucht?
Das Kapitel zu Barbarossas Intentionen analysiert, ob Karl der Große als Reichsheiliger gedacht war und ob die Kanonisation als Schlag gegen Frankreich verstanden werden kann. Der Barbarossaleuchter wird in diesem Kontext interpretiert.
Wie wird der Bekanntheitsgrad Karls des Großen als Heiliger bewertet?
Das letzte Kapitel bewertet den Bekanntheitsgrad und die Rezeption Karls des Großen als Heiliger und untersucht die langfristige Wirkung der Heiligsprechung.
Details
- Titel
- Die Kanonisation Kaiser Karls des Großen 1165
- Untertitel
- Eine Heiligsprechung im politischen Kontext
- Hochschule
- Universität Duisburg-Essen
- Note
- 2,0
- Autor
- Yvonne Plonka (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 125
- Katalognummer
- V175968
- ISBN (Buch)
- 9783640970926
- ISBN (eBook)
- 9783640971381
- Dateigröße
- 871 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kanonisation kaiser karls großen eine heiligsprechung kontext
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Yvonne Plonka (Autor:in), 2006, Die Kanonisation Kaiser Karls des Großen 1165, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/175968
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-