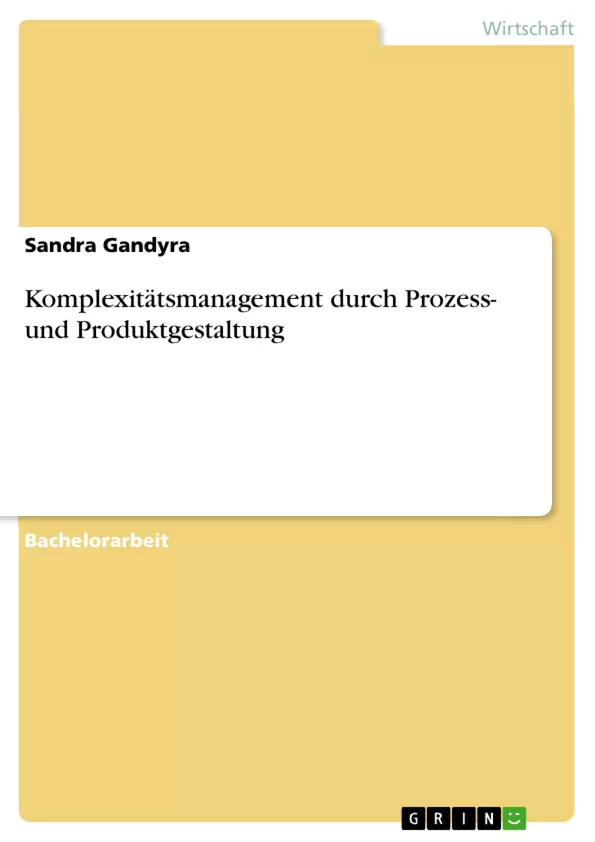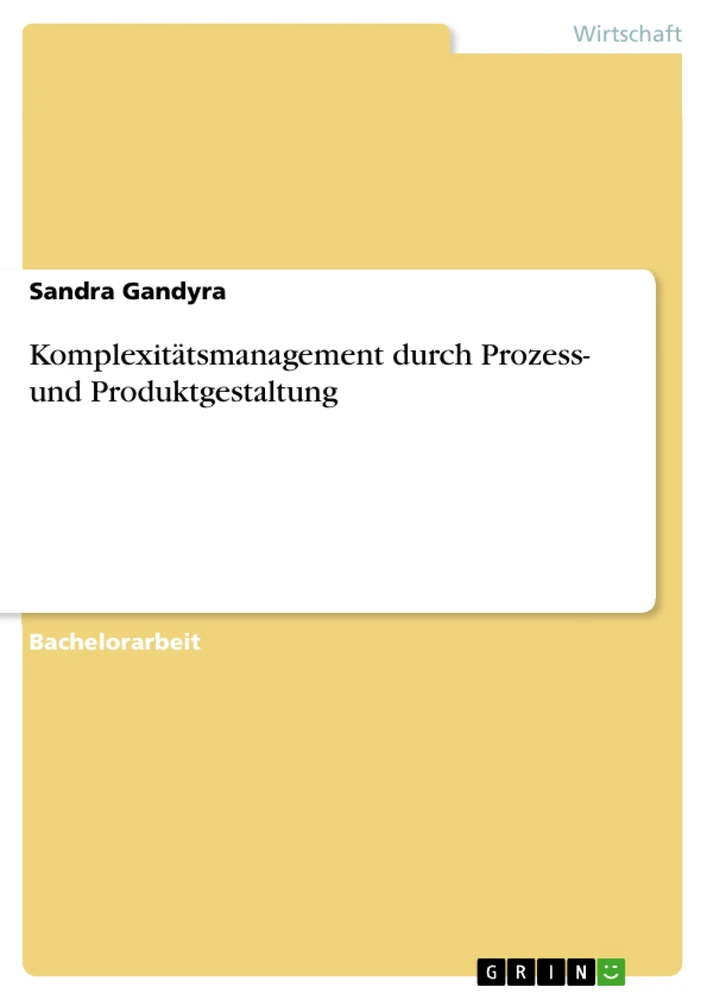
Komplexitätsmanagement durch Prozess- und Produktgestaltung
Bachelorarbeit, 2011
28 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen zum Komplexitätsmanagement
- Begriffsabgrenzungen
- Komplexität als Herausforderung des Managements
- Kosten- und Nutzenwirkung der Komplexität
- Abgrenzung der Gestaltungsansätze zur Reduktion und Beherrschung der Komplexität
- Variantenmanagement
- Modulare Organisation
- Prozessorientierung
- Analyse der Gestaltungsansätze zur Komplexitätsreduktion und -beherrschung
- Vor- und Nachteile
- Wechselwirkungen
- Kritische Würdigung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert, wie Unternehmen durch die Gestaltung von Produkten und Prozessen mit der Komplexität im Unternehmen umgehen können. Sie untersucht die Vor- und Nachteile sowie die Wechselwirkungen der verschiedenen Gestaltungsansätze.
- Bedeutung des Komplexitätsmanagements in der heutigen Unternehmensumwelt
- Analyse der Ursachen und Auswirkungen von Komplexität
- Präsentation von Gestaltungsansätzen zur Reduktion und Beherrschung der Komplexität
- Bewertung der Vor- und Nachteile sowie Wechselwirkungen der einzelnen Ansätze
- Zusammenfassendes Fazit zur Fragestellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Kapitel beleuchtet die steigende Komplexität in Unternehmen durch Globalisierung, den Wandel von Verkäufer- zu Käufermärkten und den technologischen Wandel. Es wird deutlich, dass die Komplexität im Unternehmen steigende Koordinationskosten und Herausforderungen für das Produktionsmanagement bedeutet. Die Arbeit untersucht, wie durch die Gestaltung von Produkten und Prozessen mit der Komplexität umgegangen werden kann.
Grundlagen zum Komplexitätsmanagement
Das Kapitel beleuchtet die Definition von Komplexität und ihre Auswirkungen auf Unternehmen. Es werden die Komplexitätstreiber, die interne und externe Dimensionen der Komplexität sowie die Strategien des Komplexitätsmanagements erläutert.
Abgrenzung der Gestaltungsansätze zur Reduktion und Beherrschung der Komplexität
Dieses Kapitel stellt verschiedene Gestaltungsansätze zur Reduktion und Beherrschung der Komplexität vor. Es geht auf das Variantenmanagement, die modulare Organisation und die Prozessorientierung ein.
Analyse der Gestaltungsansätze zur Komplexitätsreduktion und -beherrschung
Das Kapitel analysiert die vorgestellten Gestaltungsansätze und beleuchtet ihre Vor- und Nachteile sowie die Wechselwirkungen. Es werden die jeweiligen Ansätze kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Komplexitätsmanagement, Unternehmensumwelt, Globalisierung, Produktportfolio, Variantenmanagement, modulare Organisation, Prozessorientierung, Komplexitätsreduktion, Komplexitätsbeherrschung.
Details
- Titel
- Komplexitätsmanagement durch Prozess- und Produktgestaltung
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum
- Autor
- Sandra Gandyra (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 28
- Katalognummer
- V176189
- ISBN (Buch)
- 9783640973934
- ISBN (eBook)
- 9783640974078
- Dateigröße
- 483 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Komplexität Komplexitätsmanagement Fertigungssegmentierung Prozessorientierung Variantenmanagement
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Sandra Gandyra (Autor:in), 2011, Komplexitätsmanagement durch Prozess- und Produktgestaltung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/176189
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-