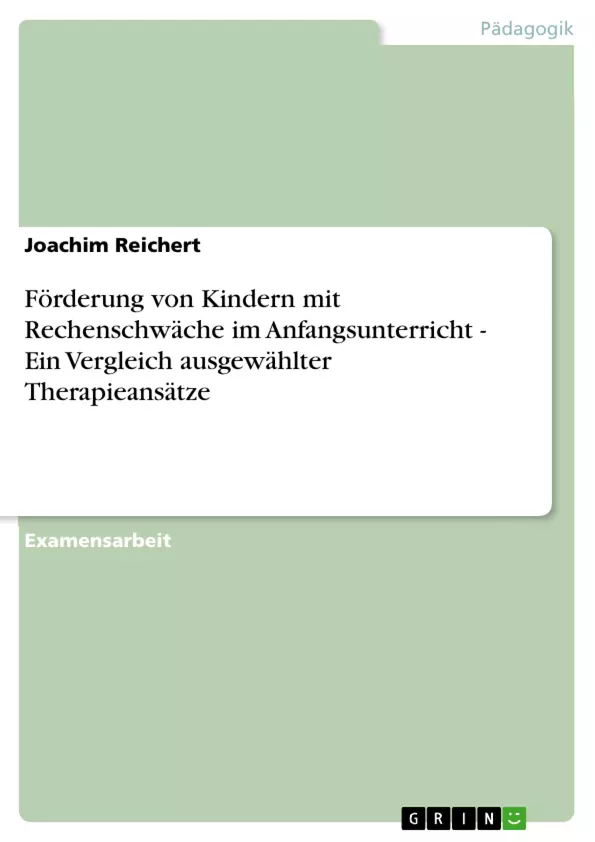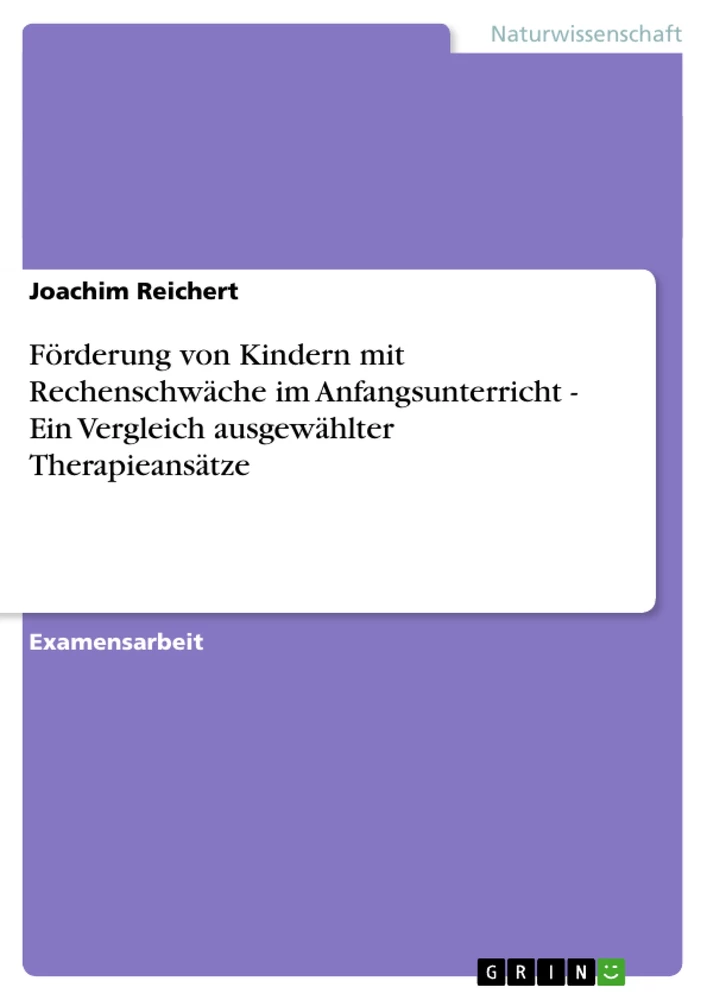
Förderung von Kindern mit Rechenschwäche im Anfangsunterricht - Ein Vergleich ausgewählter Therapieansätze
Examensarbeit, 2009
123 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Rechenschwäche
- 1.1 Definition
- 1.2 Prävalenz von Rechenschwäche
- 1.3 Stellenwert der Rechenschwäche in der Schule
- 2. Erklärungsansätze für Rechenschwäche
- 2.1 Das Triple Code Modell von Dehaene
- 2.2 Das Modell von Anderson
- 2.3 Teilleistungsstörungen als Ursache der Rechenschwäche
- 3. Vorstellung der Förderkonzepte
- 3.1 Diagnostik der Rechenschwäche
- 3.2 Das Dortmunder Zahlbegriffstraining
- 3.2.1 Förderprinzipien
- 3.2.2 Konkrete Lerninhalte
- 3.3 Warum Kinder an Mathe scheitern, wie man Rechenschwäche wirklich heilt
- 3.3.1 Ansatzpunkt der Therapie
- 3.3.2 Wassergläser als Therapiematerialien
- 3.3.3 Ablauf der Therapie
- 3.4 Finger, Bilder, Rechnen
- 3.4.1 Ansatzpunkt der Therapie
- 3.4.2 Das Material
- 3.4.3 Konkrete Arbeit mit dem HamZaRa
- 3.5 Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern
- 3.5.1 Ansätze der Therapie
- 3.5.2 Ablauf der Therapie
- 3.6 Das Konzept von Gerster und Schultz
- 3.6.1 Ansatzpunkte der Therapie
- 3.6.2 Konkrete Arbeit mit dem Förderkonzept
- 4. Vergleichende Analyse der Förderkonzepte
- 4.1 Zum Einsatz der Therapien im Regelunterricht
- 4.2 Lerndialog im Kontext der Förderung
- 4.3 Analyse und Vergleich der verwendeten Materialien
- 4.3.1 Das Zehnerfeld
- 4.3.2 Die Schüttelbox
- 4.3.3 Zehnersteckbrett
- 4.3.4 Wassergläser
- 4.3.5 Der strukturierte Zahlenstrahl
- 4.4 Begründung der Untersuchung ausgewählter Inhaltsbereiche der Förderkonzepte
- 4.5 Die Erarbeitung der Zählkompetenz
- 4.5.1 Die fünf Zählprinzipien
- 4.5.2 Die Zahlwortreihe
- 4.6 Förderung des kardinalen Zahlbegriffs
- 4.6.1 Zur Rolle der Simultanerfassung bei Rechenschwäche
- 4.7 Das Teile-Ganze Konzept
- 4.8 Addition und Subtraktion
- 4.8.1 Das Operative Prinzip
- 4.8.2 Das Operationsverständnis
- 4.8.3 Symbolische Schreibweise der Grundoperationen
- 4.9 Erarbeitung von Rechenstrategien
- 4.9.1 Zählende Rechenstrategien
- 4.9.2 Schwierigkeiten des zählenden Rechnens
- 4.9.3 Evaluation des Dortmunder Zahlbegriffsaufbaus
- 4.9.4 Die Bedeutung von Grundaufgaben für nicht-zählende Rechenstrategien, sowie der Automatisierung des Einspluseins und Einsminuseins
- 4.10 Das dekadische Positionssystem und der Zehnerübergang
- 4.10.1 Das dekadische Positionssystem
- 4.10.2 Der Zehnerübergang
- 4.11 Sachsituationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Therapieansätze zur Förderung von Kindern mit Rechenschwäche im Anfangsunterricht. Ziel ist ein vergleichender Überblick über ausgewählte Förderkonzepte und deren Eignung für den Regelunterricht. Die Arbeit analysiert die jeweiligen methodischen Ansätze, Materialien und didaktischen Prinzipien.
- Definition und Prävalenz von Rechenschwäche
- Vergleich verschiedener Erklärungsmodelle für Rechenschwäche
- Analyse verschiedener Förderkonzepte
- Vergleichende Betrachtung der Fördermaterialien
- Eignung der Konzepte für den Regelunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Rechenschwäche: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den Schwierigkeiten, die bei der Diagnose von Rechenschwäche auftreten. Es werden verschiedene Definitionen aus der ICD-10 und dem DSM-IV-TR vorgestellt und kritisch beleuchtet, insbesondere die Problematik des Diskrepanzkriteriums zwischen Rechenleistung und Intelligenzquotient. Der Stellenwert der Rechenschwäche im schulischen Kontext wird ebenfalls thematisiert und die unterschiedlichen Ansätze zur Definition werden diskutiert, inklusive der Forschungsergebnisse von Gonzales und Espinol (2002) bezüglich Sachaufgaben und dem IQ.
2. Erklärungsansätze für Rechenschwäche: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Modelle, die versuchen, die Ursachen von Rechenschwäche zu erklären. Es werden das „Triple-Code-Modell“ von Dehaene und das Modell von Anderson vorgestellt und detailliert erläutert. Zusätzlich werden Teilleistungsstörungen als mögliche Ursache der Rechenschwäche diskutiert, und die jeweiligen Stärken und Schwächen der Modelle werden gegenübergestellt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der kognitiven Prozesse, die dem Rechnen zugrunde liegen und wie deren Beeinträchtigung zu Rechenschwäche führen kann.
3. Vorstellung der Förderkonzepte: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Förderkonzepte für Kinder mit Rechenschwäche. Es werden das Dortmunder Zahlbegriffstraining, die Methode „Warum Kinder an Mathe scheitern, wie man Rechenschwäche wirklich heilt“, die Methode „Finger, Bilder, Rechnen“, die Methode „Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern“, und das Konzept von Gerster und Schultz detailliert vorgestellt. Für jedes Konzept werden die zugrundeliegenden Prinzipien, Materialien und der konkrete Ablauf der Förderung erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Vielfalt der Ansätze und ihrer jeweiligen Besonderheiten.
4. Vergleichende Analyse der Förderkonzepte: In diesem Kapitel werden die in Kapitel 3 vorgestellten Förderkonzepte miteinander verglichen und analysiert. Es werden die Eignung der Konzepte für den Regelunterricht, die Rolle des Lerndialogs und die verwendeten Materialien (z.B. Zehnerfeld, Schüttelbox, Wassergläser) detailliert untersucht und kritisch bewertet. Der Vergleich der Konzepte hinsichtlich ihrer Eignung zur Förderung verschiedener Aspekte des Rechenverständnisses (z.B. Zählkompetenz, Kardinalzahlbegriff, Rechenoperationen, Rechenstrategien, dekadisches Positionssystem) bildet einen zentralen Bestandteil dieses Kapitels. Die Analyse der einzelnen Inhaltsbereiche der Förderkonzepte bildet den Schwerpunkt, um Stärken und Schwächen herauszuarbeiten und mögliche Synergien aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Rechenschwäche, Dyskalkulie, Förderkonzepte, Zahlbegriffstraining, Diagnostik, Mathematikdidaktik, Grundrechenarten, kognitive Prozesse, Lernschwierigkeiten, Fördermaterialien, Regelunterricht, Lerndialog, Teilleistungsstörungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Förderkonzepte bei Rechenschwäche
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Förderkonzepte für Kinder mit Rechenschwäche. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich verschiedener Therapieansätze und deren Eignung für den Regelunterricht. Es werden sowohl theoretische Erklärungsmodelle für Rechenschwäche als auch konkrete Fördermethoden mit ihren Materialien und didaktischen Prinzipien detailliert beschrieben und analysiert.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Prävalenz von Rechenschwäche, Erklärungsansätze für Rechenschwäche (inkl. des Triple-Code-Modells von Dehaene und dem Modell von Anderson), verschiedene Förderkonzepte (z.B. Dortmunder Zahlbegriffstraining, "Warum Kinder an Mathe scheitern...", "Finger, Bilder, Rechnen", Konzept von Gerster und Schultz), vergleichende Analyse der Förderkonzepte (inkl. Materialvergleich und Eignung für den Regelunterricht), die Förderung von Zählkompetenz und Kardinalzahlbegriff, Addition und Subtraktion, Rechenstrategien und das dekadische Positionssystem.
Welche Förderkonzepte werden vorgestellt und verglichen?
Das Dokument stellt und vergleicht folgende Förderkonzepte: Das Dortmunder Zahlbegriffstraining, die Methode "Warum Kinder an Mathe scheitern, wie man Rechenschwäche wirklich heilt", die Methode "Finger, Bilder, Rechnen", die Methode "Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern", und das Konzept von Gerster und Schultz. Der Vergleich umfasst die methodischen Ansätze, die verwendeten Materialien und die didaktischen Prinzipien.
Welche Materialien werden im Zusammenhang mit den Förderkonzepten erwähnt?
Im Dokument werden verschiedene Fördermaterialien im Detail analysiert und verglichen, darunter das Zehnerfeld, die Schüttelbox, das Zehnersteckbrett, Wassergläser und der strukturierte Zahlenstrahl. Die Analyse konzentriert sich auf die Eignung der Materialien zur Unterstützung des Lernprozesses bei Kindern mit Rechenschwäche.
Wie werden die Förderkonzepte im Hinblick auf den Regelunterricht bewertet?
Die Eignung der vorgestellten Förderkonzepte für den Regelunterricht wird im Dokument kritisch bewertet. Es wird untersucht, inwiefern die Methoden und Materialien in den normalen Schulalltag integriert werden können und welche Anpassungen gegebenenfalls notwendig sind. Der Lerndialog spielt in dieser Bewertung eine wichtige Rolle.
Welche theoretischen Modelle zur Erklärung von Rechenschwäche werden diskutiert?
Das Dokument diskutiert das "Triple-Code-Modell" von Dehaene und das Modell von Anderson als Erklärungsansätze für Rechenschwäche. Zusätzlich werden Teilleistungsstörungen als mögliche Ursache betrachtet. Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Modelle werden gegenübergestellt, um ein umfassendes Verständnis der kognitiven Prozesse beim Rechnen zu ermöglichen.
Welche Aspekte des Rechenverständnisses werden im Vergleich der Förderkonzepte betrachtet?
Der Vergleich der Förderkonzepte umfasst die Förderung verschiedener Aspekte des Rechenverständnisses, darunter die Zählkompetenz, der Kardinalzahlbegriff, die Grundrechenarten (Addition und Subtraktion), die Entwicklung von Rechenstrategien (inkl. zählendes und nicht-zählendes Rechnen), das dekadische Positionssystem und der Umgang mit Sachsituationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments am besten?
Die Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments am besten beschreiben, sind: Rechenschwäche, Dyskalkulie, Förderkonzepte, Zahlbegriffstraining, Diagnostik, Mathematikdidaktik, Grundrechenarten, kognitive Prozesse, Lernschwierigkeiten, Fördermaterialien, Regelunterricht, Lerndialog, Teilleistungsstörungen.
Details
- Titel
- Förderung von Kindern mit Rechenschwäche im Anfangsunterricht - Ein Vergleich ausgewählter Therapieansätze
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau
- Note
- 1,5
- Autor
- Joachim Reichert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 123
- Katalognummer
- V176942
- ISBN (eBook)
- 9783640986828
- Dateigröße
- 1465 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- förderung kindern rechenschwäche anfangsunterricht vergleich therapieansätze
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Joachim Reichert (Autor:in), 2009, Förderung von Kindern mit Rechenschwäche im Anfangsunterricht - Ein Vergleich ausgewählter Therapieansätze, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/176942
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-