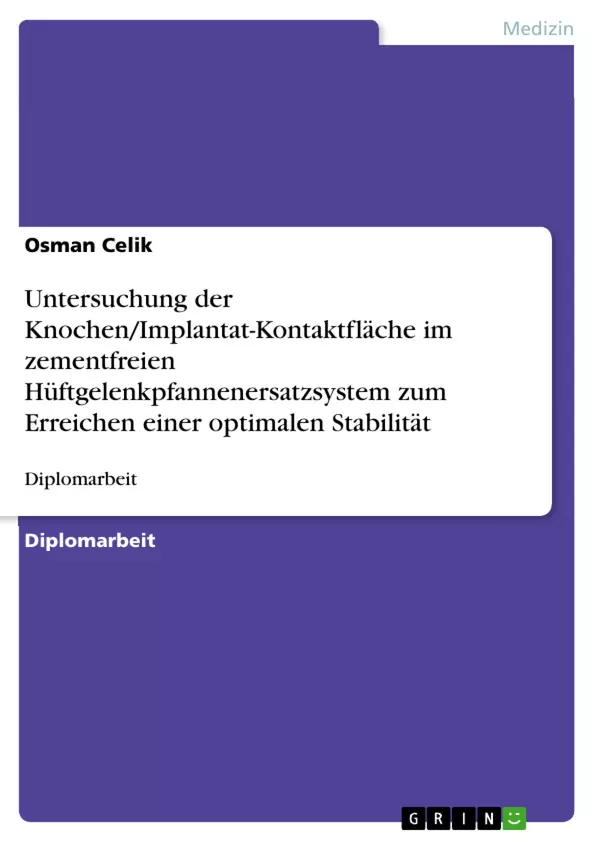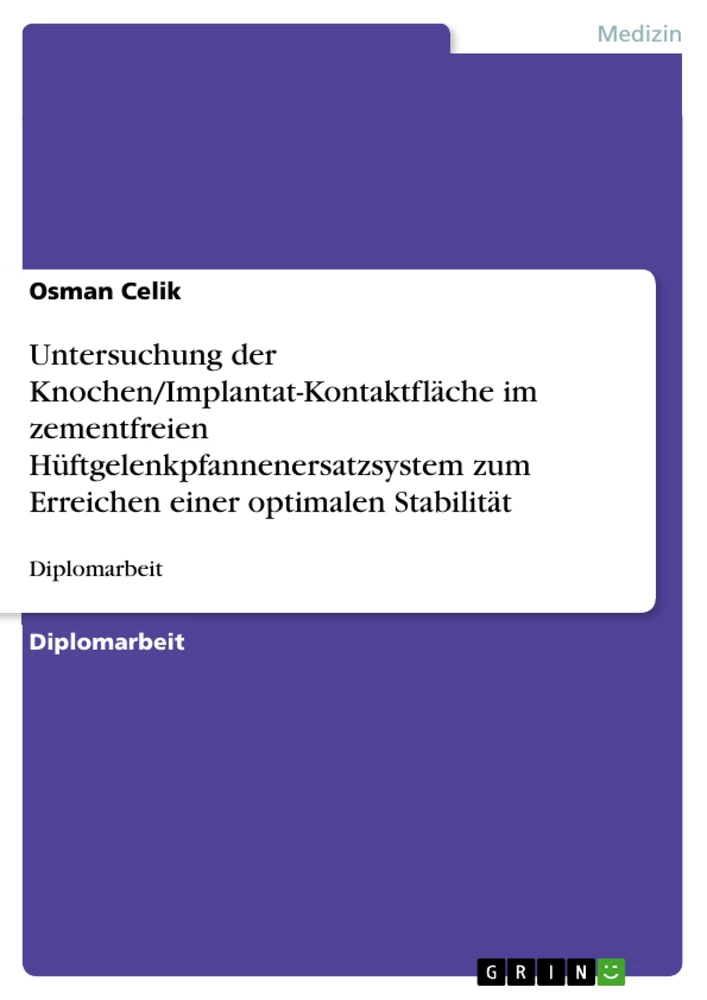
Untersuchung der Knochen/Implantat-Kontaktfläche im zementfreien Hüftgelenkpfannenersatzsystem zum Erreichen einer optimalen Stabilität
Diplomarbeit, 2008
168 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Biologische und physiologische Grundlagen
- 2.1 Anatomie und Physiologie des Hüftgelenks
- 2.1.1 Hüftgelenkpfanne
- 2.1.2 Oberschenkelkopf
- 2.1.3 Gelenkkapsel
- 2.2 Histologie
- 2.2.1 Knochengewebe
- 2.2.2 Bindegewebe
- 3 Künstlicher Hüftgelenkersatz
- 3.1 Indikation zum künstlichen Hüftgelenkersatz
- 3.2 Geschichtliche Entwicklung des künstlichen Hüftgelenkersatzes
- 3.3 Aktueller Stand
- 3.4 Operationstechnik
- 4 Die Langzeitinteraktion zwischen künstlicher Hüftgelenkpfanne und Knochenlager
- 4.1 Zeitlicher Ablauf
- 4.2 Periprothetische Membran (Interfacemembran)
- 5 Versagensursachen und -mechanismen am künstlichen Hüftgelenkpfannenersatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Kontaktfläche zwischen Knochen und Implantat im zementfreien Hüftgelenkpfannenersatzsystem, um eine optimale Stabilität zu erreichen. Die Arbeit analysiert biologische und physiologische Grundlagen, die historische Entwicklung des künstlichen Hüftgelenkersatzes und den aktuellen Stand der Technik. Ein Schwerpunkt liegt auf der Langzeitinteraktion zwischen Implantat und Knochenlager sowie den Versagensursachen und -mechanismen des Pfannenersatzes.
- Anatomie und Physiologie des Hüftgelenks
- Historische Entwicklung und aktueller Stand des Hüftgelenkersatzes
- Langzeitwechselwirkungen zwischen Implantat und Knochen
- Analyse periprothetischer Membranen
- Versagensursachen und -mechanismen des Pfannenersatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des zementfreien Hüftgelenkersatzes ein und beschreibt die steigende Anzahl der Implantationen sowie die Problematik der Langzeitstabilität, insbesondere im Bereich der Pfanne. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Stabilitätskriterien des Hüftgelenkersatzes zu erforschen und Aspekte für die Optimierung künstlicher Hüftpfannen zu identifizieren.
2 Biologische und physiologische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die Anatomie und Physiologie des Hüftgelenks, detailliert die Struktur von Knochengewebe (Kompakta und Spongiosa) im Pfannenbereich und beschreibt die Rolle verschiedener Knochenzellen beim Knochenumbau und der Bruchheilung. Zusätzlich werden die Eigenschaften des Bindegewebes an der Knochen-Implantat-Grenzfläche behandelt, da dieses die Stabilität der Prothese beeinflusst. Die detaillierte Betrachtung der Knochenstruktur und -zellen legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Implantatintegration.
3 Künstlicher Hüftgelenkersatz: Dieses Kapitel beschreibt die Indikationen für einen künstlichen Hüftgelenkersatz, die historische Entwicklung verschiedener Prothesentypen und deren Probleme (Materiallockerung, Abstoßungsreaktionen) sowie den aktuellen Stand der Technik bezüglich zementfreier Hüftpfannensysteme (Pressfit-, Schraub- und Spreizpfannen) und der Operationstechnik. Die historische Betrachtung verdeutlicht die Herausforderungen und den Fortschritt in der Entwicklung. Der aktuelle Stand der Technik bietet einen Überblick über verschiedene Implantattypen und Operationsmethoden.
4 Die Langzeitinteraktion zwischen künstlicher Hüftgelenkpfanne und Knochenlager: Dieses Kapitel fokussiert auf die Langzeitwechselwirkung zwischen Implantat und Knochen nach dem Einsetzen einer zementfreien Hüftpfanne. Es wird der zeitliche Ablauf der Interaktion in Initial-, Reparations- und Stabilisationsphase eingeteilt und detailliert beschrieben. Besonderes Augenmerk wird auf die Bildung und Klassifizierung von periprothetischen Membranen gelegt, die Aufschluss über mögliche Versagensursachen geben. Der umfassende Einblick in den Integrationsprozess des Implantats im Knochen ist zentral für das Verständnis der späteren Komplikationen.
5 Versagensursachen und -mechanismen am künstlichen Hüftgelenkpfannenersatz: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für das Versagen von Hüftpfannenimplantaten, wobei die aseptische Prothesenlockerung im Mittelpunkt steht. Es werden verschiedene Mechanismen wie unzureichende Primärstabilität, Mikrobewegungen, Spaltbildung, ungeeignetes Material, mechanische Überlastung, veränderte Lasteinleitung und abriebpartikelinduzierte Lockerung detailliert beschrieben. Zusätzlich werden Prothesenluxation und septische Prothesenlockerung sowie weitere Komplikationen erörtert. Die detaillierte Analyse der verschiedenen Versagensmechanismen bildet den Höhepunkt der Arbeit.
Schlüsselwörter
Zementfreier Hüftgelenkersatz, Osseointegration, Periprothetische Membran, Abriebpartikel, Aseptische Prothesenlockerung, Mikrobewegung, Implantatstabilität, Knochenumbau, Biokompatibilität, Operationstechnik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Zementfreier Hüftgelenkersatz
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Kontaktfläche zwischen Knochen und Implantat im zementfreien Hüftgelenkpfannenersatzsystem, um eine optimale Stabilität zu erreichen. Sie analysiert die biologischen und physiologischen Grundlagen, die historische Entwicklung und den aktuellen Stand der Technik des künstlichen Hüftgelenkersatzes. Ein Schwerpunkt liegt auf der Langzeitinteraktion zwischen Implantat und Knochenlager sowie den Versagensursachen und -mechanismen des Pfannenersatzes.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Anatomie und Physiologie des Hüftgelenks, die historische Entwicklung und den aktuellen Stand des Hüftgelenkersatzes, die Langzeitwechselwirkungen zwischen Implantat und Knochen, die Analyse periprothetischer Membranen und die Versagensursachen und -mechanismen des Pfannenersatzes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Biologische und physiologische Grundlagen, Künstlicher Hüftgelenkersatz, Die Langzeitinteraktion zwischen künstlicher Hüftgelenkpfanne und Knochenlager, und Versagensursachen und -mechanismen am künstlichen Hüftgelenkersatz. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des zementfreien Hüftgelenkersatzes.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Erforschung der Stabilitätskriterien des Hüftgelenkersatzes und die Identifizierung von Aspekten zur Optimierung künstlicher Hüftpfannen. Die Arbeit strebt danach, ein umfassendes Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Implantat und Knochengewebe zu schaffen.
Welche biologischen und physiologischen Grundlagen werden betrachtet?
Dieses Kapitel behandelt die Anatomie und Physiologie des Hüftgelenks im Detail, einschließlich der Struktur von Knochengewebe (Kompakta und Spongiosa) und der Rolle verschiedener Knochenzellen beim Knochenumbau und der Bruchheilung. Die Eigenschaften des Bindegewebes an der Knochen-Implantat-Grenzfläche werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird die historische Entwicklung des künstlichen Hüftgelenkersatzes dargestellt?
Das Kapitel zum künstlichen Hüftgelenkersatz beschreibt die Indikationen, die historische Entwicklung verschiedener Prothesentypen und deren Probleme (Materiallockerung, Abstoßungsreaktionen) sowie den aktuellen Stand der Technik bezüglich zementfreier Hüftpfannensysteme (Pressfit-, Schraub- und Spreizpfannen) und der Operationstechnik.
Welche Rolle spielt die periprothetische Membran?
Die periprothetische Membran (Interfacemembran) steht im Mittelpunkt des Kapitels über die Langzeitinteraktion. Ihre Bildung und Klassifizierung werden detailliert beschrieben, da sie wichtige Hinweise auf mögliche Versagensursachen liefert.
Welche Versagensursachen und -mechanismen werden analysiert?
Das letzte Kapitel analysiert die Ursachen für das Versagen von Hüftpfannenimplantaten, insbesondere die aseptische Prothesenlockerung. Es werden verschiedene Mechanismen wie unzureichende Primärstabilität, Mikrobewegungen, Spaltbildung, ungeeignetes Material, mechanische Überlastung, veränderte Lasteinleitung und abriebpartikelinduzierte Lockerung detailliert beschrieben. Weitere Komplikationen wie Prothesenluxation und septische Prothesenlockerung werden ebenfalls erörtert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zementfreier Hüftgelenkersatz, Osseointegration, Periprothetische Membran, Abriebpartikel, Aseptische Prothesenlockerung, Mikrobewegung, Implantatstabilität, Knochenumbau, Biokompatibilität, Operationstechnik.
Details
- Titel
- Untersuchung der Knochen/Implantat-Kontaktfläche im zementfreien Hüftgelenkpfannenersatzsystem zum Erreichen einer optimalen Stabilität
- Untertitel
- Diplomarbeit
- Hochschule
- Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
- Veranstaltung
- Medizintechnik - Biomechanik
- Note
- 1,5
- Autor
- Osman Celik (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 168
- Katalognummer
- V177063
- ISBN (Buch)
- 9783640987054
- ISBN (eBook)
- 9783640987115
- Dateigröße
- 25403 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- aseptische Prothesenlockerung Osseointegration Hüftendoprothetik Periprothetische Membran Versagensursachen Hüftgelenkpfannenersatz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Osman Celik (Autor:in), 2008, Untersuchung der Knochen/Implantat-Kontaktfläche im zementfreien Hüftgelenkpfannenersatzsystem zum Erreichen einer optimalen Stabilität, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/177063
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-