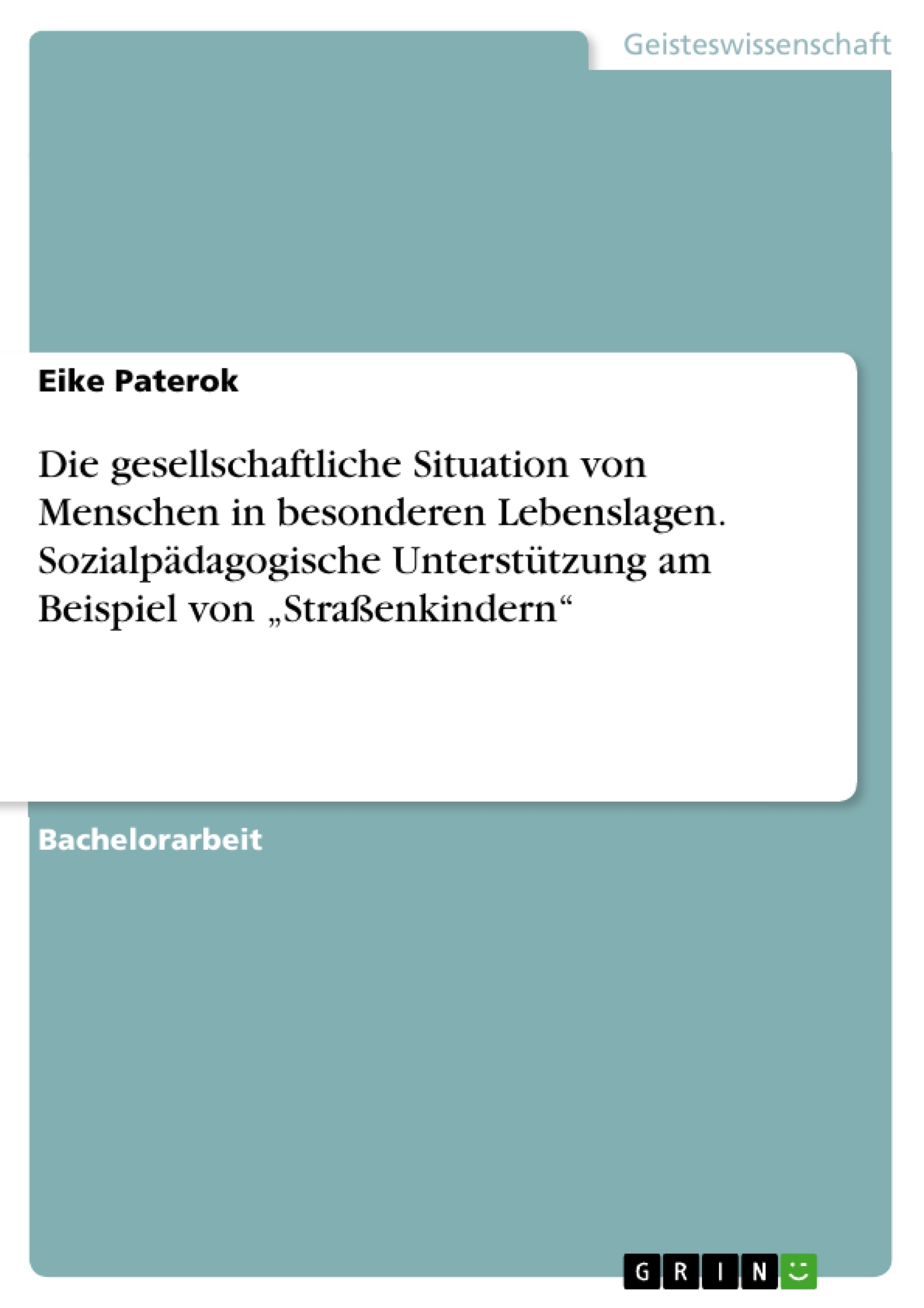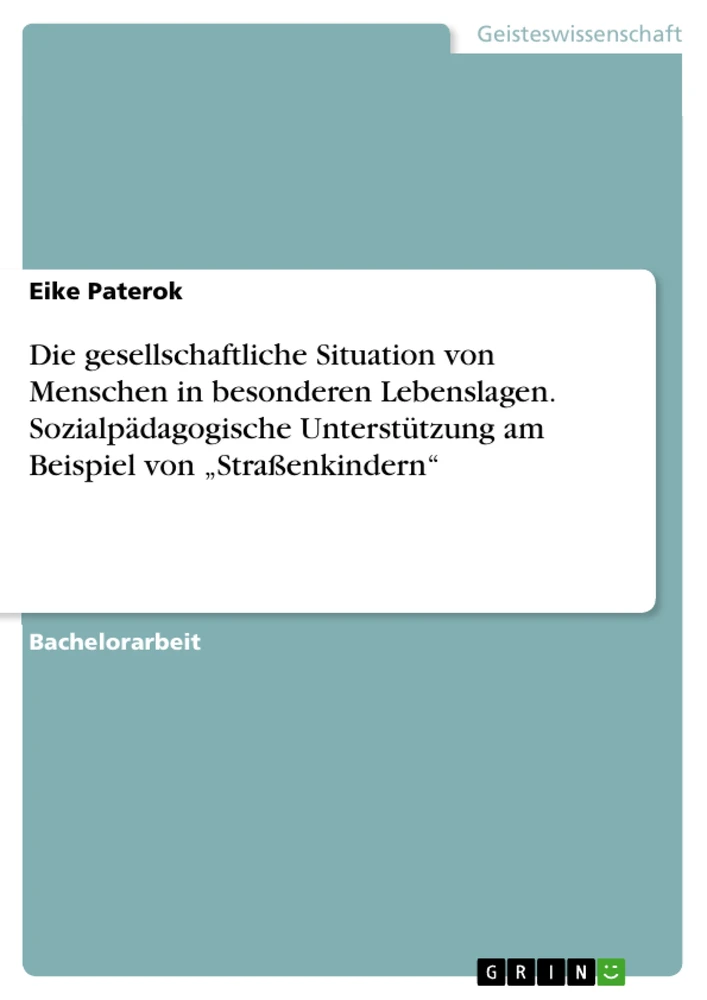
Die gesellschaftliche Situation von Menschen in besonderen Lebenslagen. Sozialpädagogische Unterstützung am Beispiel von „Straßenkindern“
Bachelorarbeit, 2011
48 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Was sind Straßenkinder?
- Typisierung
- Erklärungsansätze und Ursachen von Straßenkarrieren
- Medizinisch-Psychiatrischer Erklärungsansatz
- Psychologisch orientierter Erklärungsansatz
- Problemfeld Familie
- Materielle Faktoren und Wohnsituation
- Problemfeld Zukunftsaussichten
- Problemfeld Jugendhilfeeinrichtungen
- Gesetzliche Grundlagen
- Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Lebensort Straße - Situation und Realität
- Soziale Arbeit mit Straßenkindern
- Lebensweltorientierte Sozialarbeit
- Aufsuchende Arbeit und die Niedrigschwelligkeit
- Mobile Jugendarbeit
- Streetwork
- Szenenahe Anlaufstellen
- Erlebnispädagogik
- Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der „Straßenkinder“ in Deutschland. Sie untersucht die Ursachen und Faktoren, die Kinder dazu bewegen, ein Leben auf der Straße zu wählen, und beleuchtet den Alltag dieser Kinder, ihre Zukunftsperspektiven und die ihnen angebotenen Hilfen. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Handlungsanforderungen im Bereich der Sozialen Arbeit mit Straßenkindern analysiert.
- Definition und Typisierung des Begriffs „Straßenkind“
- Analyse der Ursachen und Faktoren für Straßenkarrieren
- Lebenswelt und Situation von Straßenkindern in Deutschland
- Methoden und Ansätze der Sozialen Arbeit mit Straßenkindern
- Herausforderungen und Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert eine Definition des Begriffs „Straßenkind“ und stellt den Kontext der Arbeit dar. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und die damit verbundenen Stereotypen. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Erklärungsansätze und Ursachen für das Leben auf der Straße erörtert, wobei die Bereiche Medizin, Psychologie, Familie, materielle Faktoren, Zukunftsaussichten und Jugendhilfeeinrichtungen behandelt werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit den gesetzlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe. Im vierten Kapitel wird die Lebenswelt und Situation von Straßenkindern auf der Straße genauer beleuchtet. Das fünfte Kapitel analysiert verschiedene Ansätze der Sozialen Arbeit mit Straßenkindern, darunter lebensweltorientierte Sozialarbeit, aufsuchende Arbeit und Erlebnispädagogik. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den Handlungsanforderungen an die Soziale Arbeit im Hinblick auf die spezifischen Bedürfnisse von Straßenkindern.
Schlüsselwörter
Straßenkinder, Jugendhilfe, Soziale Arbeit, Lebensweltorientierung, Aufsuchende Arbeit, Niedrigschwelligkeit, Erlebnispädagogik, Ursachen, Faktoren, Zukunftsperspektiven, Problemfeld Familie, Materielle Faktoren, Wohnsituation, Deutschland
Details
- Titel
- Die gesellschaftliche Situation von Menschen in besonderen Lebenslagen. Sozialpädagogische Unterstützung am Beispiel von „Straßenkindern“
- Hochschule
- Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
- Note
- 1,7
- Autor
- Eike Paterok (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V177099
- ISBN (Buch)
- 9783640985678
- ISBN (eBook)
- 9783640985852
- Dateigröße
- 627 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Das Thema bezieht sich auf die Situation in Deutschland
- Schlagworte
- Straßenkinder Straßenkarrieren Deutschland Erlebnispädagogik Medizinisch-Psychiatrischer Erklärungsansatz Psychologisch orientierter Erklärungsansatz Das Kinder- und Jugendhilfegesetz Streetwork Niedrigschwelligkeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Eike Paterok (Autor:in), 2011, Die gesellschaftliche Situation von Menschen in besonderen Lebenslagen. Sozialpädagogische Unterstützung am Beispiel von „Straßenkindern“, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/177099
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-