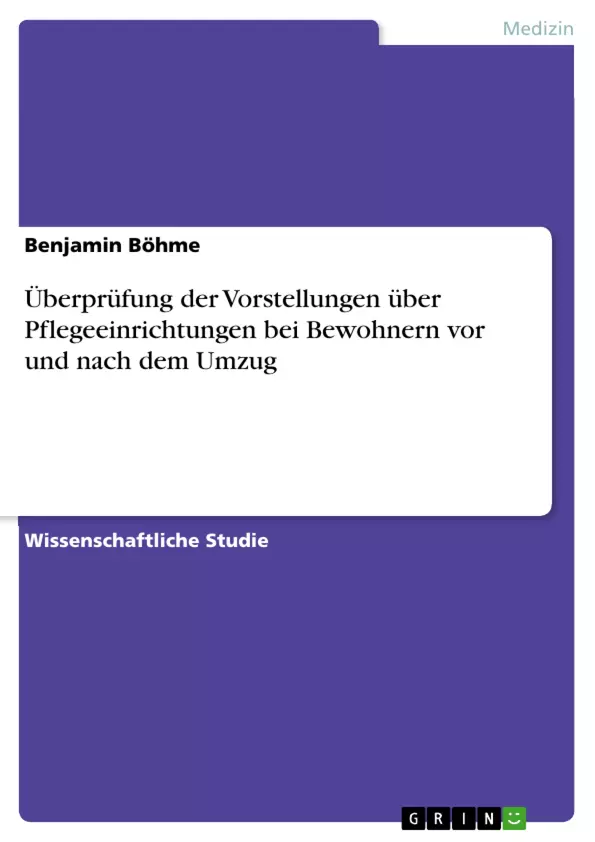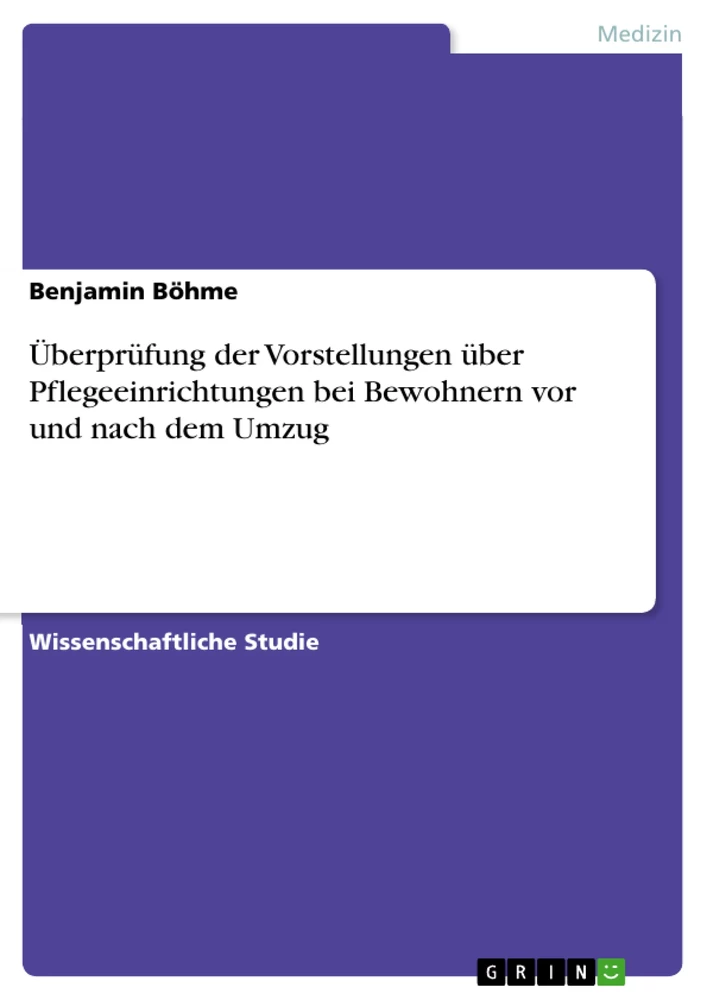
Überprüfung der Vorstellungen über Pflegeeinrichtungen bei Bewohnern vor und nach dem Umzug
Wissenschaftliche Studie, 2011
33 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen der Studie
- 1.1 Grundsätzliche Fragestellung
- 1.2 Konkretisierung der Fragestellung
- 1.3 Theoretischer Hintergrund
- 2 Hypothese und Methoden
- 2.1 Hypothese
- 2.2 Methoden
- 2.2.1 Auswahlverfahren
- 2.2.2 Auswertungsverfahren
- 3 Durchführung und Auswertung
- 3.1 Das Untersuchungsfeld
- 3.2 Die Probanden
- 3.3 Durchführung
- 3.4 Auswertung
- 3.4.1 Interview 1
- 3.4.2 Interview 2
- 3.4.3 Interview 3
- 4. Zusammenfassung und Diskussion
- 4.1 Zusammenfassung der Kernelemente
- 4.2. Diskussion mit der Theorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende empirische Studie verfolgt das Ziel, die Vorstellungen von Pflegeeinrichtungen bei pflegebedürftigen Menschen vor und nach dem Umzug zu untersuchen. Dabei steht die Erforschung der Gemeinsamkeiten von subjektiven Vorstellungen im Fokus, die die Einschränkungen des autonomen Lebens in Form des Umzugs in eine Pflegeeinrichtung betreffen.
- Untersuchung der Vorstellungen von Pflegeeinrichtungen vor dem Umzug
- Analyse der Bestätigung oder Widerlegung dieser Vorstellungen nach dem Umzug
- Bedeutung des Umzugs in eine Pflegeeinrichtung als Veränderung der sozialen Umgebung
- Einfluss von Erwartungen auf die Belastungserfahrung des Umzugs
- Relevanz der stationären Altenpflege im Kontext des demografischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Studie beleuchtet die grundlegende Fragestellung, die Konkretisierung der Fragestellung sowie den theoretischen Hintergrund. Der demografische Wandel und die steigende Zahl der Pflegebedürftigen werden als Ausgangspunkt für die Betrachtung des Themas "Umzug in die Pflegeeinrichtung" herangezogen. Das Kapitel untersucht auch die Veränderungen der sozialen Umgebung im Kontext eines Umzugs in eine Pflegeeinrichtung und die potenziellen psychischen Belastungen für die Betroffenen.
Kapitel 2 erläutert die Hypothese der Studie und die angewendeten Methoden. Die Auswahl und Auswertung der Daten werden detailliert dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit der Durchführung und Auswertung der empirischen Studie. Es beschreibt das Untersuchungsfeld, die Probanden sowie den Ablauf der Studie und die Auswertung der Interviews.
Kapitel 4 bietet eine Zusammenfassung der Kernelemente und eine Diskussion der Ergebnisse im Kontext der Theorie.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Studie sind: Pflegeeinrichtungen, Vorstellungen, Umzug, Pflegebedürftige, soziale Umgebung, psychische Belastung, demografischer Wandel, stationäre Altenpflege, Autonomie, Subjektivität, Interview, empirische Studie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorstellungen haben Menschen vor dem Umzug ins Pflegeheim?
Viele verbinden den Umzug mit dem Verlust von Autonomie und einer massiven Veränderung ihrer gewohnten sozialen Umgebung.
Bestätigen sich diese Vorstellungen nach dem Einzug?
Die Studie untersucht durch qualitative Interviews, ob die Befürchtungen der Bewohner eintreffen oder ob die Realität in der Einrichtung positiver wahrgenommen wird.
Welche Methodik wurde in der Studie angewendet?
Es wurden Einzelinterviews (narrativ und problemzentriert) geführt und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.
Warum ist der demografische Wandel für dieses Thema relevant?
Da immer mehr Menschen auf stationäre Altenpflege angewiesen sind, wird es wichtiger zu verstehen, wie der Übergang psychisch belastungsfrei gestaltet werden kann.
Was beeinflusst die Belastungserfahrung beim Umzug?
Die Studie zeigt, dass individuelle Erwartungen und die Art der Vorbereitung maßgeblich darüber entscheiden, wie stark der Umzug als Einschränkung empfunden wird.
Details
- Titel
- Überprüfung der Vorstellungen über Pflegeeinrichtungen bei Bewohnern vor und nach dem Umzug
- Hochschule
- Hamburger Fern-Hochschule
- Veranstaltung
- Studienschwerpunkt Stationäre Altenpflege / Empirische Studie
- Note
- 1,3
- Autor
- Benjamin Böhme (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 33
- Katalognummer
- V177398
- ISBN (eBook)
- 9783640990108
- ISBN (Buch)
- 9783640990412
- Dateigröße
- 468 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- vorstellungen pflegeeinrichtungen bewohnern umzug
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Benjamin Böhme (Autor:in), 2011, Überprüfung der Vorstellungen über Pflegeeinrichtungen bei Bewohnern vor und nach dem Umzug, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/177398
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-