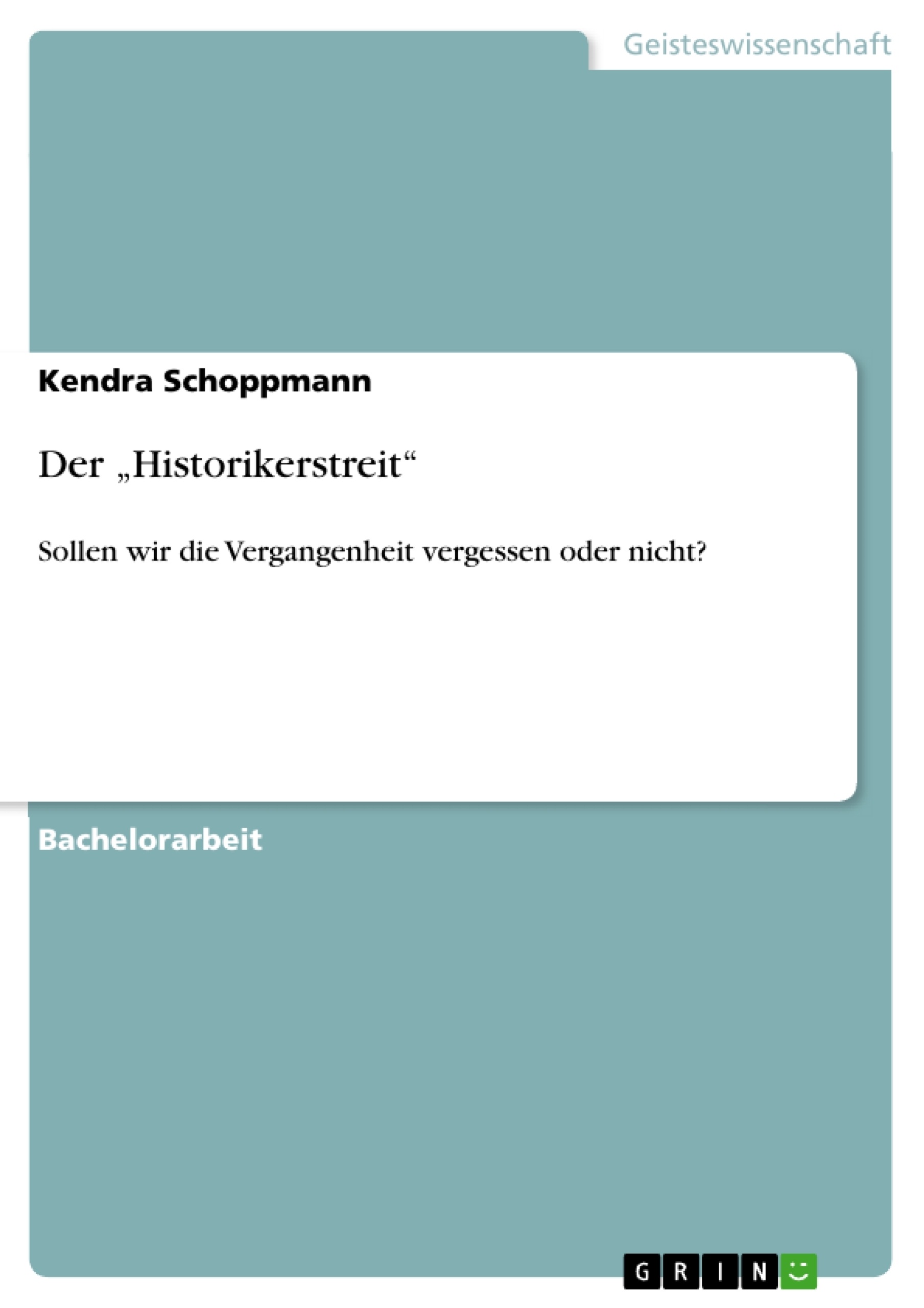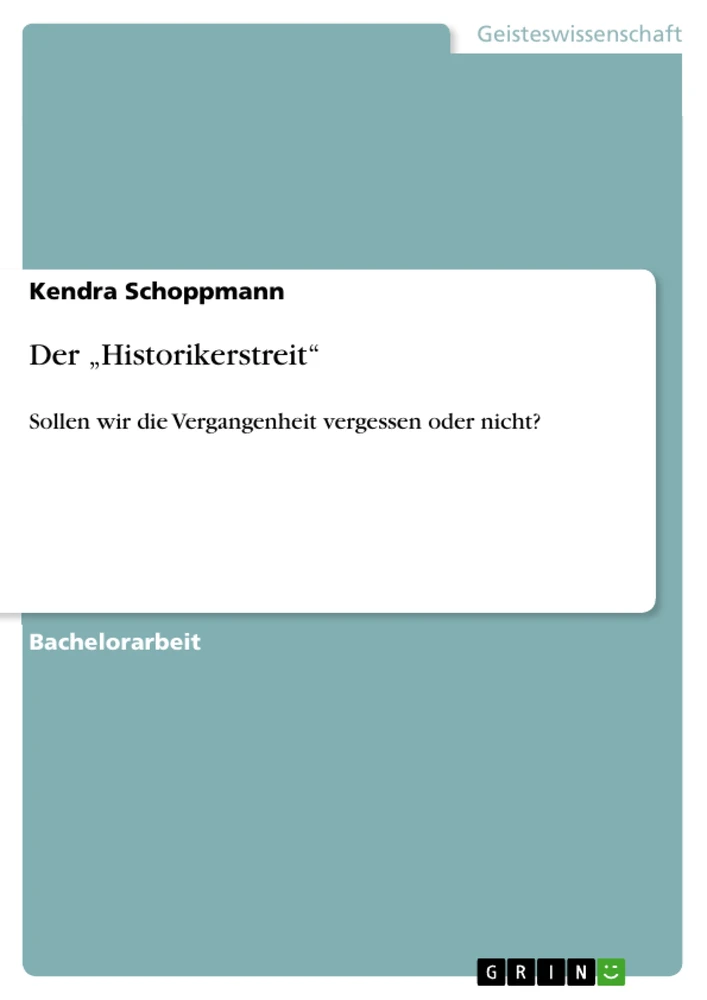
Der „Historikerstreit“
Bachelorarbeit, 2010
34 Seiten
Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Auslöser des Historikerstreits
- Die Geistig – moralische Wende in den achtziger Jahren
- Ernst Nolte
- Die Debatte und ihr Verlauf: „Linke Aufklärer“ gegen die,,Viererbande\"?
- Kritik an Nolte
- Jürgen Habermas
- Rudolf Augstein
- Eberhard Jäckel
- Unterstützung für Nolte
- Andreas Hillgruber
- Michael Stürmer
- Klaus Hildebrand
- Joachim Fest
- Nach dem Historikerstreit
- Der Historikerstreit als politische Debatte
- Abschließende Bemerkungen
- Der Umgang mit der deutschen Vergangenheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem „Historikerstreit“ der 1980er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel der Arbeit ist es, die Hintergründe, den Verlauf und die Folgen dieses kontroversen Diskurses zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf den Ursachen und Motiven der Beteiligten, den zentralen Argumenten der verschiedenen Positionen und der Bedeutung des Streits für die deutsche Gesellschaft und ihr Geschichtsbild.
- Die Rolle der „geistig-moralischen Wende“ der 1980er Jahre
- Die provokanten Thesen Ernst Noltes und die Reaktion der akademischen und öffentlichen Sphäre
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf die NS-Vergangenheit und deren Einordnung in die Weltgeschichte
- Der Einfluss des Historikerstreits auf die deutsche Identität und das nationale Selbstverständnis
- Der Umgang mit dem Dritten Reich im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die historische und gesellschaftliche Relevanz des Historikerstreits dar und erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit.
- Kapitel 2 beleuchtet die Auslöser des Historikerstreits und diskutiert die Bedeutung der „geistig-moralischen Wende“ sowie den provokanten Artikel von Ernst Nolte.
- Kapitel 3 analysiert die Debatte und ihren Verlauf, indem es die Positionen der „linken Aufklärer“ und der „Viererbande“ gegenüberstellt. Dabei werden die wichtigsten Argumente und Kritikpunkte der beteiligten Historiker und Intellektuellen vorgestellt.
- Kapitel 4 behandelt die Folgen und Nachwirkungen des Historikerstreits auf die deutsche Geschichtswissenschaft und die öffentliche Wahrnehmung der NS-Vergangenheit.
- Kapitel 5 untersucht den Historikerstreit als politische Debatte und beleuchtet die politischen Dimensionen und Implikationen des Diskurses.
- Kapitel 6 beleuchtet den Umgang mit der deutschen Vergangenheit, insbesondere mit dem Dritten Reich, im Wandel der Zeit und im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen.
Schlüsselwörter
Der Historikerstreit, Ernst Nolte, „geistig-moralische Wende“, NS-Vergangenheit, Holocaust, Geschichtsbild, nationale Identität, politische Debatte, deutsche Geschichte, Zeitgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, öffentliche Meinung, kontroverse, Auseinandersetzung, Vergangenheitsbewältigung, Identität, nationale Identität, Selbstverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „Historikerstreit“ der 1980er Jahre?
Es war eine intensive öffentliche und akademische Debatte in der Bundesrepublik Deutschland (1986/87) über die Einordnung und Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen.
Wer war Ernst Nolte und welche Thesen vertrat er?
Ernst Nolte war ein Historiker, der die NS-Verbrechen als Reaktion auf den sowjetischen „Klassengenozid“ darstellte und damit die Einzigartigkeit des Holocausts infrage stellte.
Wer waren die Hauptkritiker von Ernst Nolte?
Der Philosoph Jürgen Habermas war der prominenteste Kritiker; er warf Nolte eine Verharmlosung der NS-Zeit und einen Missbrauch der Geschichte für nationale Identitätszwecke vor.
Was bedeutete die „geistig-moralische Wende“ für den Streit?
Die unter Bundeskanzler Helmut Kohl ausgerufene Wende schuf ein politisches Klima, in dem über eine Normalisierung der deutschen Geschichte und ein neues Nationalbewusstsein diskutiert wurde.
Warum wurde die Debatte so emotional geführt?
Es ging um fundamentale Fragen der deutschen Identität, der moralischen Verantwortung und darum, ob man die NS-Vergangenheit „vergleichen“ darf, ohne sie zu relativieren.
Was war das langfristige Ergebnis des Historikerstreits?
Der Streit festigte den Konsens, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust zentraler Bestandteil des deutschen Selbstverständnisses bleiben muss und die NS-Zeit nicht einfach „normalisiert“ werden kann.
Details
- Titel
- Der „Historikerstreit“
- Untertitel
- Sollen wir die Vergangenheit vergessen oder nicht?
- Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
- Autor
- B.A. Kendra Schoppmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 34
- Katalognummer
- V177897
- ISBN (eBook)
- 9783640997503
- ISBN (Buch)
- 9783640997640
- Dateigröße
- 547 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Historikerstreit Ernst Nolte politische Debatte Umgang mit der NS-Vergangenheit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- B.A. Kendra Schoppmann (Autor:in), 2010, Der „Historikerstreit“, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/177897
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-