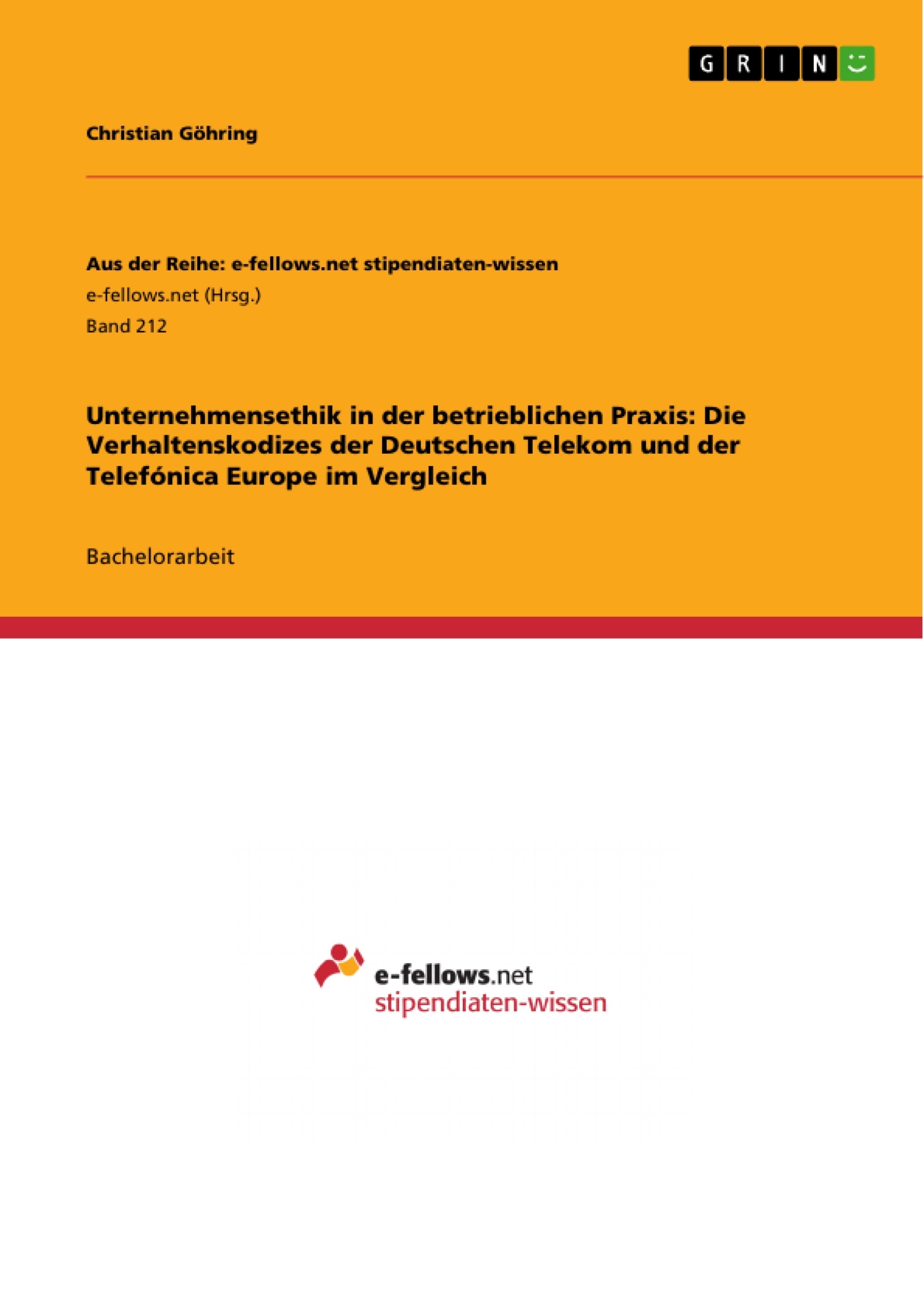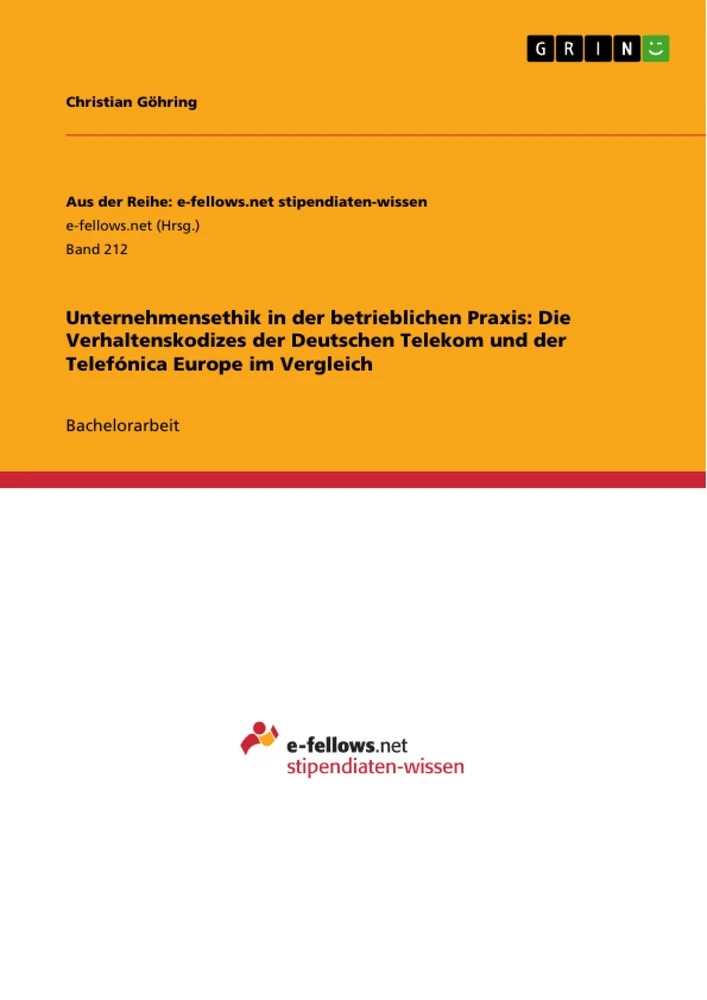
Unternehmensethik in der betrieblichen Praxis: Die Verhaltenskodizes der Deutschen Telekom und der Telefónica Europe im Vergleich
Bachelorarbeit, 2011
50 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Unternehmensethik
- 2. Die Deutsche Telekom AG
- 2.1 Das Unternehmen Deutsche Telekom und seine Risiken
- 2.2 Die Verhaltenskodizes und Prinzipien der Deutschen Telekom
- 3. Die Telefónica Europe plc.
- 3.1 Die Telefónica Europe und ihre Gefahren
- 3.2 Maßnahmen der Telefónica Europe zur Überwindung der Risiken
- 4. Der Vergleich der Deutschen Telekom und Telefónica Europe
- 4.1 Kunden & Gesellschaft
- 4.1.1 Datenschutz: Motivation und Einhaltung
- 4.1.2 Jugendschutz: Schranken und Aufklärung
- 4.2 Mitarbeiter
- 4.2.1 Arbeitsbedingungen: Ideen- und Nachwuchsmanagement
- 4.2.2 Interne Anreizstrukturen: Mitarbeiterkartelle und das Prinzipal-Agenten-Problem
- 4.2.3 Unternehmenskultur: Trittbrettfahrerproblematik
- 4.3 Unternehmen
- 4.3.1 Unlauterer Wettbewerb: Korruption
- 4.3.2 Kooperation mit Lieferanten: Lieferantenauswahl und -management
- 4.1 Kunden & Gesellschaft
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Praxisrelevanz von Unternehmensethik und beleuchtet deren Umsetzung und Integration in Unternehmensstrukturen. Das Ziel ist es, zu zeigen, wie Unternehmen die für sie relevanten Dilemmastrukturen identifizieren und anschließend geeignete Maßnahmen zur Überwindung dieser einleiten können. Die Arbeit analysiert dazu die Verhaltenskodizes der Deutschen Telekom und Telefónica Europe, zweier Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, um die Wirksamkeit unternehmerischer Selbstbindung für die langfristige Besserstellung aller Beteiligten aufzuzeigen.
- Die Relevanz und Umsetzung von Unternehmensethik in der Praxis
- Die Identifizierung und Überwindung von Dilemmastrukturen in Unternehmen
- Die Bedeutung und Wirkung unternehmerischer Selbstbindung
- Die Analyse und der Vergleich von Verhaltenskodizes in der Telekommunikationsbranche
- Die Rolle von Kooperation und Verhaltenskodizes bei der Bewältigung von sozialen Dilemmata
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Unternehmensethik ein und stellt die Bedeutung der Einbettung ethischer Prinzipien in Unternehmensstrukturen heraus.
- 1. Unternehmensethik: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Unternehmensethik und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Bewältigung ethischer Herausforderungen.
- 2. Die Deutsche Telekom AG: Dieser Abschnitt stellt das Unternehmen Deutsche Telekom und seine spezifischen Risiken vor, die sich aus seiner Tätigkeit in der Telekommunikationsbranche ergeben. Anschließend wird auf die Verhaltenskodizes und Prinzipien der Deutschen Telekom eingegangen.
- 3. Die Telefónica Europe plc.: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel wird das Unternehmen Telefónica Europe und dessen spezifische Herausforderungen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die Maßnahmen, die Telefónica Europe zur Bewältigung der Risiken ergreift.
- 4. Der Vergleich der Deutschen Telekom und Telefónica Europe: Dieses Kapitel vergleicht die Verhaltenskodizes der beiden Unternehmen hinsichtlich verschiedener Themenbereiche wie Datenschutz, Jugendschutz, Arbeitsbedingungen und Korruption.
Schlüsselwörter
Unternehmensethik, Verhaltenskodizes, Deutsche Telekom, Telefónica Europe, Telekommunikationsbranche, Dilemmastrukturen, Selbstbindung, Kooperation, soziale Dilemmata, Datenschutz, Jugendschutz, Arbeitsbedingungen, Korruption, Lieferantenmanagement.
Details
- Titel
- Unternehmensethik in der betrieblichen Praxis: Die Verhaltenskodizes der Deutschen Telekom und der Telefónica Europe im Vergleich
- Hochschule
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Lehrstuhl für Wirtschaftsethik)
- Note
- 1,0
- Autor
- Christian Göhring (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V178125
- ISBN (eBook)
- 9783656000853
- ISBN (Buch)
- 9783656001379
- Dateigröße
- 928 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- unternehmensethik praxis verhaltenskodizes deutschen telekom telefónica europe vergleich
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Christian Göhring (Autor:in), 2011, Unternehmensethik in der betrieblichen Praxis: Die Verhaltenskodizes der Deutschen Telekom und der Telefónica Europe im Vergleich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/178125
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-