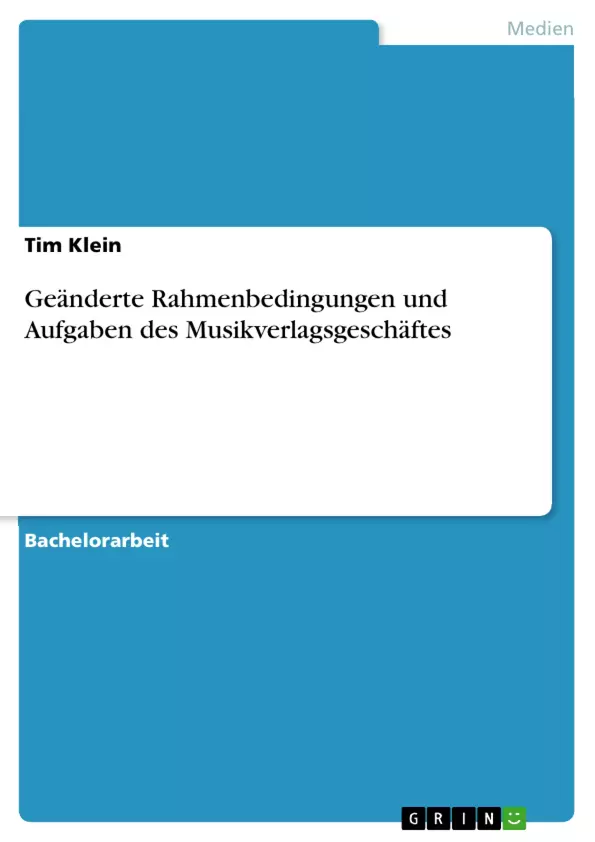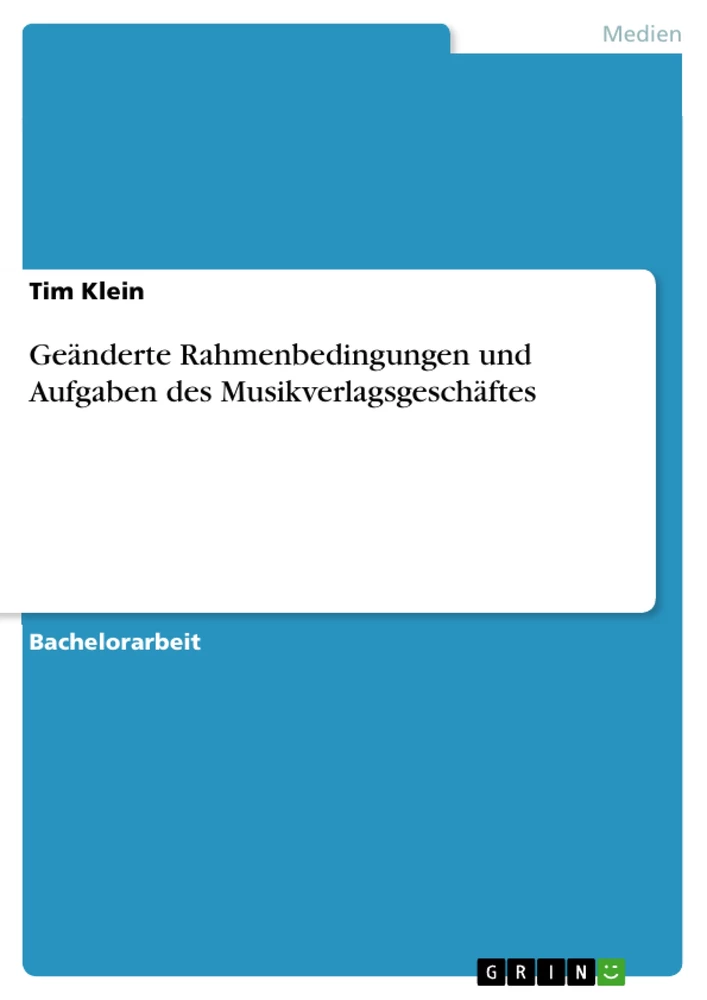
Geänderte Rahmenbedingungen und Aufgaben des Musikverlagsgeschäftes
Bachelorarbeit, 2011
46 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Aufbau der Arbeit
- Grundlagen des Musikverlagsgeschäftes
- Die Entwicklung des Musikverlagswesens in Deutschland.
- Rahmenbedingungen des Musikverlagsgeschäftes
- Die Struktur der Musikindustrie.
- Wertschöpfungskette der Musikverlage innerhalb der Musikindustrie
- Struktur der Musikverlage..
- Gesetzliche Grundlagen für Musikverlage
- Die Akteure der Musikindustrie.
- Die Musikrechteinhaber und Musikverwerter_.
- Vervveltungsgesellschaften und ihre Bedeutung für Musikverlage.
- GEMA__
- GVL und VG Musikeditiom_
- Vertragliche Beziehungen im Musikverlagsgeschäft
- Der Musikverlagsvertrag_
- Der Autoren-Exklusivvertrag....
- Der Editionsvertrag._
- Der Co-Verlagsvertrag._._
- Aufgaben eines Musikverlages
- A&R Management/Scouting.
- Verwertung der emorbenen Rechte.
- Songmarketing._
- Lizenzierung an Dritte.
- Lizenzierung im W- und Filmbereich.
- Lizenzierung im Video-/DVD-Bereich.
- Lizenzierung an Subverlage
- Lizenzierung im Mobiltelefonbereich.
- Lizenzierung im Multimediabereich.
- Lizenzierung im World Wide Web.
- Lizenzierung an Opern und Musicals.
- Lizenzierung im Bereich Notenblätter..
- Administrative Tätigkeiten und Künstlerbetreuung_
- Möglichkeit der Inhaltebeschaffung durch produzentische Aktivitäten.
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Musikverlagsgeschäft und untersucht, wie sich die Aufgaben und Rahmenbedingungen dieses Geschäftsfelds durch die Entwicklung neuer Medien verändert haben. Die Arbeit konzentriert sich auf die Struktur der Musikindustrie und die Rolle der Musikverlage innerhalb dieser Struktur. Sie beleuchtet die Beziehungen zwischen Musikverlagen und Verwertungsgesellschaften sowie die verschiedenen Arten von Verträgen, die im Musikverlagsgeschäft abgeschlossen werden. Darüber hinaus werden die Aufgaben eines modernen Musikverlags im Detail beschrieben, insbesondere die Verwertung der erworbenen Rechte.
- Entwicklung des Musikverlagswesens in Deutschland
- Struktur der Musikindustrie und Rolle der Musikverlage
- Vertragliche Beziehungen im Musikverlagsgeschäft
- Aufgaben eines Musikverlags, insbesondere die Verwertung der Rechte
- Einfluss neuer Medien auf das Musikverlagsgeschäft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit erläutert die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit. Es wird auf die Krise der Musikindustrie, insbesondere der Tonträgerhersteller, eingegangen und die Relevanz dieser Entwicklung für das Musikverlagswesen hervorgehoben.
Kapitel 2 behandelt die Grundlagen des Musikverlagsgeschäftes. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Musikverlagswesens in Deutschland, beginnend mit der Erfindung des Notendrucks im 16. Jahrhundert. Die Entwicklung des Urheberrechts und der Verlagsrechte wird im Kontext der historischen Entwicklung des Musikverlagswesens dargestellt. Die Struktur der Musikindustrie wird analysiert und die Wertschöpfungskette der Musikverlage innerhalb dieser Struktur beschrieben. Die Arbeit geht auf die verschiedenen Akteure der Musikindustrie ein, insbesondere auf die Musikrechteinhaber, Musikverwerter und Verwertungsgesellschaften wie die GEMA, GVL und VG Musikedition.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den vertraglichen Beziehungen im Musikverlagsgeschäft. Es werden die verschiedenen Arten von Verträgen, die zwischen Musikverlagen und Urhebern abgeschlossen werden, erläutert, darunter der Musikverlagsvertrag, der Autoren-Exklusivvertrag, der Editionsvertrag und der Co-Verlagsvertrag. Die Arbeit geht auf die wichtigsten Vertragsinhalte wie die Rechteübertragung, die Vergütung, die Laufzeit und die Pflichten der Vertragsparteien ein.
Kapitel 4 beschreibt die Aufgaben eines Musikverlags. Es werden die Bereiche A&R Management, Songmarketing und Lizenzierung im Detail beleuchtet. Die Arbeit geht auf die verschiedenen Möglichkeiten der Rechteverwertung ein, darunter die Lizenzierung von Musik für Film, Fernsehen, Video, Mobiltelefone, Multimedia, Internet und Opern/Musicals. Zudem werden die administrativen Tätigkeiten eines Musikverlags und die Möglichkeit der Inhaltebeschaffung durch produzentische Aktivitäten behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Musikverlagsgeschäft, die Musikindustrie, Urheberrecht, Verlagsrecht, Verwertungsgesellschaften, GEMA, GVL, VG Musikedition, Musikverlagsvertrag, Autoren-Exklusivvertrag, Editionsvertrag, Co-Verlagsvertrag, A&R Management, Songmarketing, Lizenzierung, neue Medien, Internet, Digitalisierung, Klingeltöne, Multimedia, Bildschirmspiele, World Wide Web, Online-Nutzung, und die Herausforderungen und Chancen des Musikverlagsgeschäftes im digitalen Zeitalter.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat das Internet das Musikverlagsgeschäft verändert?
Das Internet hat neue Verwertungsmöglichkeiten wie digitales Songmarketing und Klingeltöne geschaffen, stellt die Branche aber auch vor Herausforderungen durch illegale Verbreitung.
Was sind die Hauptaufgaben eines Musikverlags?
Zu den Aufgaben gehören das A&R Management (Scouting), das Songmarketing, die Lizenzierung von Rechten an Dritte (Film, Werbung) und administrative Tätigkeiten.
Welche Rolle spielt die GEMA für Musikverlage?
Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, die die Nutzungsrechte der Urheber und Verleger wahrnimmt und für die entsprechende Vergütung bei öffentlicher Aufführung sorgt.
Was ist ein Autoren-Exklusivvertrag?
In diesem Vertrag bindet sich ein Urheber exklusiv an einen Verlag, der im Gegenzug die Rechte an allen während der Vertragslaufzeit geschaffenen Werken verwertet.
Was versteht man unter A&R Management?
A&R steht für "Artists and Repertoire". Es bezeichnet die Talentsuche und die künstlerische Entwicklung von Urhebern innerhalb eines Musikverlags.
Details
- Titel
- Geänderte Rahmenbedingungen und Aufgaben des Musikverlagsgeschäftes
- Hochschule
- Universität Siegen (Lehrstuhl Betriebswirtschaftslehre, insb. Medienmanagement)
- Note
- 1,3
- Autor
- Tim Klein (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V178238
- ISBN (Buch)
- 9783656003465
- ISBN (eBook)
- 9783656003625
- Dateigröße
- 689 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Musikverlag Musikindustrie Musikwirtschaft Musik Verlag Musikverlage Medienmanagement Musikmanagement Musikverlagsgeschäft Musikverlagswesen Musikverwerter Musikverwertung Autorenexklusivvertrag Verlagsvertrag Aufgaben eines Musikverlags Lizenzierung Rechteverwertung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 30,99
- Arbeit zitieren
- Tim Klein (Autor:in), 2011, Geänderte Rahmenbedingungen und Aufgaben des Musikverlagsgeschäftes, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/178238
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-