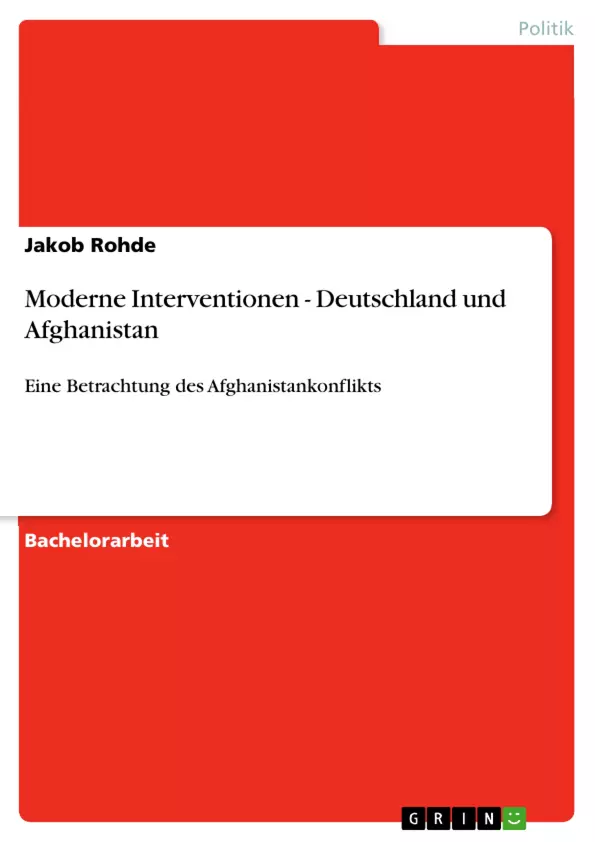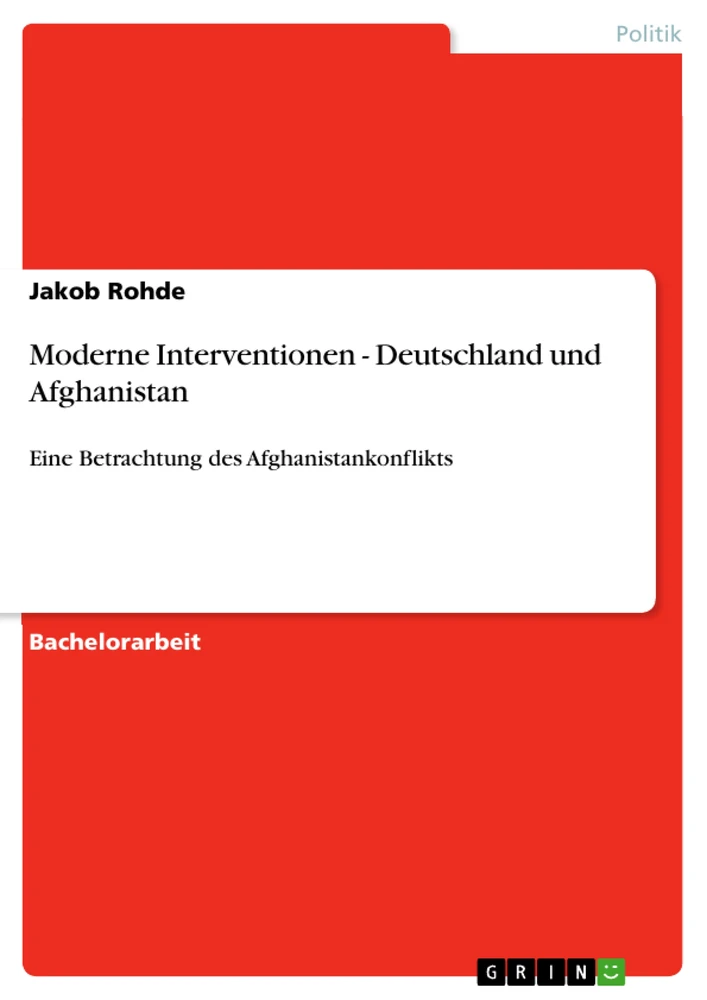
Moderne Interventionen - Deutschland und Afghanistan
Bachelorarbeit, 2010
44 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung von Interventionen
- State-Building
- Problematiken des externen-direktem Prozess State-Building
- Argumentative Legitimation von Interventionen
- Rechtliche Legitimation von Interventionen
- Problematiken argumentativer und rechtlicher Legitimationen
- Soziologische Betrachtung der Interventionskultur
- Interventionskultur Deutschland und Afghanistan
- Reale Konflikte einer Interventionskultur durch Fehlinterpretationen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und die Auswirkungen moderner Interventionen, insbesondere am Beispiel des Afghanistan-Konflikts. Dabei wird der Fokus auf die Veränderungen in den Interventionen und deren Auswirkungen auf die Entstehung einer Interventionskultur gelegt.
- Entwicklung von Interventionen und Konflikten
- Legitimation von Interventionen
- Soziologische Aspekte der Interventionskultur
- Herausforderungen der Interventionskultur
- Die Rolle der Interventionskultur in der Konfliktlösung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die aktuelle Situation des Afghanistankonflikts sowie die Problematik moderner Interventionen. Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung von Interventionen und deren Veränderungen, die im Zusammenhang mit der Nationalstaatenentwicklung und dem Wandel von Interessen stehen. Es werden dabei die historischen Entwicklungen vom Kolonialismus bis zum modernen Imperialismus betrachtet und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Entkolonialisierung analysiert.
Schlüsselwörter
Interventionen, Interventionskultur, Afghanistan, Konfliktlösung, State-Building, Legitimation, Soziologie, Friedensforschung, Nationalstaatenentwicklung, Kolonialismus, Imperialismus, Entkolonialisierung.
Details
- Titel
- Moderne Interventionen - Deutschland und Afghanistan
- Untertitel
- Eine Betrachtung des Afghanistankonflikts
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Sozialwissenschaften)
- Note
- 1,7
- Autor
- Jakob Rohde (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V178299
- ISBN (Buch)
- 9783656002215
- ISBN (eBook)
- 9783656002598
- Dateigröße
- 545 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- moderne interventionen deutschland afghanistan eine betrachtung afghanistankonflikts Interventionskultur Statebuilding Peacekeeping Peace-Enforcement humanitäre Intervention
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Jakob Rohde (Autor:in), 2010, Moderne Interventionen - Deutschland und Afghanistan, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/178299
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-