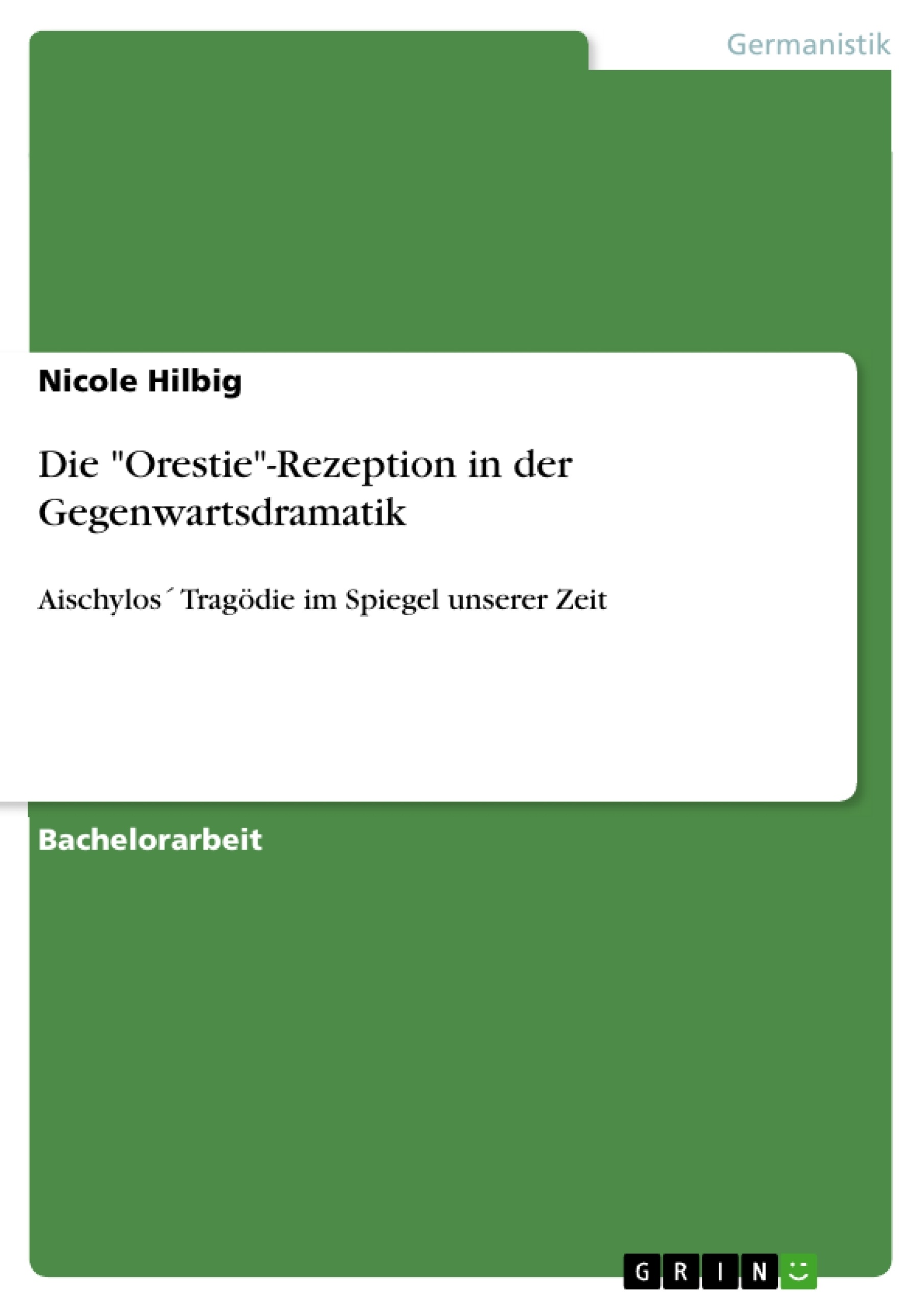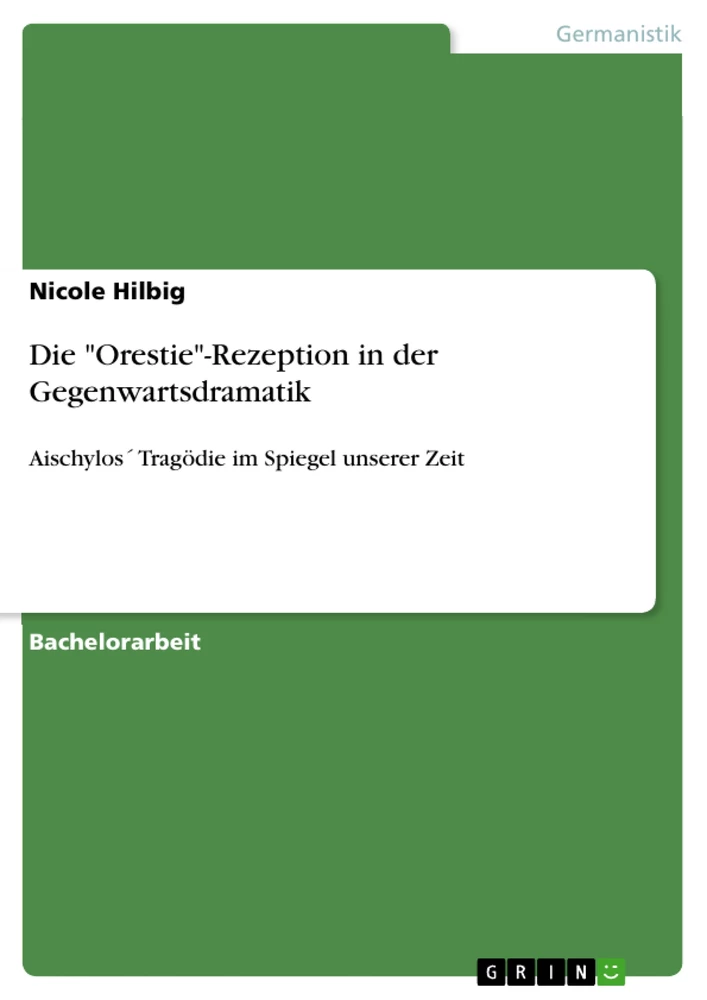
Die "Orestie"-Rezeption in der Gegenwartsdramatik
Bachelorarbeit, 2011
54 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Explizite Orestie-Rezeption
- 1.1 Familiäre Gewalt: Echtzeit von Albert Mestres (2010)
- 1.1.1 Familientragödie als Gewaltakt
- 1.1.2 Soziale Einschränkungen im Kiez
- 1.2 Das Schicksal der Kinder: Orestie: Die Brut von Henry Mason (2009)
- 1.2.1 Ein vorherbestimmtes Familiendrama
- 1.2.2 Der Inzestfall von Amstetten und der Einsatz der Medien
- 1.1 Familiäre Gewalt: Echtzeit von Albert Mestres (2010)
- 2 Implizite Orestie-Rezeption
- 2.1 Von Göttern und Naturgewalten: Ein Sturz von Elfriede Jelinek (2010)
- 2.1.1 Das Kräftemessen der Elemente Erde und Wasser
- 2.1.2 Naturgewalten, Götter und der Einsturz des Kölner Stadtarchivs
- 2.2 Europa und Afrika in der Flüchtlingspolitik: Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung von Kevin Rittberger (2010)
- 2.2.1 Kassandras Warnungen und Vorsehung
- 2.2.2 Flüchtlingsflut und ihre Folgen
- 2.1 Von Göttern und Naturgewalten: Ein Sturz von Elfriede Jelinek (2010)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Aischylos' Orestie in der Gegenwartsdramatik. Ziel ist es, die Verbindungen zwischen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen und der antiken Tragödie aufzuzeigen und das Interesse der Gegenwartsdramatik an der Orestie zu ergründen. Analysiert werden vier Theaterstücke, die explizit oder implizit auf die Orestie verweisen.
- Familiäre Gewalt und ihre Auswirkungen
- Die Rolle der Medien in der Gesellschaft
- Naturgewalten als Metapher für gesellschaftliche Krisen
- Das Thema Flucht und Migration
- Die Aktualität des Rachemotivs
Zusammenfassung der Kapitel
1 Explizite Orestie-Rezeption: Dieses Kapitel analysiert Theaterstücke, die explizit auf die Orestie Bezug nehmen, indem sie Figuren, Motive oder die Handlungsstruktur übernehmen. Der Fokus liegt auf der Verarbeitung der familiären Gewalt und deren Darstellung in der Gegenwartsdramatik. Die Stücke werden hinsichtlich ihrer formalen, sprachlichen und inhaltlichen Aspekte untersucht, und es wird gezeigt, wie aktuelle tagespolitische Themen in die antike Erzählung integriert werden.
2 Implizite Orestie-Rezeption: Im Gegensatz zum ersten Kapitel werden hier Stücke behandelt, deren Bezug zur Orestie nicht unmittelbar ersichtlich ist. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung impliziter Bezüge und die Ergründung der Art und Weise, wie die Orestie-Thematik in neue Kontexte eingebettet wird. Dabei werden die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Bezüge herausgearbeitet, um die Anknüpfungspunkte zwischen Antike und Gegenwart zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Orestie, Aischylos, Gegenwartsdramatik, Familiäre Gewalt, Medien, Naturgewalten, Flüchtlingspolitik, Rache, Rezeption, Aktualität, Echtzeit, Ein Sturz, Orestie: Die Brut, Kassandra.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Rezeption der Aischylos' Orestie in der Gegenwartsdramatik"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Aischylos' Orestie in der Gegenwartsdramatik. Sie analysiert, wie aktuelle gesellschaftliche und politische Themen mit der antiken Tragödie in Verbindung stehen und welches Interesse die Gegenwartsdramatik an der Orestie hat. Im Fokus stehen vier Theaterstücke, die explizit oder implizit auf die Orestie verweisen.
Welche Theaterstücke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert folgende Theaterstücke:
- Familiäre Gewalt: Echtzeit von Albert Mestres (2010)
- Orestie: Die Brut von Henry Mason (2009)
- Ein Sturz von Elfriede Jelinek (2010)
- Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung von Kevin Rittberger (2010)
Die ersten beiden Stücke stellen explizite, die letzten beiden implizite Rezeptionen der Orestie dar.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Themenschwerpunkten:
- Familiäre Gewalt und ihre Auswirkungen
- Die Rolle der Medien in der Gesellschaft
- Naturgewalten als Metapher für gesellschaftliche Krisen
- Das Thema Flucht und Migration
- Die Aktualität des Rachemotivs
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Hauptkapitel gegliedert:
- Explizite Orestie-Rezeption: Analysiert Stücke mit direktem Bezug zur Orestie, fokussiert auf die Darstellung familiärer Gewalt in der Gegenwartsdramatik.
- Implizite Orestie-Rezeption: Untersucht Stücke mit indirektem Bezug zur Orestie, konzentriert sich auf die Identifizierung impliziter Bezüge und die Einbettung der Orestie-Thematik in neue Kontexte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Orestie, Aischylos, Gegenwartsdramatik, Familiäre Gewalt, Medien, Naturgewalten, Flüchtlingspolitik, Rache, Rezeption, Aktualität, Echtzeit, Ein Sturz, Orestie: Die Brut, Kassandra.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Verbindungen zwischen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen und der antiken Tragödie aufzeigen und das Interesse der Gegenwartsdramatik an der Orestie ergründen.
Details
- Titel
- Die "Orestie"-Rezeption in der Gegenwartsdramatik
- Untertitel
- Aischylos´ Tragödie im Spiegel unserer Zeit
- Hochschule
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germanistisches Seminar)
- Note
- 1,1
- Autor
- Nicole Hilbig (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V178938
- ISBN (Buch)
- 9783656012719
- ISBN (eBook)
- 9783656012993
- Dateigröße
- 653 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- orestie gegenwartsdramatik aischylos´ tragödie spiegel zeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Nicole Hilbig (Autor:in), 2011, Die "Orestie"-Rezeption in der Gegenwartsdramatik, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/178938
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-