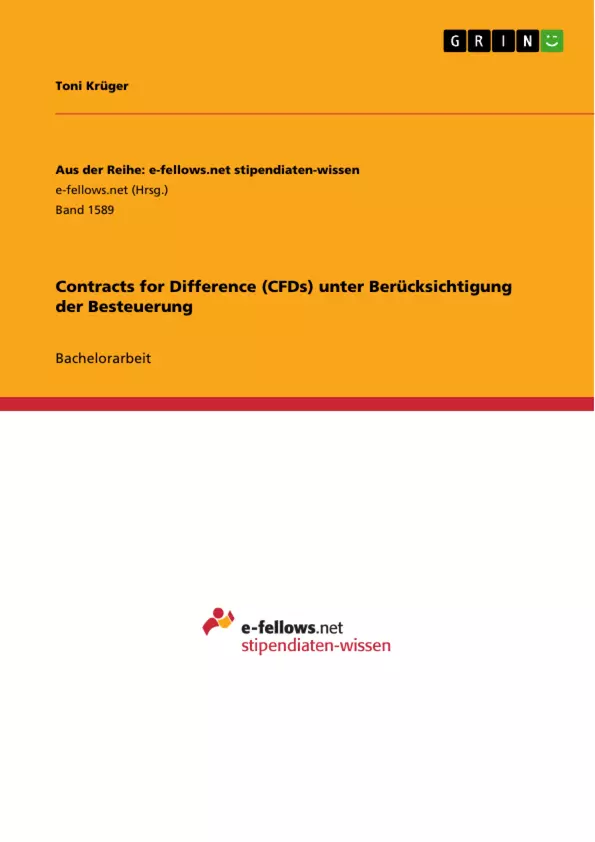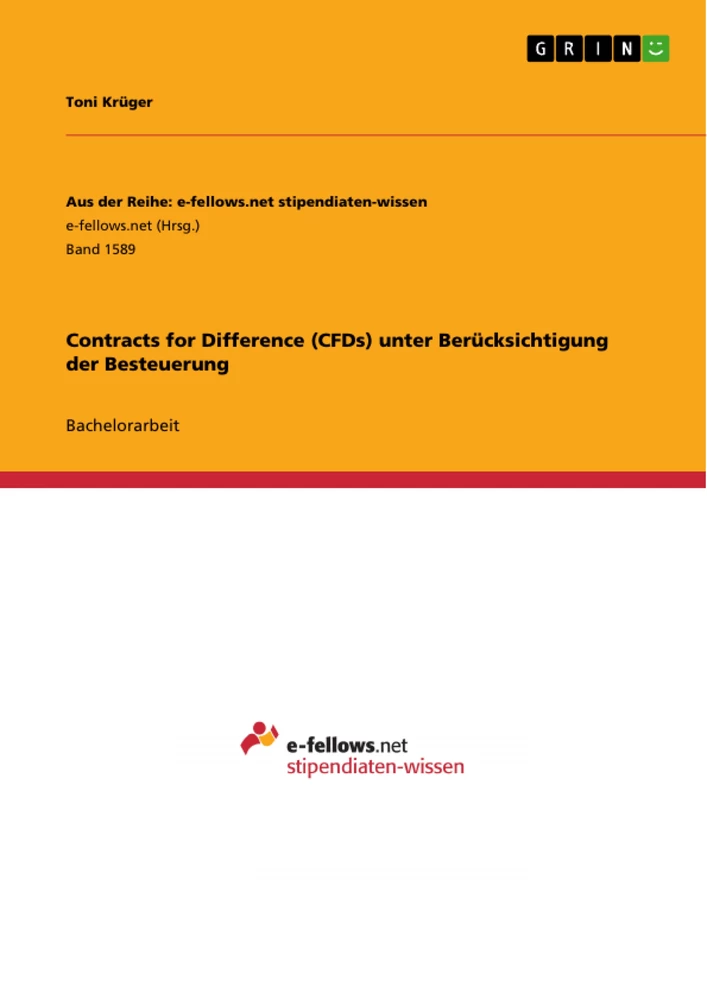
Contracts for Difference (CFDs) unter Berücksichtigung der Besteuerung
Bachelorarbeit, 2011
37 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Thematik
- Problemstellung und Forschungsfrage
- Einführender Literaturüberblick
- Grundlagen der CFDs
- Geschichtliche Entwicklung der Differenzkontrakte
- Funktionsweise von CFDs
- Handel mit Fremdkapital
- Finanzierungskosten
- Transaktionskosten
- Rechtliche Aspekte der CFDs
- Finanzwirtschaftliche Einordnung
- Zivilrechtliche Einordnung
- Steuerrechtliche Einordnung
- Besteuerung von CFDs
- Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
- Steuerliche Behandlung der Finanzierungskosten
- Steuerliche Verlustverrechnung
- CFDs im Risikomanagement von Privatanlegern
- Grundlagen des Risikomanagements
- Absicherung des Benzinpreises an Tankstellen mit CFDs
- Grundlagen und Methodik
- Datenanalyse
- Annahmen und Vorgehensweise
- Überprüfung der Hypothese
- Absicherung vor Steuern und ohne Transaktionskosten
- Absicherung vor Steuern und mit Transaktionskosten
- Absicherung nach Steuern und mit Transaktionskosten
- Diskussion der Ergebnisse
- Zusammenfassung und kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Contracts for Difference (CFDs) aus der Perspektive eines Privatanlegers, sowohl theoretisch als auch praktisch. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise, die rechtlichen und steuerlichen Aspekte von CFDs in Deutschland und deren Anwendung im Risikomanagement. Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Anwendung im Kontext der Absicherung von Benzinpreisen.
- Funktionsweise und Grundlagen von CFDs
- Zivil- und steuerrechtliche Einordnung von CFDs in Deutschland
- Anwendung von CFDs im Risikomanagement von Privatanlegern
- Analyse der steuerlichen Behandlung von CFDs
- Praktische Fallstudie zur Absicherung von Benzinpreisen mit CFDs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der CFDs ein, stellt die Problematik der Komplexität des Derivatemarktes für Privatanleger dar und begründet die Relevanz der Arbeit. Sie hebt die zunehmende Popularität von CFDs hervor und formuliert die Forschungsfrage, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll. Die Einleitung liefert den notwendigen Kontext und die Motivation für die anschließende detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema.
Grundlagen der CFDs: Dieses Kapitel befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung der Differenzkontrakte, erläutert deren Funktionsweise, einschließlich Handel mit Fremdkapital, Finanzierungskosten und Transaktionskosten. Es bildet die essentielle Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel, indem es die Mechanismen und Eigenschaften von CFDs detailliert beschreibt. Die verschiedenen Aspekte der Funktionsweise werden umfassend beleuchtet, um ein vollständiges Bild des Produkts zu vermitteln.
Rechtliche Aspekte der CFDs: Hier erfolgt eine eingehende zivil- und steuerrechtliche Einordnung der CFDs im deutschen Rechtssystem. Der Fokus liegt auf der steuerlichen Behandlung, inklusive der Ermittlung der Bemessungsgrundlage, der Behandlung von Finanzierungskosten und der Verlustverrechnung. Dieses Kapitel ist entscheidend, da es die rechtlichen Rahmenbedingungen und die steuerlichen Konsequenzen für Anleger detailliert darlegt. Die Ausführungen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Implikationen von CFDs für deutsche Privatanleger.
CFDs im Risikomanagement von Privatanlegern: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung von CFDs im Risikomanagement, anhand einer Fallstudie zur Absicherung des Benzinpreises an Tankstellen. Es werden die Grundlagen des Risikomanagements erläutert, die Methodik der Analyse dargestellt und die Ergebnisse der Hypothesentests präsentiert. Die Fallstudie veranschaulicht die praktische Anwendung von CFDs zur Risikominderung in einem konkreten Kontext, wodurch die theoretischen Grundlagen in die Praxis überführt werden.
Schlüsselwörter
Contracts for Difference (CFDs), Derivatemarkt, Risikomanagement, Steuerrecht, Zivilrecht, Privatanleger, Finanzierungskosten, Transaktionskosten, Benzinpreisabsicherung, Hebelprodukte, steuerliche Behandlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Bachelorarbeit: Contracts for Difference (CFDs) im Risikomanagement von Privatanlegern
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht Contracts for Difference (CFDs) aus der Perspektive von Privatanlegern. Sie analysiert die Funktionsweise, die rechtlichen und steuerlichen Aspekte von CFDs in Deutschland und deren Anwendung im Risikomanagement, mit einem Schwerpunkt auf der praktischen Anwendung zur Absicherung von Benzinpreisen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Funktionsweise und Grundlagen von CFDs, zivil- und steuerrechtliche Einordnung in Deutschland, Anwendung im Risikomanagement von Privatanlegern, steuerliche Behandlung von CFDs und eine praktische Fallstudie zur Benzinpreisabsicherung mit CFDs.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung (Einführung, Problemstellung, Literaturüberblick), Grundlagen der CFDs (Geschichte, Funktionsweise, Kosten), Rechtliche Aspekte (Finanzwirtschaftliche, zivil- und steuerrechtliche Einordnung, inkl. Besteuerung, Bemessungsgrundlage, Verlustverrechnung), CFDs im Risikomanagement (Grundlagen, Fallstudie Benzinpreisabsicherung mit Datenanalyse, Hypothesentests, Ergebnisdiskussion) und Zusammenfassung mit kritischer Reflexion.
Welche Aspekte der steuerlichen Behandlung von CFDs werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich detailliert mit der steuerlichen Einordnung von CFDs in Deutschland. Es werden die Besteuerung von CFDs, die Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage, die steuerliche Behandlung der Finanzierungskosten und die steuerliche Verlustverrechnung untersucht.
Welche Rolle spielt die Fallstudie zur Benzinpreisabsicherung?
Die Fallstudie zur Absicherung von Benzinpreisen an Tankstellen mittels CFDs dient als praktische Anwendung der theoretischen Grundlagen. Sie umfasst die Darstellung der Methodik, die Datenanalyse, die getroffenen Annahmen und die Überprüfung verschiedener Hypothesen (mit und ohne Steuern, mit und ohne Transaktionskosten).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Komplexität von CFDs für Privatanleger zu erläutern und deren Anwendung im Risikomanagement zu analysieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der verständlichen Darstellung der rechtlichen und steuerlichen Implikationen sowie der praktischen Anwendungsmöglichkeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Contracts for Difference (CFDs), Derivatemarkt, Risikomanagement, Steuerrecht, Zivilrecht, Privatanleger, Finanzierungskosten, Transaktionskosten, Benzinpreisabsicherung, Hebelprodukte, steuerliche Behandlung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Privatanleger, die sich mit dem Handel von CFDs befassen möchten, sowie für Studenten und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Derivatemarkt und Risikomanagement auseinandersetzen.
Details
- Titel
- Contracts for Difference (CFDs) unter Berücksichtigung der Besteuerung
- Hochschule
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre)
- Note
- 1,3
- Autor
- Toni Krüger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V179202
- ISBN (Buch)
- 9783656015079
- ISBN (eBook)
- 9783656015369
- Dateigröße
- 634 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- CFDS Differenzkontrakte Derivate Steuern Abgeltungsteuer Hedging Benzinpreisabsicherung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Toni Krüger (Autor:in), 2011, Contracts for Difference (CFDs) unter Berücksichtigung der Besteuerung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/179202
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-