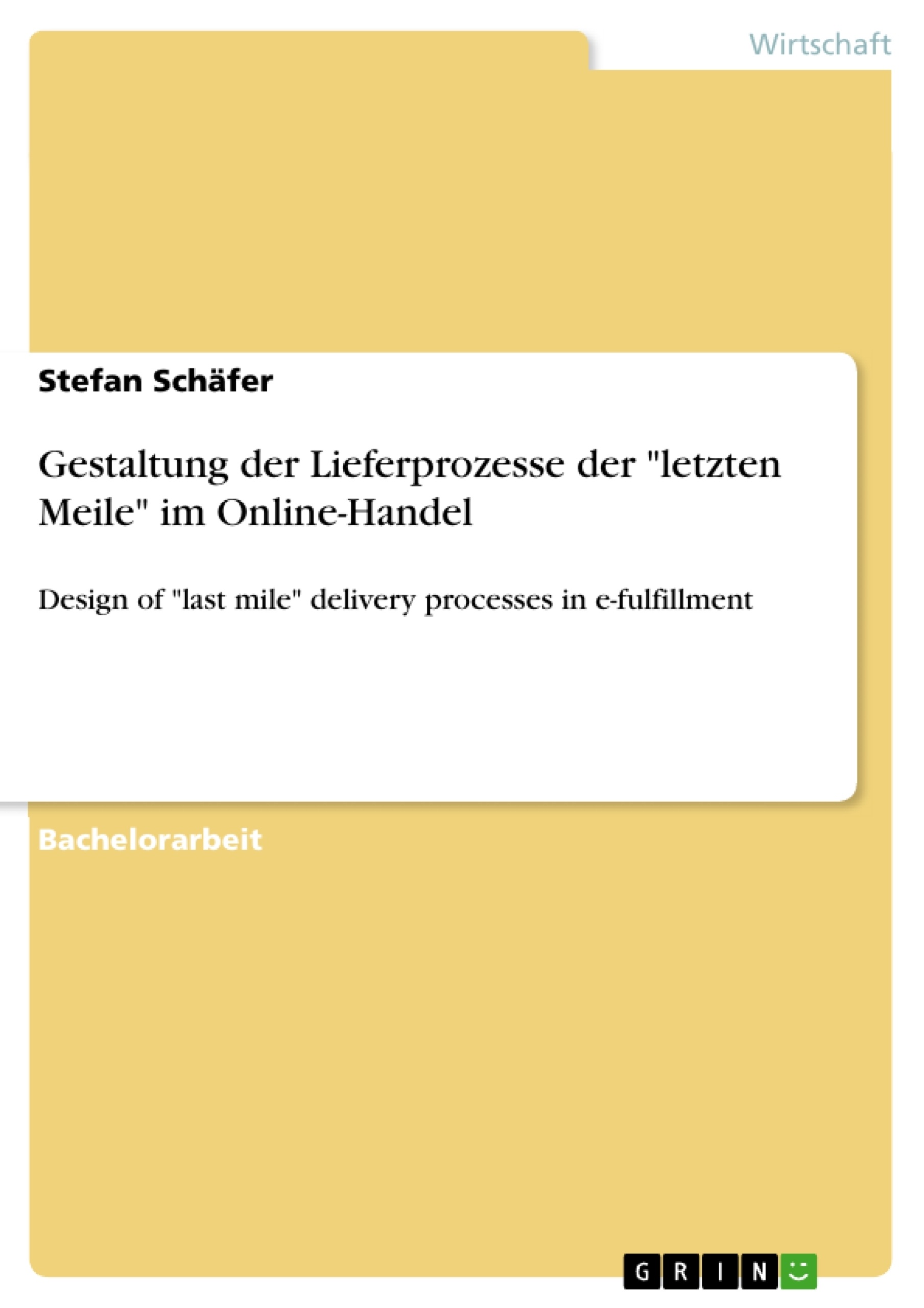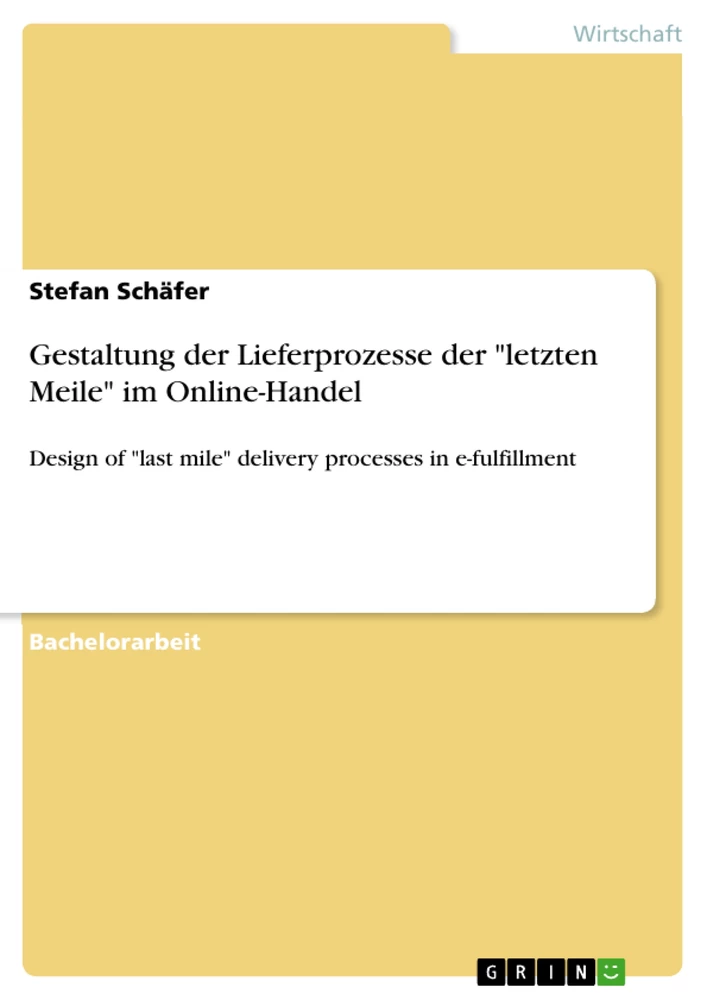
Gestaltung der Lieferprozesse der "letzten Meile" im Online-Handel
Bachelorarbeit, 2011
31 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abstract
1. Einleitung
1.1 Grundsätzliches und Bedeutung der „letzten Meile“ im Online-Handel
1.2 Bedeutung der Rücknahme im Online-Handel
1.3 Entscheidungsfaktoren
1.4 Aufbau der Arbeit
2. Gestaltung der Lieferprozesse der „letzten Meile“ zum Kunden
2.1 Direktversand durch einen KEP-Dienstleister von einem Punkt zum Kunden
2.1.1 Charakteristika
2.1.2 Praxis: Versand per KEP-Dienstleister wird grundsätzlich angeboten
2.2 Streckengeschäft / Drop-Shipping: Vom Hersteller zum Kunden
2.2.1 Charakteristika
2.2.2 Praxis: Typische Anwendungsbeispiele
2.3 Lieferung zu einem Umschlagpunkt und Weiterversand zum Kunden
2.3.1 Charakteristika
2.3.2 Praxis: Kostenvergleich nationaler und grenzüberschreitender Sendungen
2.3.3 Praxis: Betreiben mehrerer Läger
2.4 Lieferung an Ladengeschäft und Abholung durch den Kunden
2.4.1 Charakteristika
2.4.2 Abwandlung: Lieferung an einen „dritten“ Abholpunkt
2.4.3 Praxis: Nicht alle Internet-Händler mit Filialen bieten eine Abholung an
2.5 Selbst ausgeführte Auslieferung der Ware
2.5.1 Charakteristika
2.5.2 Praxis: Bedeutend für Lebensmittel und Blumen
2.5.3 Praxis: Blumenversand mit fleurop.de
2.6 Download von digitalen Produkte ohne physikalische Lieferung
3. Rücknahme: „Letzte Meile“ vom Kunden zurück zum Händler
3.1 Rücksendung mittels Paketdienst
3.1.1 Charakteristika
3.1.2 Praxis: Aufgrund gesetzlicher Regelung obligatorisch
3.2 Rückgabe im Ladengeschäft
3.2.1 Charakteristika
3.2.2 Praxis: Abholung im Ladengeschäft ermöglicht nicht zwingend Rückgabe
4. Zusammenfassung und Implikationen
4.1 Zusammenfassung
4.2 Implikationen für Forschung und Praxis
Anhang
Anhang 1: Die 25 umsatzstärksten deutschen Online-Shops
Anhang 2: Platz 26-100 der umsatzstärksten deutschen Online-Shops
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Details
- Titel
- Gestaltung der Lieferprozesse der "letzten Meile" im Online-Handel
- Untertitel
- Design of "last mile" delivery processes in e-fulfillment
- Hochschule
- Universität Mannheim
- Note
- 2,3
- Autor
- Stefan Schäfer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 31
- Katalognummer
- V179288
- ISBN (eBook)
- 9783656017028
- ISBN (Buch)
- 9783656017318
- Dateigröße
- 1558 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- Produktion Logistik Online-Handel Packstation KEP Streckengeschäft Drop-Shipping Umschlagpunkt Übersicht Ladengeschäft Abholung Auslieferung Kunde Lieferzeit Widerruf Tabelle Bachelorarbeit Bachelor Science Betriebswirtschaft Business Administration ABWL Fleischmann Lieferung letzte Meile Shopping Internet online web Fernabsatzgesetz Rücknahme Händler Einzelhandel Großhandel Hersteller Kosten Paket Haftung Lager Nachnahme Express B2C
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 21,99
- Arbeit zitieren
- Stefan Schäfer (Autor:in), 2011, Gestaltung der Lieferprozesse der "letzten Meile" im Online-Handel, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/179288
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-