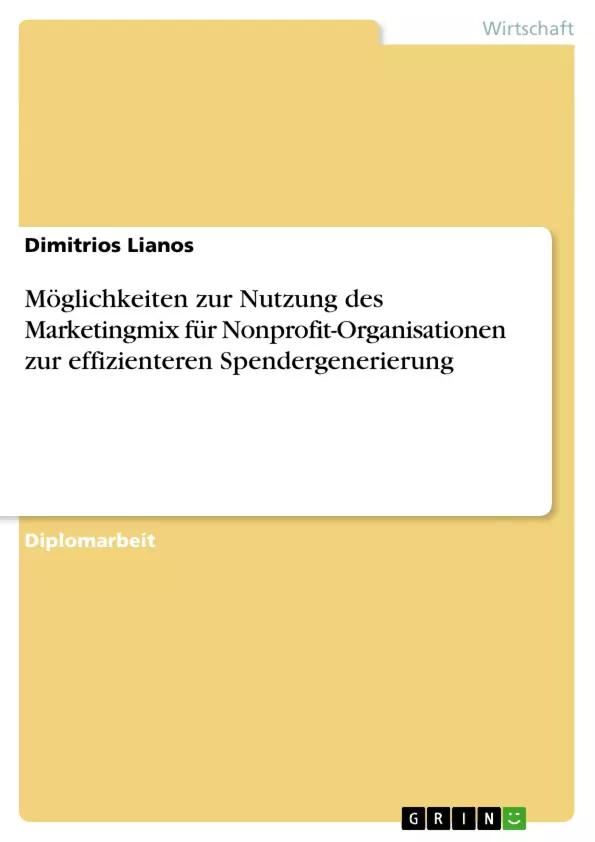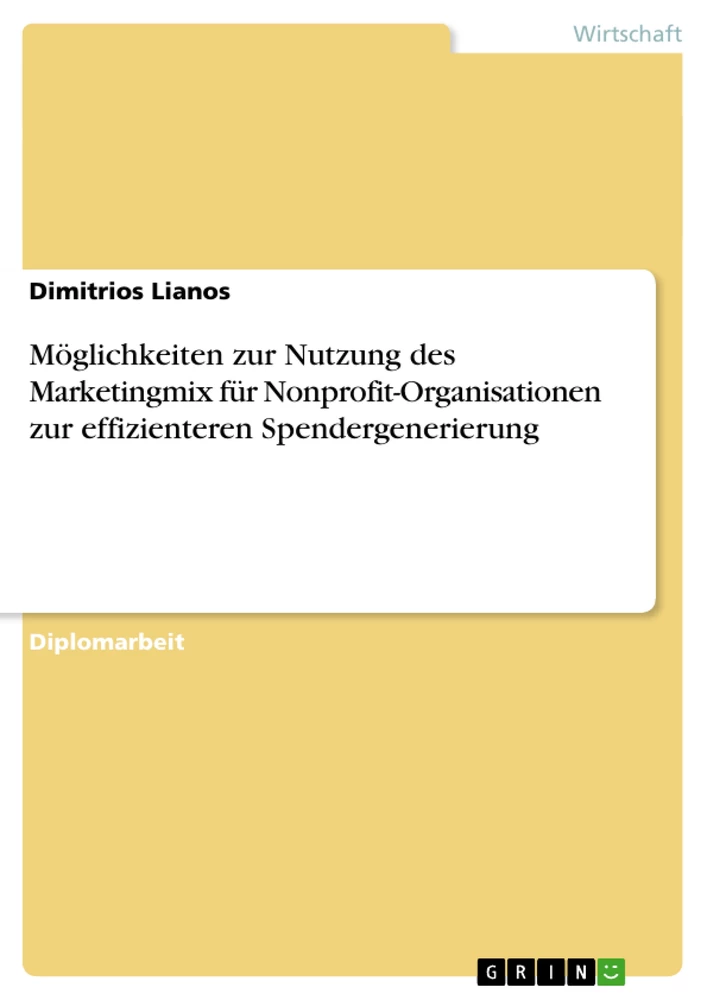
Möglichkeiten zur Nutzung des Marketingmix für Nonprofit-Organisationen zur effizienteren Spendergenerierung
Diplomarbeit, 2011
68 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorwort
- Thema und Zielsetzung
- Aufbau und Vorgehensweise der Arbeit
- Nonprofit Organisationen
- Definition von Nonprofit - Organisationen
- Besonderheiten von Nonprofit - Organisationen
- Ziele von Nonprofit – Organisationen
- Geschichtliche Entwicklung des Nonprofit Sektors
- Finanzierung von Nonprofit – Organisationen
- Definition Finanzierung
- Stellenwert der Finanzierung
- Finanzierungsstruktur
- Innenfinanzierung
- Außenfinanzierung
- Sponsoring
- Fundraising
- Abgrenzung Fundraising und Sponsoring
- Marketing-Mix
- Definition Marketing
- Geschichte des Marketings
- aktuelles Marketingverständnis
- Der Marketing-Mix
- Marketing von NPOs
- Besonderheiten von NPO-Marketing
- Ziele von NPO-Marketing
- Monetäre Bedeutung des Marketings bei NPOS
- Maßnahmen von international tätigen Organisationen
- Verbesserungsansätze
- Projekt: Das neue Städel
- Das Städel
- Thematischer Inhalt des Projekts
- Zielsetzung des Projekts
- Projektpartner
- Maßnahmen
- Maßnahmenmix
- Online
- Event
- Sonstige Maßnahmen
- Status Quo
- Resümee und Verbesserungsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten zur Nutzung des Marketingmix für Nonprofit-Organisationen, um die Effizienz der Spendergenerierung zu steigern.
- Definition und Besonderheiten von Nonprofit-Organisationen
- Finanzierung von Nonprofit-Organisationen, insbesondere Sponsoring und Fundraising
- Die Anwendung des Marketing-Mix für Nonprofit-Organisationen
- Best-Practice-Beispiele von international tätigen Nonprofit-Organisationen
- Optimierungsansätze für Marketingmaßnahmen in Nonprofit-Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas im Kontext der sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Herausforderungen für Nonprofit-Organisationen heraus. Kapitel 2 definiert Nonprofit-Organisationen und erläutert ihre Besonderheiten, Ziele und historische Entwicklung. Kapitel 3 beleuchtet die Finanzierung von Nonprofit-Organisationen, einschließlich der Finanzierungsstruktur und der Bedeutung von Sponsoring und Fundraising. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Marketing-Mix und seinem Einsatz für Nonprofit-Organisationen. Kapitel 5 fokussiert auf die Besonderheiten des NPO-Marketings, die Ziele, die monetäre Bedeutung und Maßnahmen internationaler Organisationen.
Schlüsselwörter
Nonprofit-Organisationen, Spendergenerierung, Marketing-Mix, Sponsoring, Fundraising, NPO-Marketing, internationale Organisationen, Optimierungsansätze, Projekt: Das neue Städel.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Nonprofit-Organisationen (NPOs) den Marketingmix nutzen?
NPOs nutzen den Marketingmix, um Imagekampagnen zu steuern, Spendersegmente zu erschließen und die Effizienz ihrer Fundraising-Maßnahmen zu steigern.
Was ist der Unterschied zwischen Sponsoring und Fundraising?
Sponsoring basiert auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung (z.B. Werbefläche gegen Geld), während Fundraising das Einwerben von Spenden ohne direkte materielle Gegenleistung beschreibt.
Welche Besonderheiten hat das NPO-Marketing?
Es muss oft Widerstände gegen Kommerzialisierung überwinden und eine hohe Transparenz hinsichtlich der Mittelverwendung bieten, um das Vertrauen der Spender zu sichern.
Was zeigt das Projekt "Das neue Städel" als Best-Practice-Beispiel?
Es demonstriert einen erfolgreichen Maßnahmenmix aus Online-, Print- und Event-Marketing zur Finanzierung eines großen kulturellen Bauprojekts.
Warum sind Transparenz und Bilanzen im NPO-Sektor wichtig?
Sie rechtfertigen die notwendigen Marketingausgaben gegenüber den Spendern und zeigen das Verhältnis von Einnahmen zu Verwaltungskosten auf.
Details
- Titel
- Möglichkeiten zur Nutzung des Marketingmix für Nonprofit-Organisationen zur effizienteren Spendergenerierung
- Hochschule
- Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main
- Veranstaltung
- Public Management
- Note
- 1,7
- Autor
- Dimitrios Lianos (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 68
- Katalognummer
- V180370
- ISBN (eBook)
- 9783656030904
- ISBN (Buch)
- 9783656031130
- Dateigröße
- 672 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- NPO NGO Non-Profit-Organisation BWL Marketing Marketing-Mix
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Dimitrios Lianos (Autor:in), 2011, Möglichkeiten zur Nutzung des Marketingmix für Nonprofit-Organisationen zur effizienteren Spendergenerierung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/180370
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-