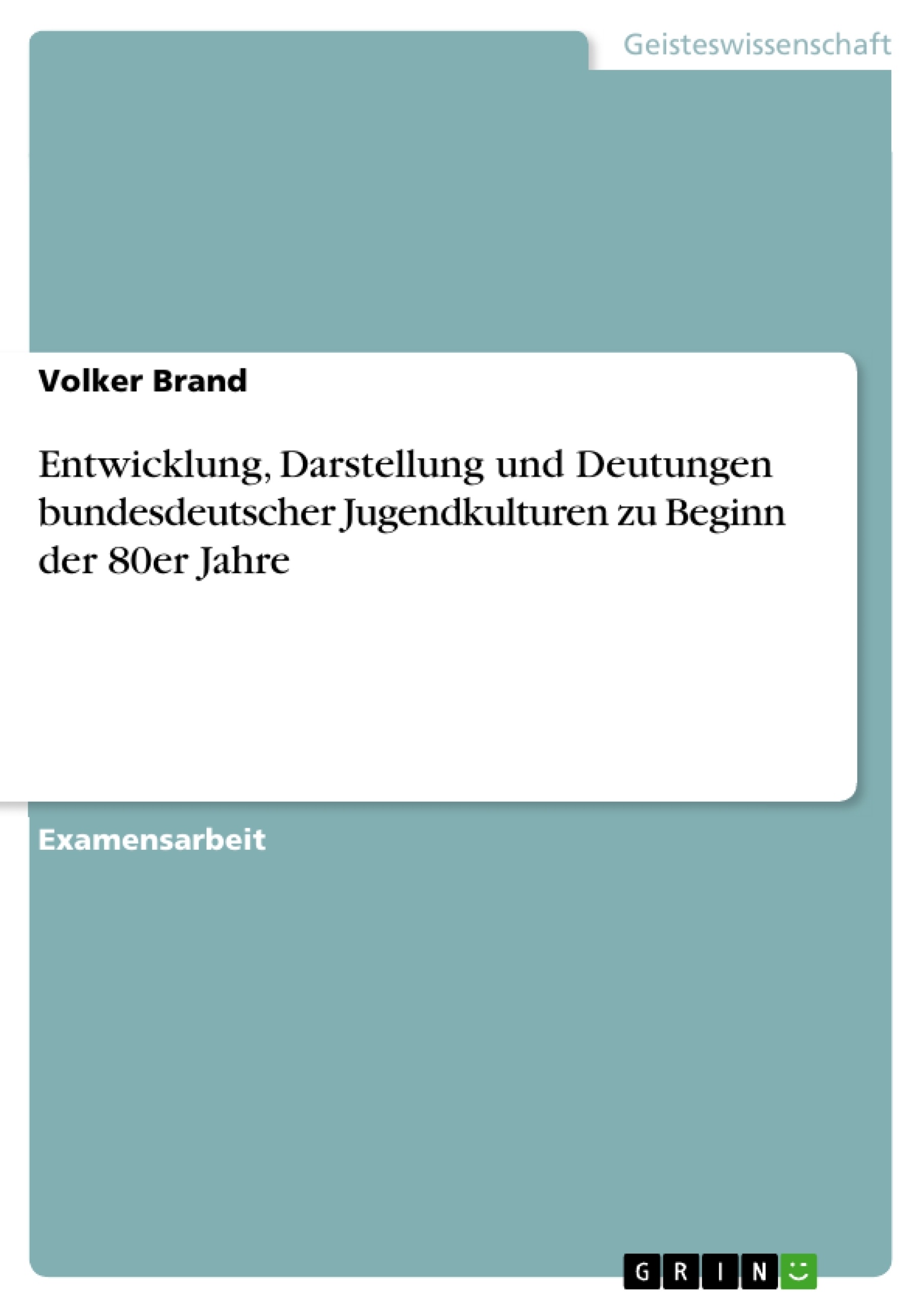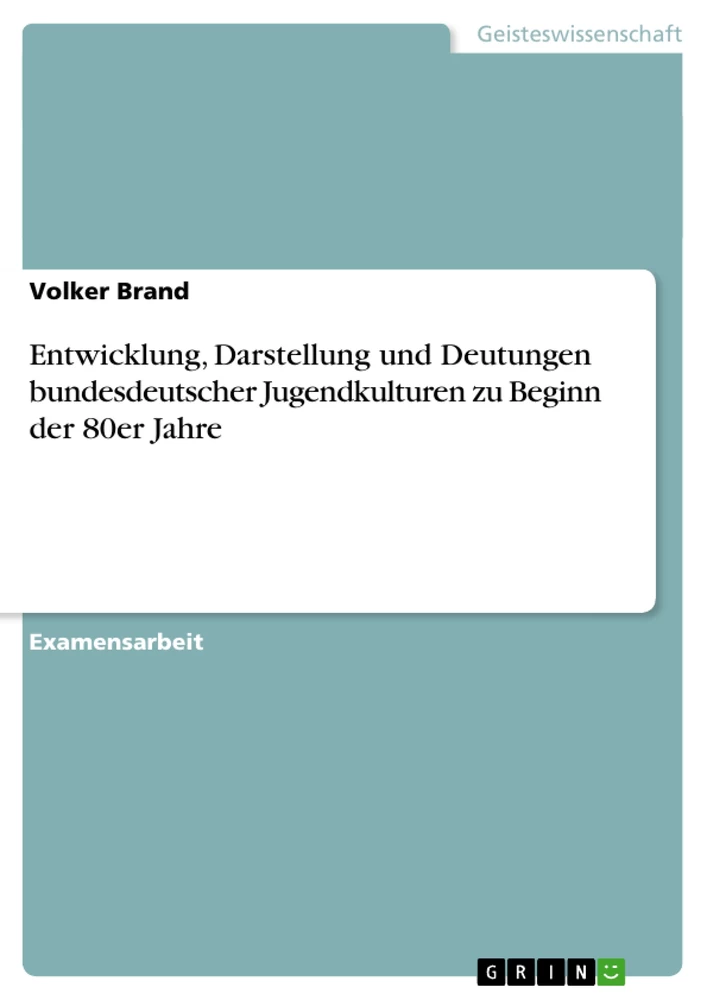
Entwicklung, Darstellung und Deutungen bundesdeutscher Jugendkulturen zu Beginn der 80er Jahre
Examensarbeit, 1983
95 Seiten, Note: 1,6
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kurze Einführung in die Jugendsoziologie
- 1. Begriffliche Vorabklärung - was ist Jugend?
- 2. Klassische sozialwissenschaftliche Jugendtheorien
- 2.1. Der generationstheoretische Ansatz Karl Mannheims
- 2.2. Schelskys phänomenologische Gegenwartsanalyse der Jugend
- 2.3. Der funktionalistische Ansatz von Eisenstadt
- 2.4. Tenbrucks handlungstheoretischer Ansatz
- III. Zur sozialen Lage der heutigen Jugend
- 1. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt und ihre Auswirkungen
- 2. Die Lage der Jugendlichen im Bildungswesen
- IV. Jugendkultur als jugendliche Subkultur
- 1. Struktur und Stil formen der neueren Jugendkulturen
- 2. Teilkultur, Subkultur, Gegenkultur?
- 3. Stilelemente der jugendlichen Alltagskultur
- V. Die Entwicklung der Jugendkulturen von den 60er Jahren bis heute
- 1. Der Aufbruch der Jugend in den 60er Jahren
- 2. Die Entwicklung der Musikkultur nach Woodstock
- 3. Politische Kultur und Jugend in den 70er Jahren
- VI. Jugend und Gesellschaft zu Beginn der 80er Jahre
- 1. Ausgrenzungserscheinungen
- 2. Konfliktfeld 'Familie'
- 3. Das Verhältnis der jungen Generation zu Schule, Hochschule, Ehe, Wehr- und Zivildienst
- 3.1. Ehe und Familie - (k)eine Perspektive für die Jugend?
- 3.2. Schule
- 3.3. Hochschule
- 3.4. Bundeswehr bzw. Zivildienst
- 4. Einstellung zu Politik und Parteien
- 5. Deviantes Verhalten
- 5.1. Jugendkriminalität
- 5.2. Drogen
- 5.3. Jugendreligionen
- 6. Alternativkultur als Gegenkultur
- VII. Das Wertverständnis der heutigen Jugend
- 1. Wertewandel und Alternativkultur
- 2. Die These vom Wertwandel in der Jugend
- VIII. Deutungsversuche der neueren Jugendforschung
- 1. Der Neue Sozialisationstyp Narziss
- 1.1. Theorie
- 1.2. Kritik
- 2. Dieter Baackes Erklärungsansätze
- 2.1. Die Theorie der Wertkrise
- 2.2. Der sozialökologische Ansatz
- 3. Exkurs: Der kulturanthropologische Ansatz von Margaret Mead
- 1. Der Neue Sozialisationstyp Narziss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die bundesdeutschen Jugendkulturen zu Beginn der 1980er Jahre. Ziel ist es, deren Entwicklung, Darstellung und Interpretationen in der damaligen Jugendsoziologie zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die sozialen Bedingungen der Jugend, die Ausprägungen der Jugendkulturen und die Versuche, diese soziologisch zu erklären.
- Soziale Lage der Jugend in den frühen 1980er Jahren (Arbeitsmarkt, Bildungssystem)
- Entwicklung und Charakteristika bundesdeutscher Jugendkulturen
- Jugendkulturen als Sub- und Gegenkulturen
- Wertvorstellungen und Wertewandel der Jugend
- Soziologische Deutungsansätze der Jugendforschung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der bundesdeutschen Jugendkulturen zu Beginn der 80er Jahre ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen und den methodischen Ansatz.
II. Kurze Einführung in die Jugendsoziologie: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über zentrale Begriffe und Theorien der Jugendsoziologie. Es werden verschiedene Ansätze wie der generationstheoretische Ansatz Mannheims, Schelskys phänomenologische Analyse, der funktionalistische Ansatz Eisenstadts und der handlungstheoretische Ansatz Tenbrucks vorgestellt und in ihren Grundzügen erläutert. Dies legt die theoretische Grundlage für die spätere Analyse der Jugendkulturen.
III. Zur sozialen Lage der heutigen Jugend: Dieses Kapitel beschreibt die sozioökonomische Situation der Jugend in den frühen 1980ern. Es analysiert die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Herausforderungen im Bildungssystem und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und die Identitätsfindung junger Menschen. Der Fokus liegt auf den strukturellen Bedingungen, die die Jugendkulturen prägen.
IV. Jugendkultur als jugendliche Subkultur: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Charakterisierung von Jugendkulturen. Es untersucht den Unterschied zwischen Teilkultur, Subkultur und Gegenkultur und analysiert die stilistischen Elemente der jugendlichen Alltagskultur, um die verschiedenen Ausprägungen und ihre Bedeutungen zu verstehen. Die Kapitel beschreibt die Interaktion zwischen Jugendkultur und Gesellschaft.
V. Die Entwicklung der Jugendkulturen von den 60er Jahren bis heute: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung der Jugendkulturen von den 1960er Jahren bis in die frühen 1980er Jahre nach. Es analysiert den Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen, politischen Ereignissen und der Entwicklung der Musikkultur auf die Entstehung und Transformation verschiedener Jugendkulturen. Der Fokus liegt auf den Kontinuitäten und Brüchen in der Entwicklung der Jugendkultur.
VI. Jugend und Gesellschaft zu Beginn der 80er Jahre: Dieses Kapitel beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Jugend und Gesellschaft zu Beginn der 80er Jahre. Es analysiert Ausgrenzungserscheinungen, Konflikte im familiären Umfeld und das Verhältnis der jungen Generation zu Institutionen wie Schule, Hochschule, Bundeswehr und Zivildienst. Es befasst sich mit politischen Einstellungen, devianten Verhaltensweisen wie Jugendkriminalität und Drogenkonsum und der Rolle der Alternativkultur als Gegenkultur. Das Kapitel zeigt die Herausforderungen und Konflikte, denen die Jugend begegnete.
VII. Das Wertverständnis der heutigen Jugend: Dieses Kapitel analysiert die Wertevorstellungen der Jugend der frühen 1980er und untersucht den möglichen Wertewandel im Vergleich zu vorherigen Generationen. Es setzt die Wertevorstellungen in Bezug zur Alternativkultur und diskutiert die These eines umfassenden Wertewandels.
VIII. Deutungsversuche der neueren Jugendforschung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene soziologische Erklärungsansätze für die Jugendkulturen der 1980er Jahre. Es analysiert den "Neuen Sozialisationstyp Narziss", die Theorie der Wertkrise nach Dieter Baacke, den sozialökologischen Ansatz und den kulturanthropologischen Ansatz von Margaret Mead. Es werden die Stärken und Schwächen der verschiedenen Theorien kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Jugendkulturen, Jugendsoziologie, 1980er Jahre, Bundesrepublik Deutschland, Subkultur, Gegenkultur, Wertewandel, Sozialisation, Jugendforschung, Arbeitsmarkt, Bildungssystem, Devianz, Alternativkultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Examensarbeit: Jugendkulturen in der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der 1980er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Examensarbeit?
Die Examensarbeit analysiert bundesdeutsche Jugendkulturen zu Beginn der 1980er Jahre. Sie untersucht deren Entwicklung, Darstellung und Interpretationen in der damaligen Jugendsoziologie, beleuchtet die sozialen Bedingungen der Jugend, die Ausprägungen der Jugendkulturen und die Versuche, diese soziologisch zu erklären.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die soziale Lage der Jugend (Arbeitsmarkt, Bildungssystem), die Entwicklung und Charakteristika bundesdeutscher Jugendkulturen, Jugendkulturen als Sub- und Gegenkulturen, Wertvorstellungen und Wertewandel der Jugend sowie soziologische Deutungsansätze der Jugendforschung.
Welche soziologischen Theorien werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene soziologische Ansätze zur Erklärung von Jugend und Jugendkulturen. Dazu gehören der generationstheoretische Ansatz Mannheims, Schelskys phänomenologische Analyse, der funktionalistische Ansatz Eisenstadts, der handlungstheoretische Ansatz Tenbrucks, der "Neue Sozialisationstyp Narziss", die Theorie der Wertkrise nach Dieter Baacke, der sozialökologische Ansatz und der kulturanthropologische Ansatz von Margaret Mead.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, eine kurze Einführung in die Jugendsoziologie, die soziale Lage der Jugend, Jugendkultur als Subkultur, die Entwicklung der Jugendkulturen von den 1960er Jahren bis in die frühen 1980er Jahre, Jugend und Gesellschaft zu Beginn der 80er Jahre, das Wertverständnis der Jugend und Deutungsversuche der neueren Jugendforschung. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung im Text.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendkulturen, Jugendsoziologie, 1980er Jahre, Bundesrepublik Deutschland, Subkultur, Gegenkultur, Wertewandel, Sozialisation, Jugendforschung, Arbeitsmarkt, Bildungssystem, Devianz, Alternativkultur.
Welche Zeitspanne wird in der Arbeit betrachtet?
Der Fokus liegt auf den Jugendkulturen zu Beginn der 1980er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Entwicklung der Jugendkulturen auch im Kontext der 1960er und 1970er Jahre betrachtet wird.
Welche Aspekte der Jugendkultur werden besonders untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Jugendkultur, einschließlich der strukturellen Bedingungen (Arbeitsmarkt, Bildung), stilistischen Elementen, der Beziehung zwischen Jugendkultur und Gesellschaft (Subkultur, Gegenkultur), Wertevorstellungen und deren Wandel, und soziologische Interpretationen dieser Phänomene.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln finden sich in den jeweiligen Kapitelzusammenfassungen innerhalb des Textes der Arbeit. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über den Inhalt und die Kernaussagen jedes Kapitels.
Details
- Titel
- Entwicklung, Darstellung und Deutungen bundesdeutscher Jugendkulturen zu Beginn der 80er Jahre
- Hochschule
- Universität Bielefeld
- Note
- 1,6
- Autor
- Dr. Volker Brand (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1983
- Seiten
- 95
- Katalognummer
- V180954
- ISBN (eBook)
- 9783656039631
- ISBN (Buch)
- 9783656040194
- Dateigröße
- 776 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Jugendsoziologie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Dr. Volker Brand (Autor:in), 1983, Entwicklung, Darstellung und Deutungen bundesdeutscher Jugendkulturen zu Beginn der 80er Jahre, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/180954
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-