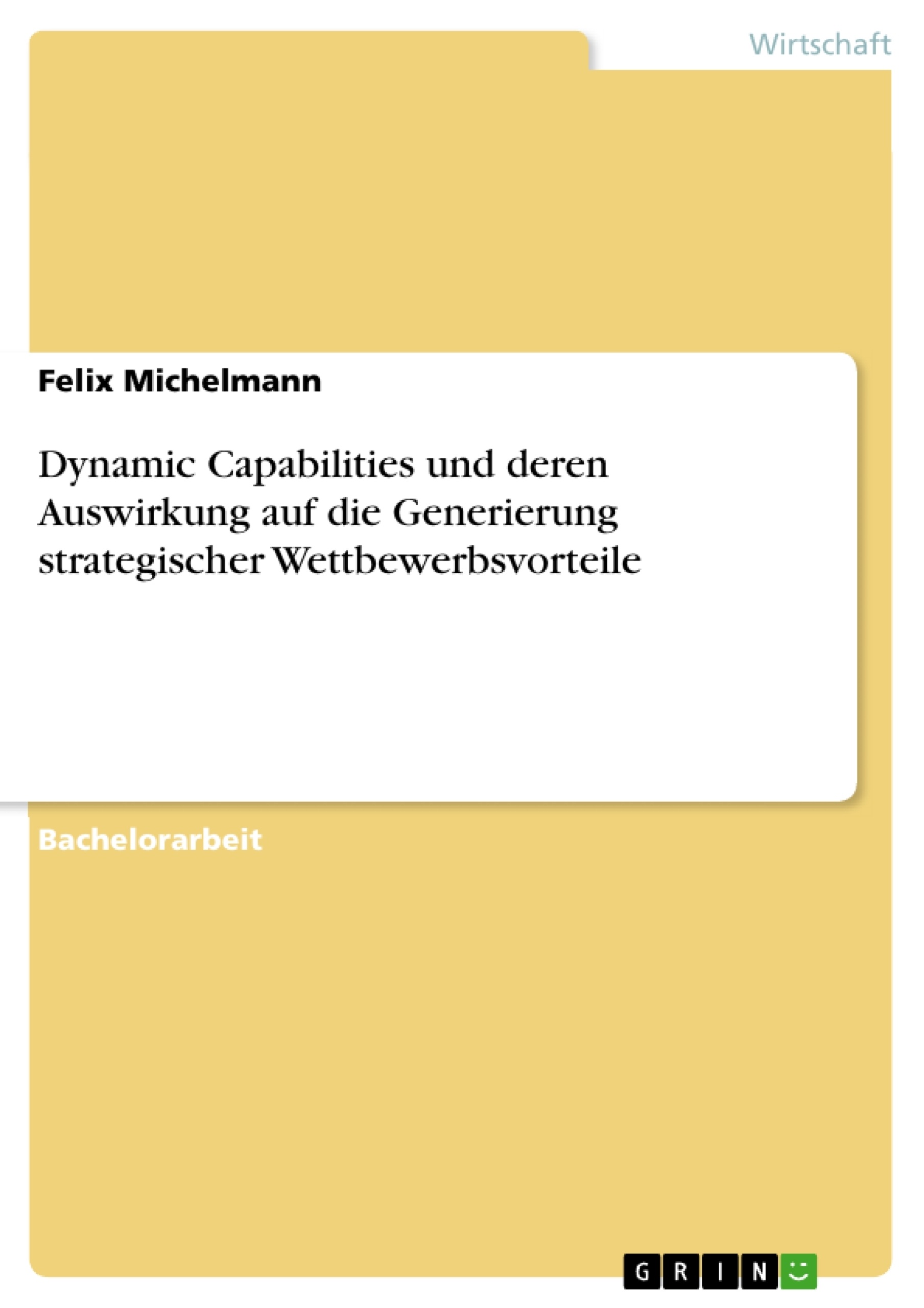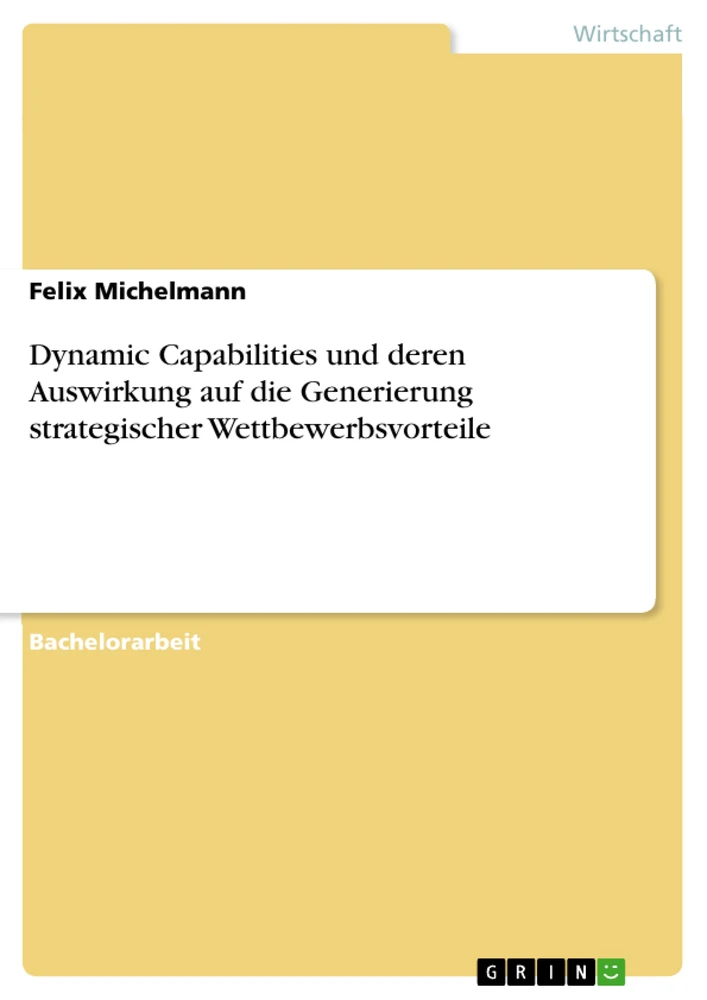
Dynamic Capabilities und deren Auswirkung auf die Generierung strategischer Wettbewerbsvorteile
Bachelorarbeit, 2011
47 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen
- Definitorische Abgrenzung
- Ressourcen
- Kompetenzen
- Dynamic Capabilities
- Überblick relevanter Ansätze des strategischen Managements
- Resource-based View
- Strategischer Wettbewerbsvorteil und VRIN Kriterien
- Dynamic Capability Ansatz
- Vorstellung prominenter Konzeptionen des DCA
- Rahmenwerk von Teece/Pisano/Shuen
- Vorstellung des Rahmenwerks
- Erklärung strategischer Wettbewerbsvorteile
- Rahmenwerk von Eisenhardt/ Martin
- Vorstellung des Rahmenwerks
- Erklärung strategischer Wettbewerbsvorteile
- Rahmenwerk von Teece/Pisano/Shuen
- Analyse prominenter Konzeptionen des DCA
- Analyse des Rahmenwerks von Teece/ Pisano/ Shuen
- Bewertung des Konzepts
- Eignung zur Erklärung strategischer Wettbewerbsvorteile
- Analyse des Rahmenwerks von Eisenhardt/ Martin
- Bewertung des Konzepts
- Eignung zur Erklärung strategischer Wettbewerbsvorteile
- Analyse des Rahmenwerks von Teece/ Pisano/ Shuen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Dynamic Capabilities und deren Auswirkung auf die Generierung strategischer Wettbewerbsvorteile. Sie analysiert verschiedene Konzeptionen des Dynamic Capability Ansatzes und untersucht deren Eignung zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen in dynamischen Märkten.
- Die Bedeutung von Dynamic Capabilities in einem dynamischen Marktumfeld
- Analyse des Resource-based View und seiner Grenzen in dynamischen Märkten
- Untersuchung prominenter Konzeptionen des Dynamic Capability Ansatzes
- Bewertung der Eignung der Konzeptionen zur Erklärung strategischer Wettbewerbsvorteile
- Diskussion der Bedeutung von Dynamic Capabilities für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt die Problematik des dynamischen Marktumfelds und die Bedeutung von Dynamic Capabilities für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen dar. Sie zeigt auf, dass traditionelle Ansätze des strategischen Managements, die auf Ressourcen und Kompetenzen basieren, in dynamischen Märkten zunehmend an Bedeutung verlieren.
- Grundlagen: Dieses Kapitel definiert grundlegende Begriffe wie Ressourcen, Kompetenzen und Dynamic Capabilities. Es erläutert den Resource-based View und die VRIN Kriterien, die die Bedeutung von Ressourcen für die Generierung von Wettbewerbsvorteilen hervorheben. Außerdem wird der Dynamic Capability Ansatz als neuerer Ansatz zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen in dynamischen Märkten vorgestellt.
- Vorstellung prominenter Konzeptionen des DCA: Dieses Kapitel präsentiert zwei prominente Konzeptionen des Dynamic Capability Ansatzes, das Rahmenwerk von Teece/Pisano/Shuen und das Rahmenwerk von Eisenhardt/Martin. Es werden die wesentlichen Elemente der beiden Konzeptionen vorgestellt und deren Ansatz zur Erklärung strategischer Wettbewerbsvorteile dargestellt.
- Analyse prominenter Konzeptionen des DCA: Dieses Kapitel analysiert die beiden vorgestellten Konzeptionen des Dynamic Capability Ansatzes im Detail. Es werden deren Stärken und Schwächen beleuchtet und deren Eignung zur Erklärung strategischer Wettbewerbsvorteile bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Dynamic Capabilities, strategischer Wettbewerbsvorteil, Resource-based View, VRIN Kriterien, dynamisches Marktumfeld, Innovationsfähigkeit, Wandelmanagement, Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensstrategie. Sie analysiert verschiedene Konzeptionen des Dynamic Capability Ansatzes und untersucht deren Eignung zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen in einem dynamischen Marktumfeld.
Details
- Titel
- Dynamic Capabilities und deren Auswirkung auf die Generierung strategischer Wettbewerbsvorteile
- Hochschule
- Georg-August-Universität Göttingen (Professur für Unternehmensführung und Organisation)
- Veranstaltung
- Bachelorarbeit
- Note
- 1,3
- Autor
- Felix Michelmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V181405
- ISBN (eBook)
- 9783656044253
- ISBN (Buch)
- 9783656044499
- Dateigröße
- 660 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Das Werk liefert ein profundes und bisher einmaliges Assessment des Dynamic Capability Ansatzes. Es eignet sich daher insbesondere für Unternehmensberater und Wissenschaftler.
- Schlagworte
- Dynamic Capabilities Dynamic Capabilities Strategie strategisch Wettbewerbsvorteil strategischer Wettbewerberbsvorteil DCA Dynamic Capabilities Ansatz Dynamic Capability Ansatz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Felix Michelmann (Autor:in), 2011, Dynamic Capabilities und deren Auswirkung auf die Generierung strategischer Wettbewerbsvorteile, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/181405
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-