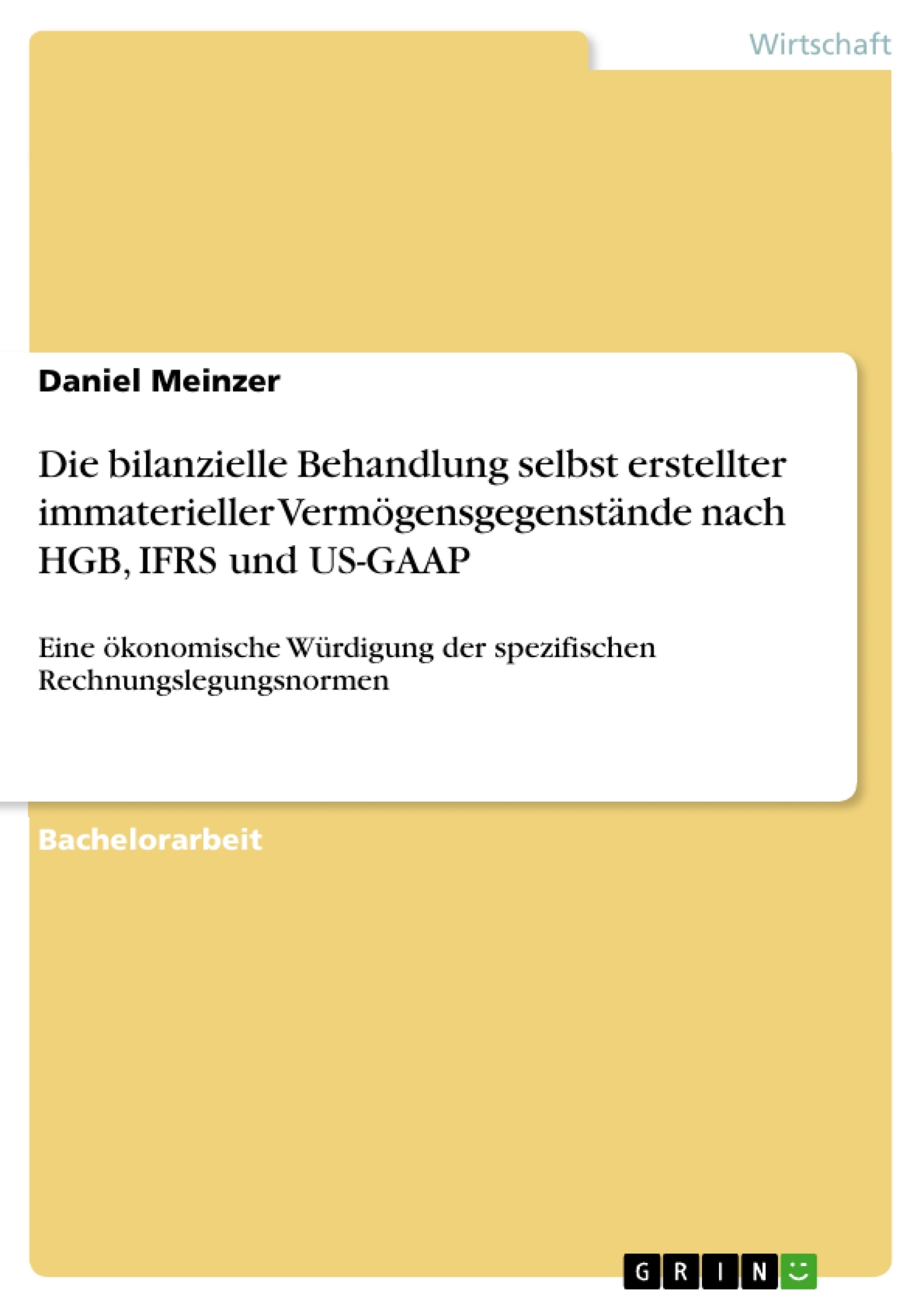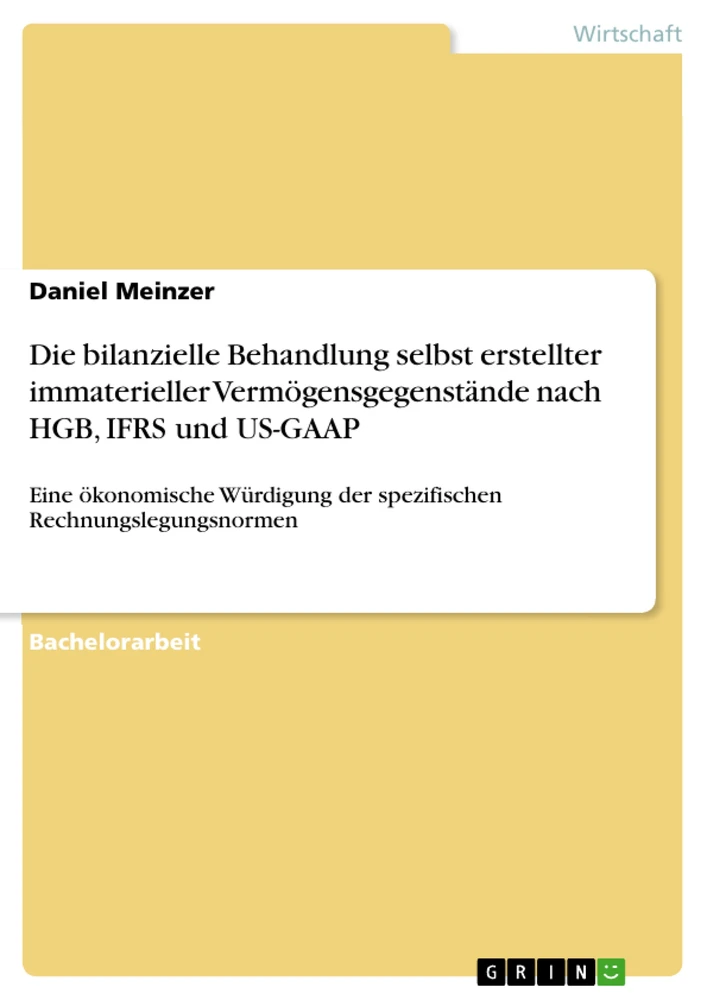
Die bilanzielle Behandlung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB, IFRS und US-GAAP
Bachelorarbeit, 2011
37 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Motivation
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Vorgehensweise
- 2. Begriffsbestimmung
- 3. Besonderheiten der Rechnungslegungsnormen hinsichtlich immaterieller Vermögensgegenstände
- 3.1. Nach Handelsgesetzbuch
- 3.2. Nach US - GAAP
- 3.3. Nach IFRS
- 4. Bilanzierung des derivativen Goodwills
- 4.1. Nach Handelsgesetzbuch
- 4.2. Nach US - GAAP
- 4.3. Nach IFRS
- 5. Kritische Reflexion der aktuellen Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der bilanziellen Behandlung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände nach den Rechnungslegungsstandards HGB, IFRS und US-GAAP. Die Arbeit zielt darauf ab, die spezifischen Rechnungslegungsnormen im Kontext der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte zu analysieren und deren ökonomische Relevanz zu bewerten.
- Rechnungslegungsnormen für immaterielle Vermögenswerte im HGB, IFRS und US-GAAP
- Bilanzierung des derivativen Goodwills nach verschiedenen Rechnungslegungsstandards
- Kritische Analyse der aktuellen Diskussionen und Kritikpunkte im Bereich der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte
- Ökonomische Würdigung der spezifischen Rechnungslegungsnormen
- Bedeutung von immateriellen Vermögenswerten im Kontext des wirtschaftlichen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Motivation, der Zielsetzung und der Vorgehensweise. Kapitel 2 erläutert die Begriffsbestimmung immaterieller Vermögenswerte. In Kapitel 3 werden die Besonderheiten der Rechnungslegungsnormen hinsichtlich immaterieller Vermögensgegenstände im HGB, US-GAAP und IFRS vorgestellt. Kapitel 4 analysiert die Bilanzierung des derivativen Goodwills unter den drei Rechnungslegungsstandards. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der kritischen Reflexion der aktuellen Kritik an der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögenswerte, Rechnungslegungsstandards, HGB, IFRS, US-GAAP, Bilanzierung, derivativer Goodwill, ökonomische Bewertung, Kritik, Dienstleistungssektor.
Details
- Titel
- Die bilanzielle Behandlung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB, IFRS und US-GAAP
- Untertitel
- Eine ökonomische Würdigung der spezifischen Rechnungslegungsnormen
- Hochschule
- Universität der Bundeswehr München, Neubiberg (Institut für Versicherungswirtschaft)
- Note
- 1,7
- Autor
- Daniel Meinzer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V181555
- ISBN (eBook)
- 9783656046974
- ISBN (Buch)
- 9783656047759
- Dateigröße
- 698 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Immaterialgüter Bilanzierung HGB US-GAAP IFRS Goodwill Firmenwert Good-Will
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Daniel Meinzer (Autor:in), 2011, Die bilanzielle Behandlung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB, IFRS und US-GAAP, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/181555
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-