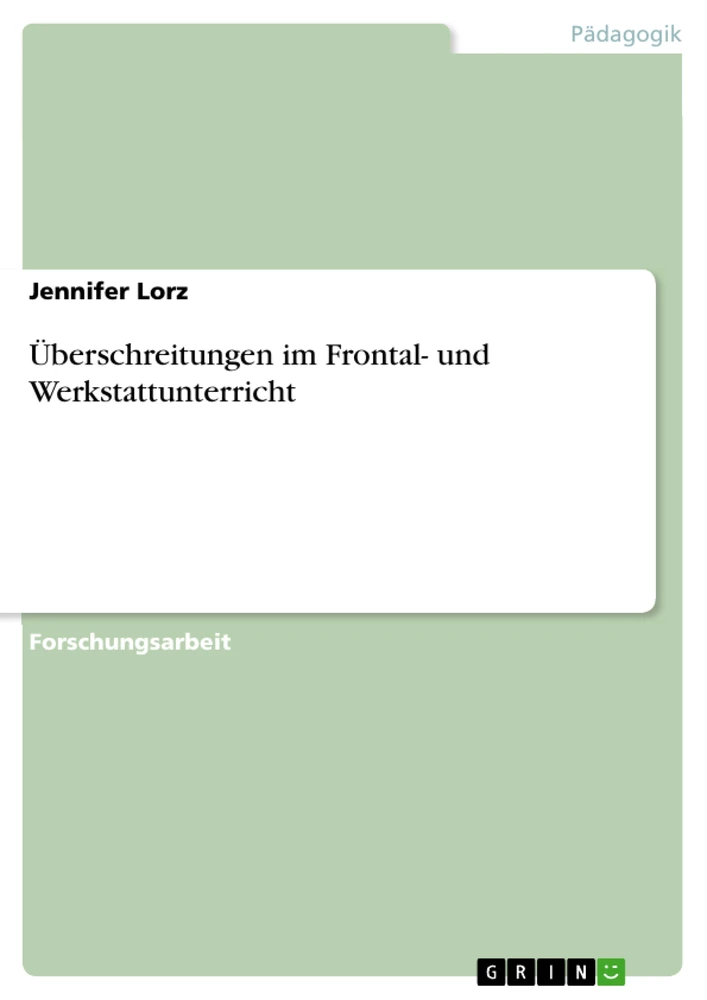
Überschreitungen im Frontal- und Werkstattunterricht
Forschungsarbeit, 2010
49 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Frontal- und Werkstattunterricht
- 2.1.1 Frontalunterricht
- 2.1.2 Werkstattunterricht
- 2.2 Definition der Überschreitung
- 2.3 Fragestellung und Erwartung
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Methodische Vorüberlegung
- 3.1.1 Forschungsstrategie und Wahl der Methode
- 3.1.2 Das Kategoriensystem der Überschreitungen
- 3.2 Konstruktion des Beobachtungsverfahrens
- 3.2.1 Wie wird beobachtet?
- 3.2.2 Was wird beobachtet und wie wird protokolliert?
- 4 Durchführung
- 4.1 Die Stichprobe
- 4.1.1 Das Beobachtungsfeld
- 4.1.2 Stichprobenbeschreibung
- 4.2 Der Erstkontakt
- 4.3 Eine Beobachtungsstunde
- 4.4 Die Erhebungsstrategie
- 4.5 Die Auswertung
- 5 Ergebnisse und Diskussion
- 5.1 Häufigkeitsverteilung von Überschreitungen in den Wochen
- 5.1.1 Die erste Woche
- 5.1.2 Die zweite Woche
- 5.2 Häufigkeitsverteilung im Überblick
- 5.3 Implikationen
- 5.4 Ausblick
- 6 Literaturverzeichnis
- 7 Abbildungs— und Diagrammverzeichnis
- I Anhang
- 8.1 Erläuterung
- 8.2 Erhebungsdokumentation
- 8.2.1 Tag 1
- 8.2.2 Tag 2
- 8.2.3 Tag 3
- 8.2.4 Tag 4
- 8.2.5 Tag 5
- 8.2.6 Tag 6
- 8.2.7 Tag 7
- 8.2.8 Tag 8
- 8.2.9 Tag 9
- 8.3 Tagesmatrizen
- 8.3.1 Matrix Tag 1
- 8.3.2 Matrix Tag 2
- 8.3.3 Matrix Tag 3
- 8.3.4 Matrix Tag 4
- 8.3.5 Matrix Tag 5
- 8.3.6 Matrix Tag 6
- 8.3.7 Matrix Tag 7
- 8.3.8 Matrix Tag 8
- 8.3.9 Matrix Tag
- 8.4 Wochenmatrizen
- 8.4.1 Woche 1
- 8.4.2 Woche 2
- 8.5 Matrix im Gesamtüberblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht Überschreitungen im Frontal- und Werkstattunterricht. Die Studie analysiert die Häufigkeit und Art der Unterrichtsstörungen in beiden Unterrichtsformen und zielt darauf ab, pädagogische Implikationen für die Praxis abzuleiten.
- Vergleich von Frontal- und Werkstattunterricht hinsichtlich Überschreitungen
- Analyse der Häufigkeitsverteilung von Überschreitungen in beiden Unterrichtsformen
- Entwicklung eines Kategoriensystems zur Beschreibung von Überschreitungen
- Entwicklung von pädagogischen Implikationen für die Praxis
- Identifizierung von Forschungsfragen für zukünftige Untersuchungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Diese Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar, indem sie die Herausforderungen im Schulunterricht beleuchtet, die durch veränderte Lebensbedingungen von Schülern entstehen. Sie führt das Thema Überschreitungen in den Unterrichtsformen Frontal- und Werkstattunterricht ein und skizziert die Forschungsziele.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Funktionsweise von Frontal- und Werkstattunterricht. Es definiert den Begriff der Überschreitung und erläutert die Fragestellung und die Erwartungen der Studie.
- Kapitel 3: Empirische Untersuchung Dieses Kapitel präsentiert die methodischen Vorüberlegungen der Studie, einschließlich der Forschungsstrategie und der Wahl der Methode. Es beschreibt das Kategoriensystem zur Analyse von Überschreitungen und die Konstruktion des Beobachtungsverfahrens.
- Kapitel 4: Durchführung Dieses Kapitel beschreibt die Stichprobe, die Durchführung der Beobachtung und die Erhebungsstrategie der Studie. Es erläutert den Erstkontakt mit der Klasse, die Beobachtung einer Unterrichtsstunde und die Auswertungsmethode.
- Kapitel 5: Ergebnisse und Diskussion Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, einschließlich der Häufigkeitsverteilung von Überschreitungen in den beobachteten Unterrichtsformen. Es diskutiert die Ergebnisse und leitet pädagogische Implikationen ab. Der Ausblick gibt Anregungen für weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Themen Frontalunterricht, Werkstattunterricht, Unterrichtsstörungen, Überschreitungen, Unterrichtsformen, pädagogische Implikationen, qualitative Forschung, teilnehmende Beobachtung, Kategoriensystem.
Details
- Titel
- Überschreitungen im Frontal- und Werkstattunterricht
- Hochschule
- Universität Leipzig (Erziehungswissenschaft)
- Veranstaltung
- Bildungswissenschaft
- Note
- 1,3
- Autor
- BA Jennifer Lorz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V181575
- ISBN (Buch)
- 9783656048817
- ISBN (eBook)
- 9783656049289
- Dateigröße
- 872 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- überschreitungen frontal- werkstattunterricht frontalunterricht unterrichtsstörungen anfangsunterricht jürgen Reichen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- BA Jennifer Lorz (Autor:in), 2010, Überschreitungen im Frontal- und Werkstattunterricht, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/181575
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









