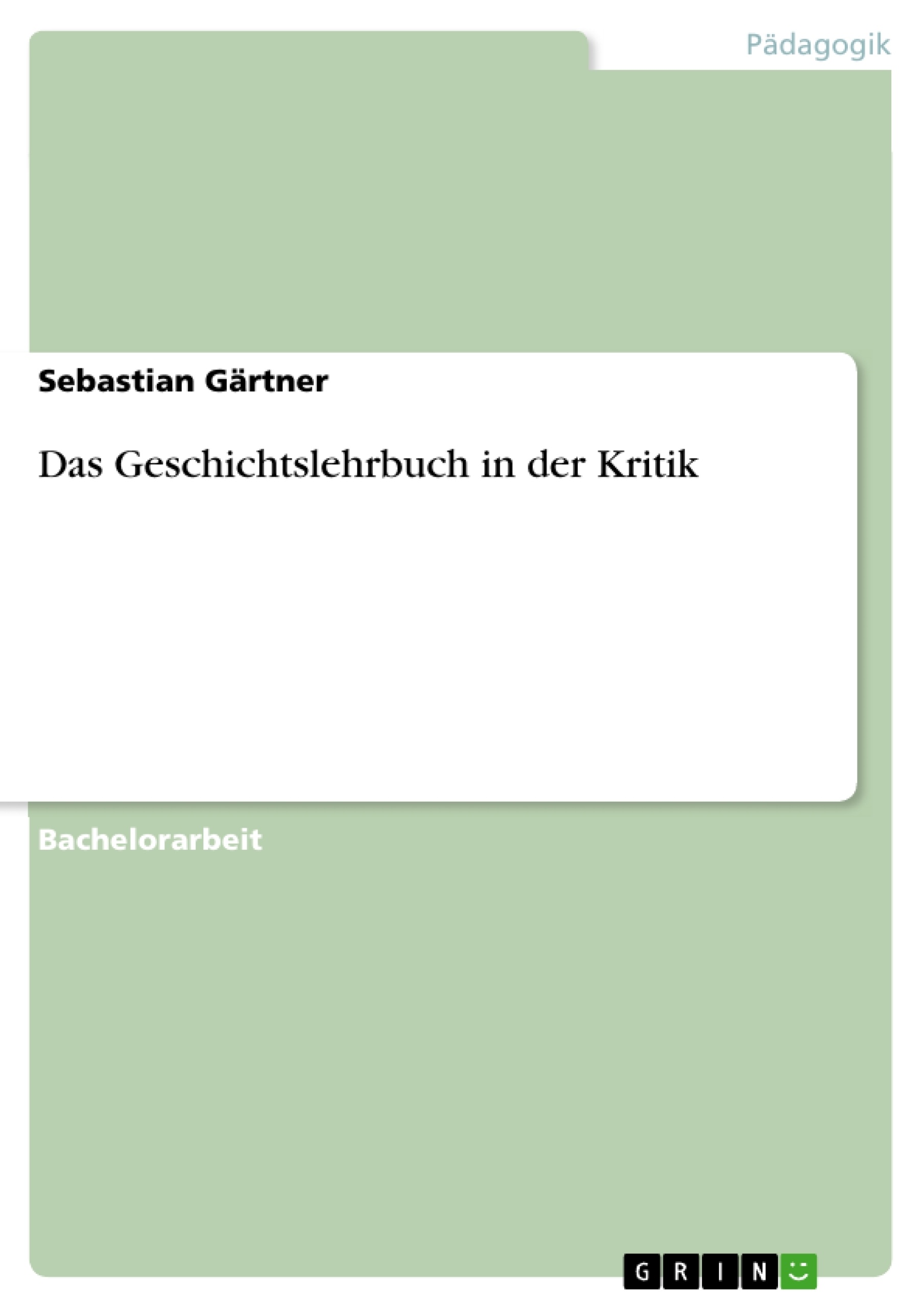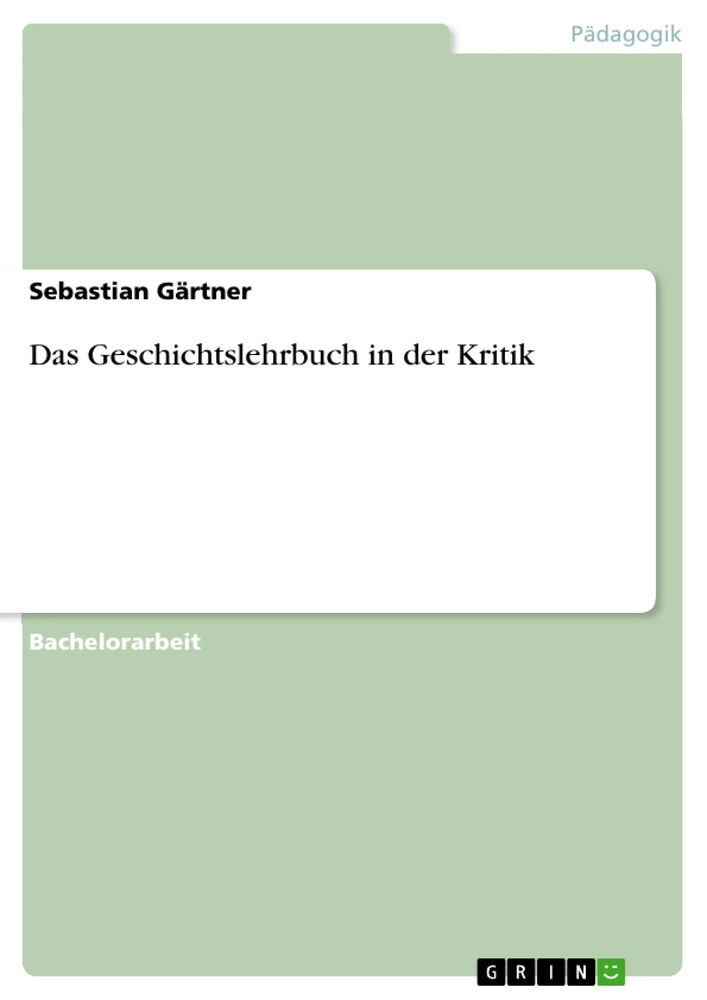
Das Geschichtslehrbuch in der Kritik
Bachelorarbeit, 2011
49 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Einflussfaktoren bei der Erstellung von Geschichtslehrbüchern sowie deren Funktion im Unterricht
- 2. Die Genese von Geschichtsbewusstsein
- 3. Lehrbuchanalyse
- 3.1. Das Verfahren der Lehrbuchanalyse
- 3.1.1 Lehrbuchanalyse am Beispiel Anno 4 Gymnasium Sachsen (Klassenstufe 8, Sekundarstufe I)
- 3.1.2 Lehrbuchanalyse am Beispiel Zeiten und Menschen 2 Gymnasium Nordrhein-Westfalen (Klasse 7, Sekundarstufe I)
- 4. Perspektivübernahme im Geschichtslehrbuch – ein Vergleich zwischen Sachsen und Nordrhein-Westfalen
- Schlussbetrachtung
- Anhang
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ausbildung von Geschichtsbewusstsein in Geschichtslehrbüchern, insbesondere im Hinblick auf die Perspektivübernahme. Im direkten Vergleich zwischen Sachsen und Nordrhein-Westfalen wird analysiert, inwieweit die Lehrbücher Perspektivübernahmen fördern und somit zur Ausbildung von Geschichtsbewusstsein beitragen können.
- Einflussfaktoren auf die Gestaltung von Geschichtslehrbüchern und deren Rolle im Unterricht
- Die Entstehung von Geschichtsbewusstsein und die Bedeutung der Perspektivübernahme
- Verfahren der Lehrbuchanalyse und deren Anwendung auf ausgewählte Lehrwerke
- Vergleich der Perspektivübernahme in Lehrbüchern aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen
- Bedeutung der Untersuchung für die Förderung von Geschichtsbewusstsein im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Geschichtslehrbuchs und seine veränderte Funktion im Unterricht. Kapitel 1 beschäftigt sich mit den Einflussfaktoren bei der Erstellung von Geschichtslehrbüchern und deren Rolle im Unterricht. Kapitel 2 definiert das Konstrukt des Geschichtsbewusstseins und ordnet die Perspektivübernahme darin ein. Kapitel 3 stellt das Verfahren der Lehrbuchanalyse vor und analysiert anhand dieser zwei ausgewählte Lehrbücher, „Anno 4“ aus Sachsen und „Zeiten und Menschen 2“ aus Nordrhein-Westfalen. Kapitel 4 vergleicht die beiden Lehrwerke hinsichtlich der Ausbildung der Perspektivübernahme anhand von drei frei gewählten Themenbereichen.
Schlüsselwörter
Geschichtslehrbuch, Geschichtsbewusstsein, Perspektivübernahme, Lehrbuchanalyse, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Schulbuch, Geschichtsdidaktik, Entwicklungspsychologie, empirische Forschung.
Details
- Titel
- Das Geschichtslehrbuch in der Kritik
- Hochschule
- Technische Universität Dresden (Institut für Geschichte)
- Note
- 1,3
- Autor
- Sebastian Gärtner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V181813
- ISBN (eBook)
- 9783656055198
- ISBN (Buch)
- 9783656055662
- Dateigröße
- 760 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Geschichtsdidaktik Geschichtslehrbuch Lehrbuch Geschichtsbewusstsein Perspektivübernahme
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Sebastian Gärtner (Autor:in), 2011, Das Geschichtslehrbuch in der Kritik, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/181813
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-