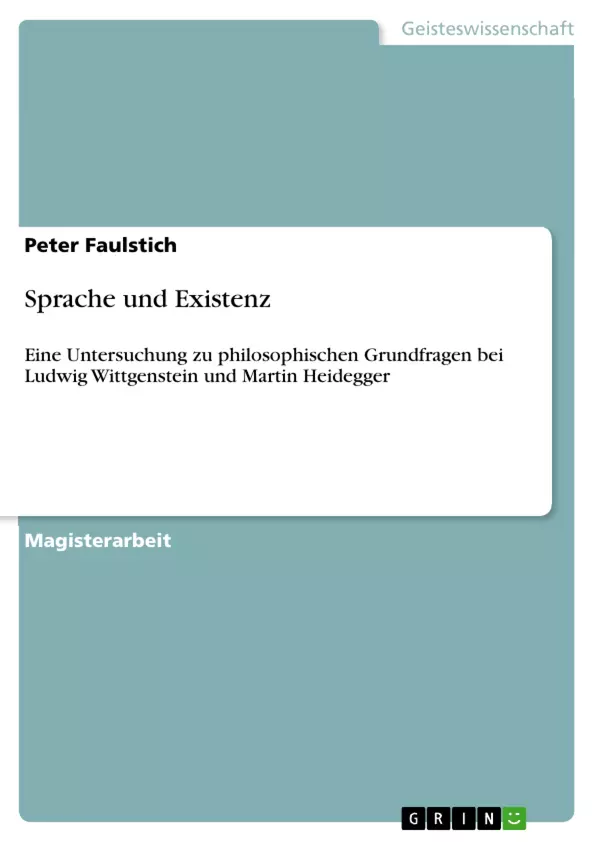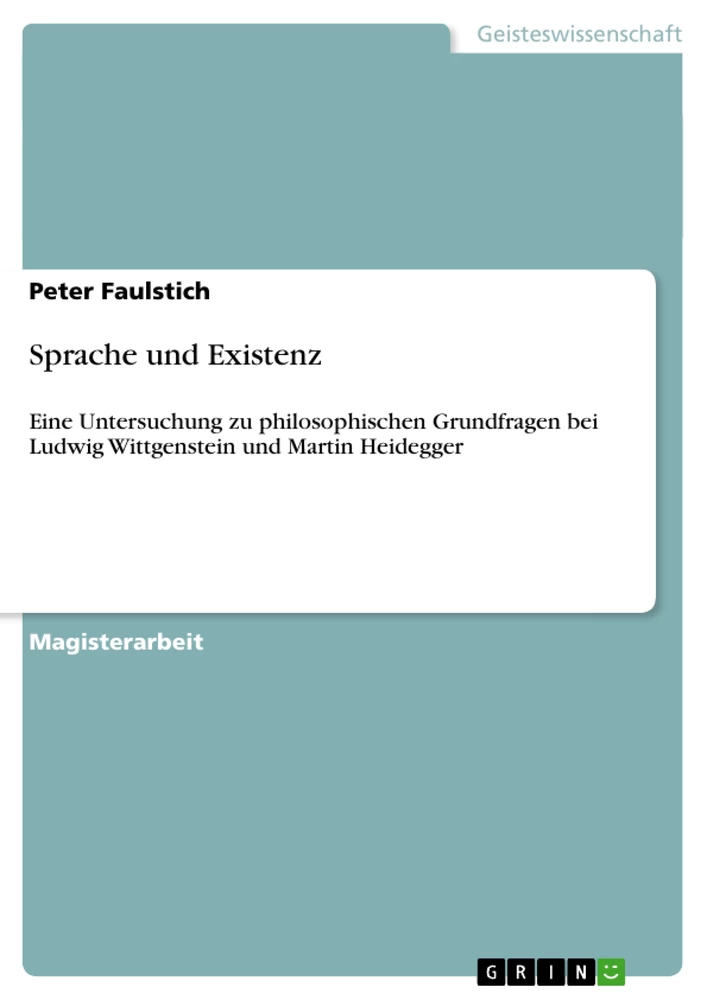
Sprache und Existenz
Magisterarbeit, 2006
98 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Methode beider Denker und deren Grundverständnis von Philosophie
- Heidegger und die phänomenologische Methode
- Hermeneutik und Destruktion
- Phänomenologie
- Wittgenstein und die Sprachkritik
- Philosophie als Therapie
- „,Phänomenologie ist Grammatik“
- Heidegger und Wittgenstein im methodischen Dialog
- Fundamente des Erkennens: In-der-Welt-sein vs. In-Sprachspielen-sein
- Heideggers „In-der-Welt-sein“
- „In-Sein" als Ausgangspunkt
- Die Frage nach der Existenz der Außenwelt
- Wittgensteins In-Sprachspielen-sein
- Einer Regel folgen
- „Gewißheit“ als Lebensform
- Heidegger und Wittgenstein im erkenntnistheoretischen Dialog
- Destruktion einer verdinglichten Bewusstseinsphilosophie
- Heideggers Kritik der Vorhandenheitsontologie
- „Dasein, Mitsein, Selbstsein“
- Das Problem des Fremdpsychischen
- Wittgensteins Kritik der Vorhandenheitssemantik
- Innen- und Außenmetaphorik
- „Einstellung zur Seele“
- Heidegger und Wittgenstein im bewusstseinsphilosophischen Dialog
- Existentiale Grammatik
- Formen der Grundsituation
- Grammatischer Aufweis des „Mitseins“ Heideggers
- Existentialer Aufweis des Einstellungsansatzes Wittgensteins
- Gleichursprünglichkeit existentialer und grammatischer Formen
- Sinnkritische Wende der Philosophie
- Ausblick
- Nachweise
- Siglenverzeichnis
- Sekundärliteratur
- Bildnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit den philosophischen Grundfragen von Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger. Sie analysiert die methodischen Ansätze beider Denker und untersucht, wie sie die Bedingungen des Erkennens und die Frage nach der Existenz des Menschen in den Kontext der Lebenspraxis stellen. Die Arbeit beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen, insbesondere in Bezug auf die Kritik an der traditionellen Bewusstseinsphilosophie und die Suche nach einer neuen, existentiellen Grammatik.
- Methodische Ansätze von Wittgenstein und Heidegger
- Die Frage nach der Existenz der Außenwelt
- Kritik an der Bewusstseinsphilosophie
- Existentiale Grammatik und Sinnkritik
- Die Rolle der Sprache im Denken und der Existenz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die methodischen Ansätze von Wittgenstein und Heidegger vor. Es wird gezeigt, wie Heidegger die phänomenologische Methode zur Analyse der menschlichen Existenz einsetzt, während Wittgenstein die Sprachkritik als Mittel zur Klärung philosophischer Probleme verwendet. Das Kapitel beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren methodischen Ansätzen und zeigt, wie sie sich in einem methodischen Dialog begegnen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Fundamente des Erkennens. Es wird Heideggers Konzept des „In-der-Welt-sein“ mit Wittgensteins „In-Sprachspielen-sein“ verglichen. Beide Denker betonen die situative Verfasstheit des Erkennens, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Heidegger betont die existentiale Dimension des „In-der-Welt-sein“, während Wittgenstein die Bedeutung der Sprache und der Sprachspiele für das Erkennen hervorhebt. Das Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren erkenntnistheoretischen Ansätzen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Destruktion einer verdinglichten Bewusstseinsphilosophie. Es wird Heideggers Kritik der Vorhandenheitsontologie mit Wittgensteins Kritik der Vorhandenheitssemantik verglichen. Beide Denker kritisieren die Vorstellung eines unabhängigen, objektiven Bewusstseins und zeigen, wie die traditionelle Bewusstseinsphilosophie zu einer Verdinglichung der menschlichen Existenz führt. Das Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen zur Kritik der Bewusstseinsphilosophie.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der „existentiellen Grammatik“. Es wird gezeigt, wie Heidegger und Wittgenstein die Sprache als Ausdruck der menschlichen Existenz verstehen. Heidegger betont die grammatischen Strukturen des „Mitseins“, während Wittgenstein die Bedeutung der „Einstellung zur Seele“ für das Verständnis der menschlichen Existenz hervorhebt. Das Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen zur „existentiellen Grammatik“ und zeigt, wie sie zu einer sinnkritischen Wende der Philosophie führen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Philosophie von Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger, die phänomenologische Methode, die Sprachkritik, das „In-der-Welt-sein“, das „In-Sprachspielen-sein“, die Kritik an der Bewusstseinsphilosophie, die „existentiale Grammatik“ und die Sinnkritik. Die Arbeit beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen beider Denker und zeigt, wie sie die Bedingungen des Erkennens und die Frage nach der Existenz des Menschen in den Kontext der Lebenspraxis stellen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Heidegger und Wittgenstein?
Beide geben der vortheoretischen Alltagspraxis den Vorzug vor der Theorie und können als Anti-Cartesianer verstanden werden, die die traditionelle Bewusstseinsphilosophie ablehnen.
Was bedeutet Heideggers Konzept des „In-der-Welt-seins“?
Es beschreibt die menschliche Existenz (Dasein) als grundlegend in eine Welt eingebunden, was die Trennung von Subjekt und Objekt hinterfragt.
Was versteht Wittgenstein unter „Sprachspielen“?
Sprachspiele sind Formen des Sprachgebrauchs, die eng mit menschlichen Lebensformen und praktischem Handeln (Regeln folgen) verknüpft sind.
Wie stehen die beiden Denker zur Phänomenologie?
Während Heidegger die phänomenologische Methode zur Analyse der Existenz nutzt, vertritt Wittgenstein die Ansicht „Phänomenologie ist Grammatik“ und nutzt Sprachkritik als Klärung.
Was ist das Ziel der „sinnkritischen Wende“ in dieser Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie beide Philosophen traditionelle philosophische Fragen durch einen Rückzug auf die Phänomene des Lebens und der Sprache neu verorten.
Details
- Titel
- Sprache und Existenz
- Untertitel
- Eine Untersuchung zu philosophischen Grundfragen bei Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger
- Hochschule
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Philosophie)
- Note
- 1,0
- Autor
- Peter Faulstich (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 98
- Katalognummer
- V182294
- ISBN (Buch)
- 9783656056744
- ISBN (eBook)
- 9783656057017
- Dateigröße
- 945 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- sprache existenz eine untersuchung grundfragen ludwig wittgenstein martin heidegger
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 40,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Peter Faulstich (Autor:in), 2006, Sprache und Existenz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/182294
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-