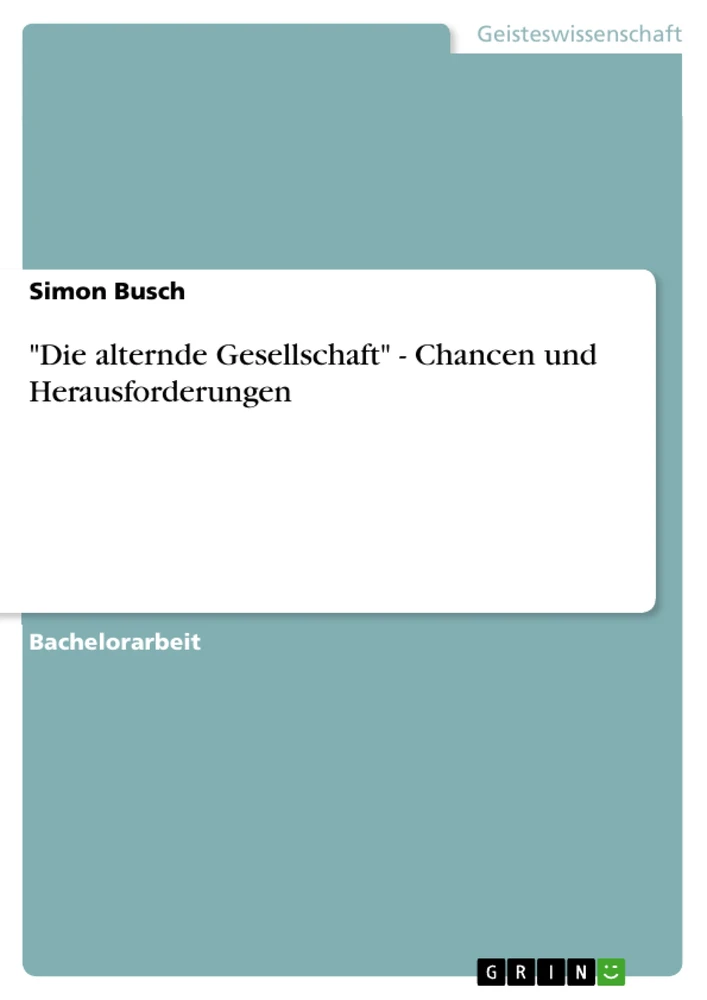
"Die alternde Gesellschaft" - Chancen und Herausforderungen
Bachelorarbeit, 2011
51 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Demographische Aspekte der Altersgesellschaft
- 3. „Alter“ und „Altern“
- 3.1 Dimensionen des Alterns
- 3.1.1 Kalendarisches Altern
- 3.1.2 Biologisches Altern
- 3.1.3 Psychisches Altern
- 3.2 Altersbilder und Altersstereotype
- 3.3 Schlussfolgerungen...
- 3.1 Dimensionen des Alterns
- 4. Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft .....
- 4.1 Arbeitsmarkt und Arbeitswelt....
- 4.1.1 Das Potential älterer Arbeitnehmer
- 4.1.2 Neue Wege auf dem Arbeitsmarkt
- 4.2 Sozialpolitik und soziale Ungleichheit in der Altersgesellschaft
- 4.2.1 Das System der Alterssicherung
- 4.2.2 Drohende Armut und Ausgrenzung?..\n
- 4.3 Lebenslauf und Lebensformen.........
- 4.3.1 Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen
- 4.3.2 Familiäre Strukturen und Generationenbeziehungen
- 4.3.2 Freizeit und die freie Zeit
- 4.3.4 Technik im Alter
- 4.1 Arbeitsmarkt und Arbeitswelt....
- 5. Das „vierte Alter“.........
- 5.1 Die Kultur des Sterbens
- 5.2 Das soziale Sterben..........\n
- 5.3 Ein würdiger letzter Lebensabschnitt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Situation der Altersgesellschaft und den demographischen Wandel zu liefern. Die Arbeit soll Ursachen und Folgen des Wandels erläutern sowie die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen objektiv darstellen.
- Demographische Aspekte der Altersgesellschaft
- Dimensionen des Alterns
- Altersbilder und Altersstereotype
- Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft
- Das „vierte Alter“ und die Kultur des Sterbens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die demographischen Aspekte der Altersgesellschaft und untersucht die Ursachen des demographischen Wandels. Kapitel 3 befasst sich mit den verschiedenen Dimensionen des Alterns, einschließlich des kalendarischen, biologischen und psychischen Alterns, und beleuchtet die Rolle von Altersbildern und Altersstereotypen. Kapitel 4 analysiert Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft in den Bereichen Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und Lebensformen. Das Kapitel 5 behandelt das „vierte Alter“ und widmet sich Themen wie der Kultur des Sterbens und dem sozialen Sterben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Altersgesellschaft, des demographischen Wandels, der Dimensionen des Alterns, der Herausforderungen und Chancen in einer alternden Gesellschaft und den soziokulturellen Problemen des Sterbens.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für die alternde Gesellschaft in Deutschland?
Hauptgründe sind der medizinische Fortschritt, eine höhere Lebenserwartung und gleichzeitig sinkende Geburtenraten.
Welche Herausforderungen ergeben sich für den Arbeitsmarkt?
Es stehen immer weniger junge Erwerbstätige einer wachsenden Zahl von Rentnern gegenüber, was neue Wege zur Nutzung des Potenzials älterer Arbeitnehmer erfordert.
Was bedeutet „kalendarisches“ vs. „biologisches“ Altern?
Kalendarisches Altern misst die Lebensjahre, während biologisches Altern den körperlichen Zustand und psychisches Altern das subjektive Empfinden beschreibt.
Wie sicher ist das System der Alterssicherung?
Der demographische Wandel setzt die Rentensysteme unter Druck, was zu Maßnahmen wie der „Rente mit 67“ und Diskussionen über drohende Altersarmut führt.
Was versteht man unter dem „vierten Alter“?
Es bezeichnet den letzten Lebensabschnitt, der oft durch Pflegebedürftigkeit geprägt ist, und thematisiert eine würdevolle Kultur des Sterbens.
Details
- Titel
- "Die alternde Gesellschaft" - Chancen und Herausforderungen
- Hochschule
- Universität Trier
- Note
- 1,0
- Autor
- Simon Busch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 51
- Katalognummer
- V182401
- ISBN (Buch)
- 9783656061762
- ISBN (eBook)
- 9783656062165
- Dateigröße
- 1480 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- gesellschaft chancen herausforderungen Altern Altersgesellschaft Sterben Tod Rente Lebensphase hospiz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Simon Busch (Autor:in), 2011, "Die alternde Gesellschaft" - Chancen und Herausforderungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/182401
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









