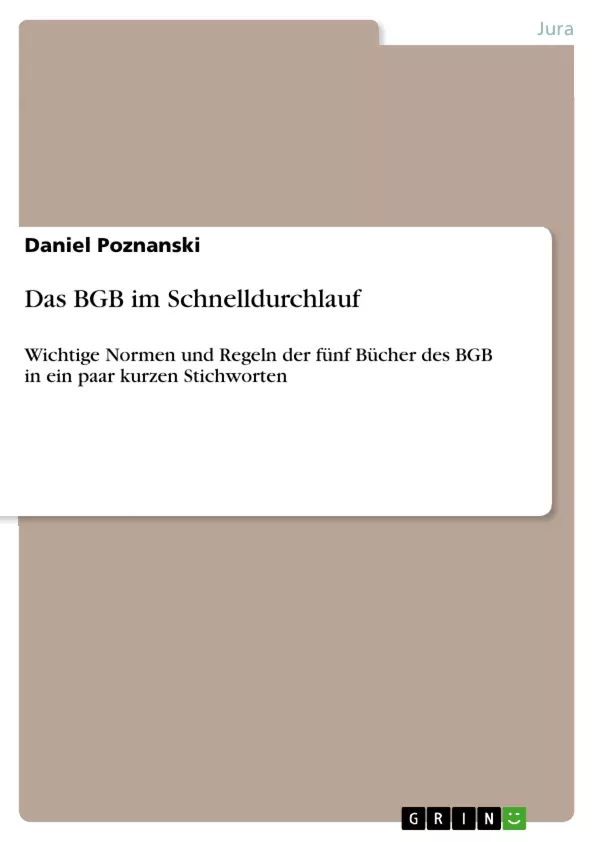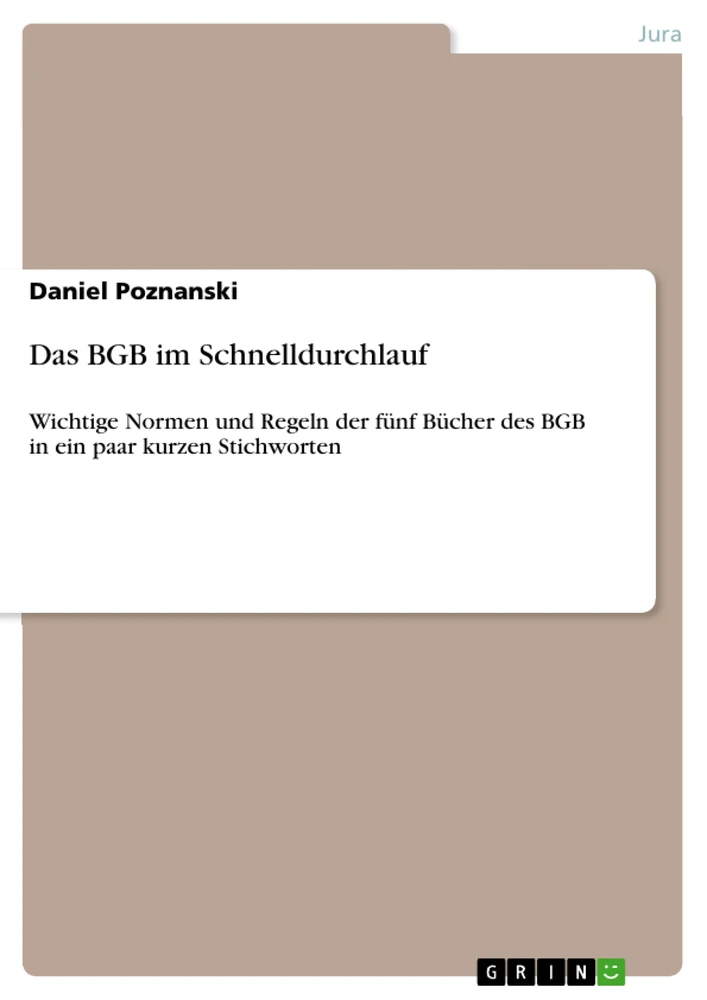
Das BGB im Schnelldurchlauf
Fachbuch, 2011
53 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Erstes Buch: Allgemeiner Teil des BGB (BGB AT)
- Der Einstieg
- Die Willenserklärung
- Anfechtung
- Scherzerklärung
- Die Stellvertretung
- Zweites Buch: Schuldrecht
- Kaufrecht
- Kaufvertragstypische Pflichten
- Tausch
- Schenkung
- Darlehensvertrag
- Werk- und Dienstverträge
- Der Reisevertrag
- Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA)
- Bürgschaftsvertrag
- Verzug
- Drittes Buch: Sachenrecht
- Der Besitz, §§ 854 ff BGB
- Das Eigentum, §§ 903 ff BGB
- Grundstücksrecht, §§ 873 ff BGB
- Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen
- Viertes Buch: Familienrecht
- Die Ehe
- Die Scheidung, §§ 1564 - 1588 BGB
- Verwandtschaft
- Die Adoption
- Vormundschaft, §§ 1773 ff BGB
- Betreuung
- Fünftes Buch: Erbrecht
- Die Erbfolge
- Pflichtteilsrecht
- Erbunwürdigkeit
- Testamente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch bietet eine kurze und prägnante Übersicht über wichtige Normen und Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Es soll als Einstieg in die Thematik dienen und den Leser mit den grundlegenden Rechtsbegriffen vertraut machen.
- Grundlagen des BGB und dessen Anwendung im Alltag
- Wichtige Rechtsgeschäfte und deren rechtliche Folgen
- Schuldrechtliche Beziehungen und deren Regelung im BGB
- Sachenrechtliche Aspekte und das Recht am Eigentum
- Familienrechtliche Themen wie Ehe, Scheidung und Adoption
Zusammenfassung der Kapitel
Die einzelnen Kapitel des Buches behandeln wichtige Bereiche des BGB, beginnend mit den Grundlagen des Allgemeinen Teils (BGB AT). In diesem Teil werden die Grundprinzipien des Rechtsgeschäfts und der Willenserklärung erläutert. Das zweite Buch beschäftigt sich mit dem Schuldrecht, welches die rechtlichen Beziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner regelt. Hier werden verschiedene Arten von Verträgen wie Kaufverträge, Darlehensverträge und Dienstverträge vorgestellt. Das dritte Buch behandelt das Sachenrecht, das sich mit den Rechtsbeziehungen zwischen Personen und Sachen beschäftigt. Es werden die Themen Besitz, Eigentum und Grundstücksrecht erläutert. Das vierte Buch widmet sich dem Familienrecht und behandelt die Themen Ehe, Scheidung, Verwandtschaft, Adoption und Vormundschaft. Schließlich beleuchtet das fünfte Buch das Erbrecht, das die Nachfolge nach dem Tod einer Person regelt.
Schlüsselwörter
Das Bürgerliche Gesetzbuch, Rechtsgeschäfte, Willenserklärung, Schuldrecht, Kaufrecht, Sachenrecht, Eigentum, Familienrecht, Ehe, Erbrecht, Erbfolge, Pflichtteilsrecht, Testament, Vertragsrecht, Rechtsbegriffe, rechtliche Interaktion, Rechtsordnung, Rechtsfolgen, Rechtsprechung, Rechtswissenschaften.
Details
- Titel
- Das BGB im Schnelldurchlauf
- Untertitel
- Wichtige Normen und Regeln der fünf Bücher des BGB in ein paar kurzen Stichworten
- Autor
- Diplom-Jurist Daniel Poznanski (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V182667
- ISBN (Buch)
- 9783656063698
- ISBN (eBook)
- 9783656063933
- Dateigröße
- 546 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- BGB, Stichworte, Rechtskunde, Zivilrecht, fünf Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuchs
- Schlagworte
- schnelldurchlauf wichtige normen regeln bücher stichworten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Diplom-Jurist Daniel Poznanski (Autor:in), 2011, Das BGB im Schnelldurchlauf, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/182667
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-